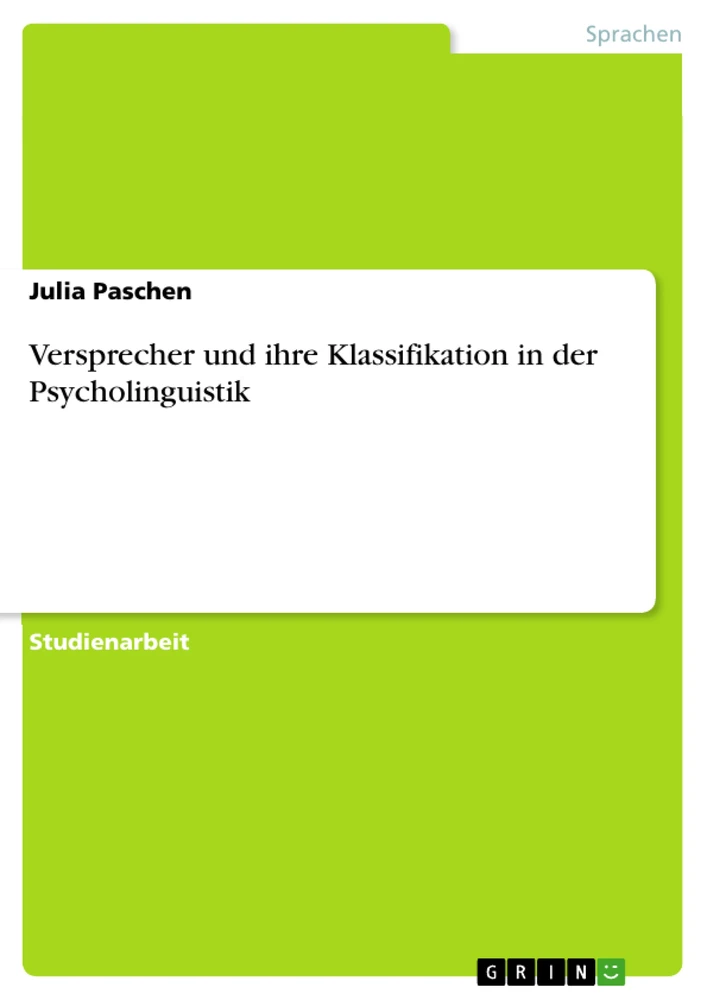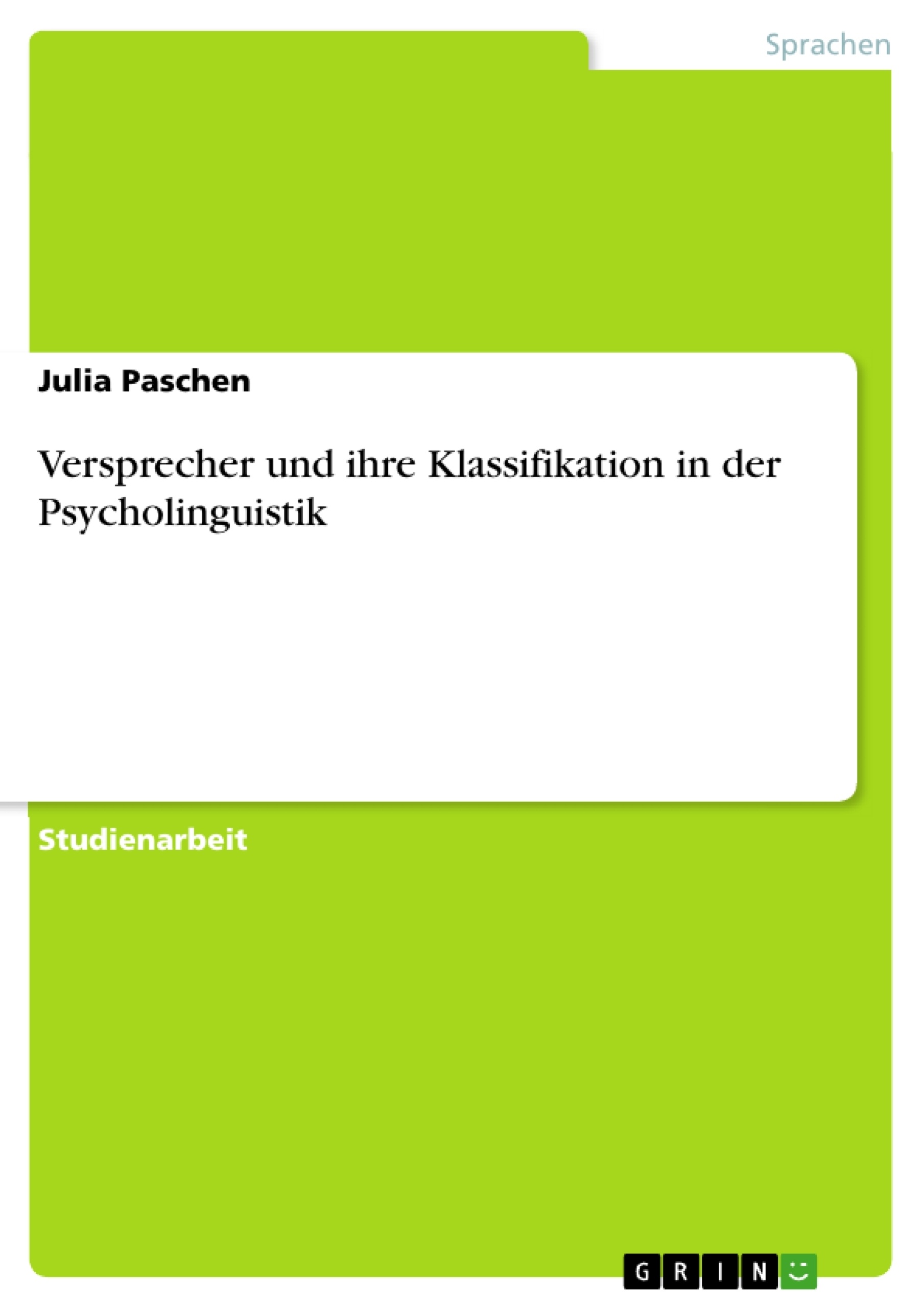Der Versprecher, auch „lapsus linguae“ (Fehler beim Sprechen) genannt, ist ein alltägliches Phänomen, welches jedem Sprecher unfreiwillig widerfährt. Es ist egal, ob dieser ein geübter Redner ist oder nicht. Bereits seit Ende des neunzehnten Jahrhunderts beschäftigten sich etliche Linguisten mit Versprechern, ihrer Entstehung im Sprachzentrum des Gehirns und damit, welche Rückschlüsse sie auf den Aufbau des mentalen Lexikons zulassen.
Die Untersuchung von Versprechern in der Psycholinguistik beschäftigt sich mit psychischen, mentalen, physiologischen und kognitiven Vorgänge bei der Sprachproduktion. Eine Funktion von Sprache ist es, Gedanken darzustellen und mitzuteilen. Versprecher gibt es jedoch nicht nur in der Sprache, sondern auch beim Schreiben („lapsus calami“) und als Gedächtnisfehler („lapsus memoriae“).
Wie Sprachproduktion entsteht, wird anhand von mindestens drei Phasen in einem Sprachproduktionsmodell festgelegt. In der ersten Phase geht es um die gedankliche und inhaltliche Planung, in der zweiten Phase erhalten die Inhalte ihre richtige sprachliche Form und in der letzten Phase werden die sprachlichen Formen in Laute umgewandelt und realisiert. Eine bewusste Planung geht somit voran, jedoch geschieht die Ausführung ohne bewusste Kontrolle. Beim Sprechen greift der Mensch auf seinen eigenen Wortschatz zurück, das eigene mentale Lexikon.
Dieses mentale Lexikon ist nicht alphabetisch sortiert, sondern nach Bedeutungszugehörigkeiten geordnet. Verben wie „gehen“, „laufen“, „rennen“ befinden sich an einem Ort, genauso Nomen wie „Sofa“, „Couch“ und „Sessel“. Aufgrund dessen entstehen einige Versprecher bei Wörtern, die semantische Gegensätze ausdrücken, aber in dem mentalen Lexikon eine Bedeutungszugehörigkeit haben. Außerdem sind phonetisch ähnliche Wörter in dem mentalen Lexikon ebenfalls so abgespeichert, das es die Verwechselungsgefahr steigert.
Definitorische Probleme sind Gegenstand des ersten Kapitels dieser Arbeit. Des Weiteren sind nicht nur der Ursprung und die Definition für Linguisten und Forscher interessant, sondern auch die Klassifikation von Versprechern, die jeweiligen Versprechertypen, Versprechertheorien und Reparaturen, die anhand von Beispielen genauer erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition und Entstehung von Versprechern
- 3. Klassifikation von Versprechern aus linguistischer Perspektive
- 3.1 Kategorisierung von Versprechern in der Versprecherforschung
- 3.2 Versprechertypen nach Thomas Berg
- 4. Psychoanalytische Perspektive
- 4.1 Freud'sche Fehlleistung
- 5. Reparaturen
- 5.1 Was sind Reparaturen?
- 5.2 Die vier Klassen der Selbstreparaturen und ihre Phasen
- 6. Zusammenfassung & Anwendung der Theorien anhand eines Beispiels
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Versprecher aus psycholinguistischer Perspektive. Ziel ist es, die Definition, Entstehung und Klassifizierung von Versprechern zu beleuchten und verschiedene theoretische Ansätze zu präsentieren. Die Arbeit analysiert Sprachproduktionsmodelle und untersucht, wie Versprecher Aufschluss über den Aufbau des mentalen Lexikons geben können.
- Definition und Entstehung von Versprechern
- Linguistische Klassifizierung von Versprechern
- Psychoanalytische Interpretation von Versprechern
- Reparaturmechanismen bei Versprechern
- Anwendung der Theorien anhand von Beispielen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Versprecher ein und stellt die Relevanz der Untersuchung heraus. Sie beschreibt Versprecher als alltägliches Phänomen, das in verschiedenen Bereichen wie Sprache, Schrift und Gedächtnis auftritt. Die Einleitung erwähnt die Bedeutung der Psycholinguistik bei der Untersuchung von Versprechern und führt in die verschiedenen Phasen des Sprachproduktionsmodells ein, wobei die bewusste Planung im Gegensatz zur unbewussten Ausführung betont wird. Schließlich wird die Rolle des mentalen Lexikons und seine Organisation nach semantischen und phonetischen Ähnlichkeiten angesprochen, die zur Entstehung von Versprechern beitragen.
2. Definition und Entstehung von Versprechern: Dieses Kapitel definiert Versprecher als unbeabsichtigte Abweichungen vom Sprechplan und unterscheidet zwischen spontanen und künstlich erzeugten Versprechern. Es werden Sprachfehler ausgeschlossen, die auf Hirnschädigungen oder unvollständigem Spracherwerb beruhen. Der Fokus liegt auf Performanzfehlern kompetenter, erwachsener Sprecher in ihrer Muttersprache, die durch Faktoren wie Müdigkeit, Stress und Zeitdruck entstehen können. Die Definition von Versprechern wird anhand von bestehenden wissenschaftlichen Definitionen erläutert und eingeordnet.
3. Klassifikation von Versprechern: Dieses Kapitel befasst sich mit der linguistischen Klassifizierung von Versprechern. Es beschreibt die unterschiedlichen Kategorisierungen von Linguisten und Psycholinguisten und hebt die Arbeit von Rudolf Meringer als Pionier auf diesem Gebiet hervor. Die Klassifizierung basiert auf dem Vergleich zwischen beabsichtigter und tatsächlicher Äußerung, wobei die beabsichtigte Äußerung oft durch Selbstkorrekturen erschlossen werden muss. Es werden verschiedene Kategorien wie Phonem-, Morphem- und Wortfehler sowie Vertauschungen, Substitutionen, Additionen und Elisionen erläutert. Schließlich wird das dreidimensionale Raster von Thomas Berg zur Klassifizierung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Versprecher, Psycholinguistik, Sprachproduktion, mentales Lexikon, Sprachfehler, Klassifikation, Reparaturmechanismen, Freud'sche Fehlleistung, Sprachproduktionsprozess, semantische Ähnlichkeit, phonetische Ähnlichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Versprechern aus psycholinguistischer Perspektive
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Versprecher aus psycholinguistischer Sicht. Sie beleuchtet Definition, Entstehung und Klassifizierung von Versprechern und präsentiert verschiedene theoretische Ansätze.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Definition, Entstehung und Klassifizierung von Versprechern zu erklären und verschiedene theoretische Perspektiven darzulegen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Sprachproduktionsmodellen und der Frage, wie Versprecher Aufschluss über den Aufbau des mentalen Lexikons geben können.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Definition und Entstehung von Versprechern, linguistische Klassifizierung von Versprechern, psychoanalytische Interpretation von Versprechern, Reparaturmechanismen bei Versprechern und die Anwendung der Theorien anhand von Beispielen.
Wie werden Versprecher definiert und wie entstehen sie?
Versprecher werden als unbeabsichtigte Abweichungen vom Sprechplan definiert. Die Arbeit unterscheidet zwischen spontanen und künstlich erzeugten Versprechern und konzentriert sich auf Performanzfehler kompetenter, erwachsener Sprecher in ihrer Muttersprache. Entstehungsfaktoren sind u.a. Müdigkeit, Stress und Zeitdruck.
Welche linguistischen Klassifikationen von Versprechern werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Kategorisierungen von Linguisten und Psycholinguisten, darunter die Arbeit von Rudolf Meringer. Klassifizierungen basieren auf dem Vergleich zwischen beabsichtigter und tatsächlicher Äußerung. Es werden Kategorien wie Phonem-, Morphem- und Wortfehler, sowie Vertauschungen, Substitutionen, Additionen und Elisionen erläutert. Das dreidimensionale Raster von Thomas Berg wird ebenfalls vorgestellt.
Wie wird die psychoanalytische Perspektive auf Versprecher betrachtet?
Die Arbeit integriert die psychoanalytische Perspektive, insbesondere die Freud'sche Fehlleistungstheorie, um Versprecher zu interpretieren. (Details zur konkreten Ausarbeitung der Freud'schen Perspektive im Text einfügen).
Welche Rolle spielen Reparaturmechanismen?
Die Arbeit behandelt Reparaturmechanismen bei Versprechern, einschließlich der Definition von Reparaturen und der vier Klassen der Selbstreparaturen mit ihren Phasen. (Details zu den Klassen und Phasen im Text einfügen).
Wie werden die Theorien anhand von Beispielen angewendet?
Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und der Anwendung der vorgestellten Theorien anhand eines konkreten Beispiels. (Details zum Beispiel im Text einfügen).
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Versprecher, Psycholinguistik, Sprachproduktion, mentales Lexikon, Sprachfehler, Klassifikation, Reparaturmechanismen, Freud'sche Fehlleistung, Sprachproduktionsprozess, semantische Ähnlichkeit, phonetische Ähnlichkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Definition und Entstehung von Versprechern, linguistischen Klassifikationen von Versprechern, psychoanalytischer Perspektive, Reparaturmechanismen und einer Zusammenfassung mit Anwendungsbeispiel.
- Quote paper
- Julia Paschen (Author), 2015, Versprecher und ihre Klassifikation in der Psycholinguistik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344577