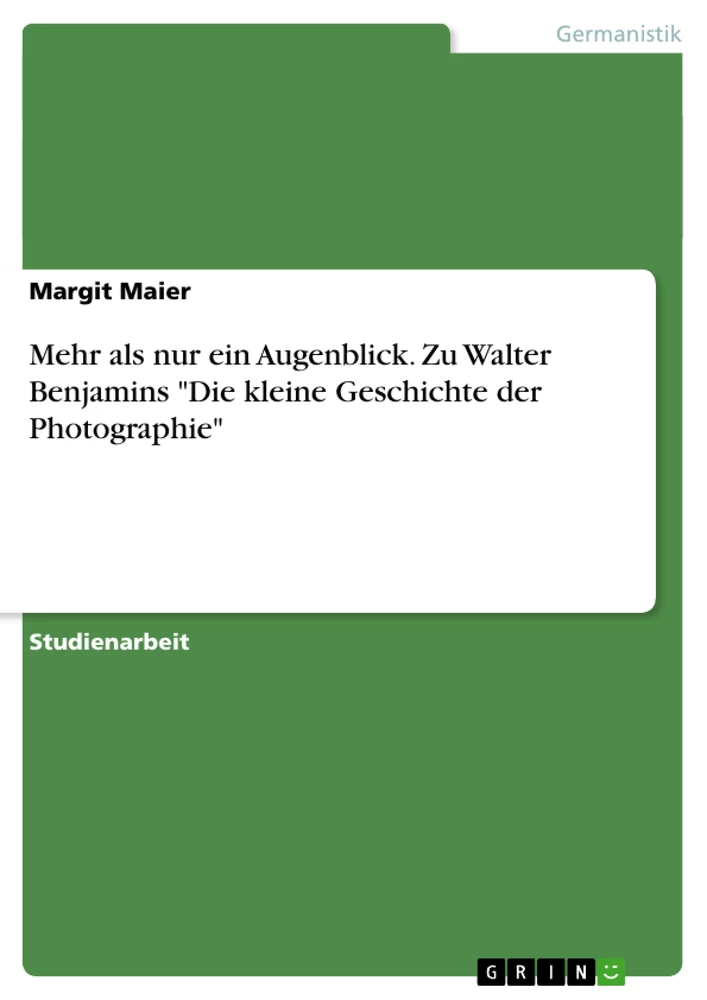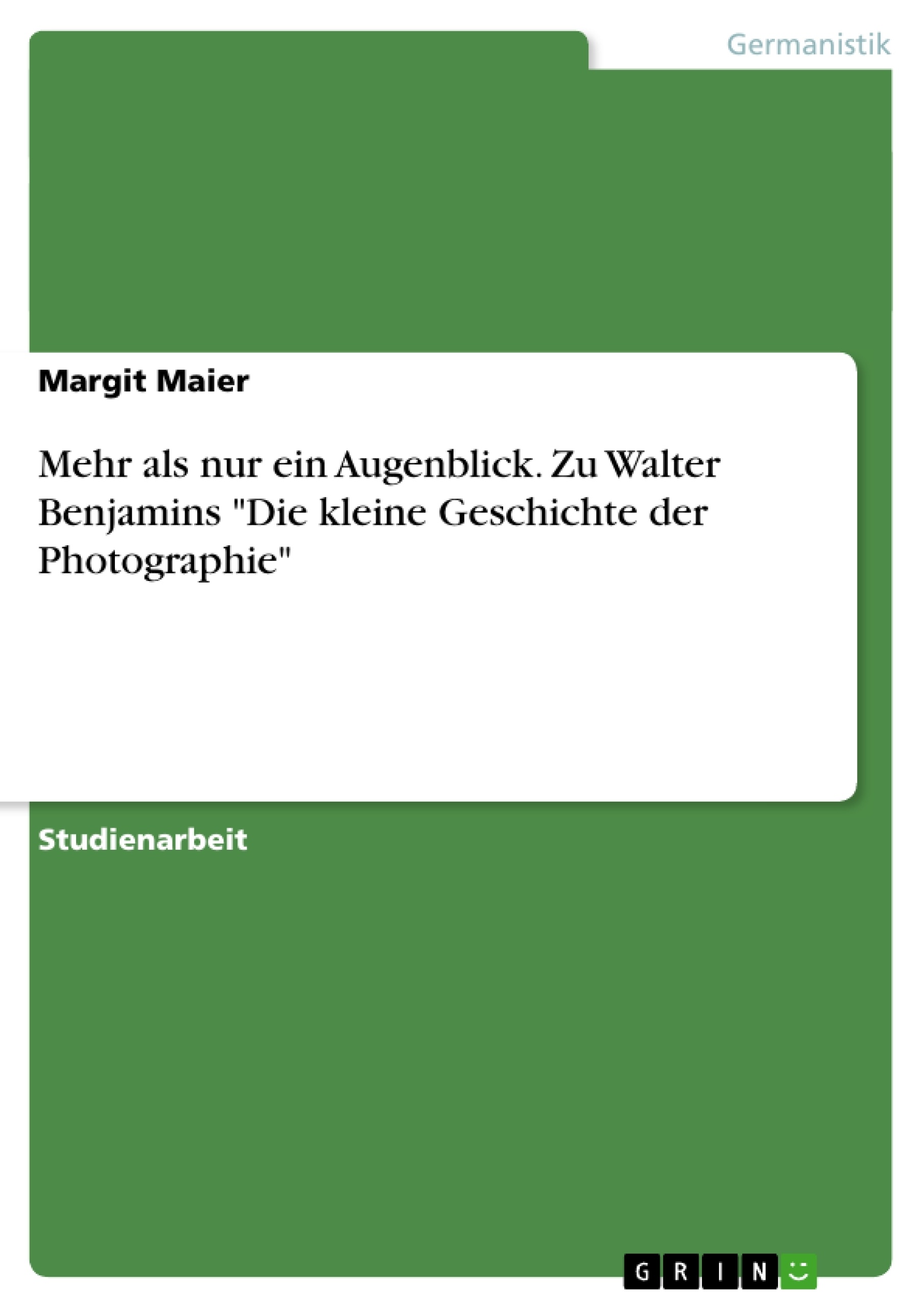„Nicht der Schrift-, sondern der Photographieunkundige wird, so hat man gesagt, der Analphabet der Zukunft sein.“ (385) Mit diesen Worten zitiert Walter Benjamin eine Aussage Charles Baudelaires in seiner „Kleinen Geschichte der Photographie“. Was bedeutet es, „photographieunkundig“ zu sein? Nicht die fehlenden technischen oder praktischen Fähigkeiten meint Benjamin damit, sondern die Unfähigkeit, eine Fotografie lesen und deuten zu können. Für ihn besitzt das stets im Fortschritt begriffene Medium eine eigene Sprache, die es zu entschlüsseln gilt. Das Vokabular, dessen er sich dabei bedient, ist durchzogen von Begriffen aus den Bereichen der Magie und der Mystik. Benjamin erkennt der Fotografie Eigenschaften an, die über die reine Abbildung der sichtbaren Realität hinausgehen. Seine Faszination erweckt besonders das Einfangen des Moments, des Augenblicks, wie er in der normalen Wahrnehmung nicht festgehalten werden kann, da das menschliche Gehirn nur in fortlaufenden Prozessen begreift. Auf der Suche nach den verborgenen Gehalten des Mediums gelangt Benjamin zu verschiedenen Ansätzen, die er später in weiteren Aufsätzen, vor allem in „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ weiterentwickelt, und welche kennzeichnend für den Benjaminischen Blick auf die moderne Medienwelt werden sollen.
Walter Benjamin betritt zusammen mit wenigen anderen Neuzeit-Philosophen ein völlig neues Gebiet der Medienkritik. Die pragmatischen Kriterien der Fotografie beiseite lassend widmet er sich in subjektiver Betrachtungsweise ihren verborgenen Qualitäten. Die Begriffswahl „Kleine Geschichte der Photographie“ ist irreführend insofern, als der Text keine fotografie-historische Abhandlung darstellt. Vielmehr erhebt sich aus der Basis einiger historischer Fakten ein Gerüst von verschiedenen Aspekten, die sich mit Ästhetik und anderen abstrakten Eigenschaften des Mediums befassen. Benjamin verlässt sich ganz auf sein eigenes Gespür und gibt seinen Emotionen Ausdruck, um das Geheimnisvolle, das Verborgene aufzudecken. Damit eröffnet er eine neue Sichtweise auf die Fotografie, die erst einige Zeit nach seinem Tod Beachtung finden sollte. Der Titel dieser Arbeit „Mehr als nur ein Augenblick“ trägt zweierlei Bedeutung: Einerseits gibt die Fotografie für Benjamin auf zeitlicher Ebene mehr wieder als nur einen Augenblick. Sie besitzt die Macht, die Vergangenheit und gleichzeitig die Zukunft wiederzuspiegeln. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Sprache eines modernen Mediums
- Die Kleine Geschichte der Fotografie
- Intention und Vorgehensweise
- Ästhetik-Theorie
- Sonderbare Aura
- Nichts als die Wahrheit - die Fotografien Atgets
- Fotografie und Psychologie
- Schöpferische Fotografie
- Übersinnlichkeit und Technik
- Roland Barthes auf den Spuren Benjamins
- Die Zeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Walter Benjamins „Kleine Geschichte der Photographie“ befasst sich mit den tiefgreifenden Eigenschaften des Mediums Fotografie, die über den bloßen technischen Aspekt hinausgehen. Benjamin untersucht die Aura des Mediums, die Fähigkeit, Momente einzufangen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind, und die Verbindung zur Psychologie und Kreativität.
- Die Aura der Fotografie und ihre Bedeutung für die Interpretation
- Die Fähigkeit der Fotografie, die Vergangenheit und Zukunft zu spiegeln
- Die Rolle der Psychologie und des Unbewussten in der Fotointerpretation
- Die Beziehung zwischen Fotografie und Technik
- Der Vergleich zwischen Benjamins „Kleiner Geschichte der Photographie“ und Roland Barthes' „Die helle Kammer“
Zusammenfassung der Kapitel
I. Sprache eines modernen Mediums: Benjamin erläutert die Bedeutung der Fotografie als eigene Sprache, die über die bloße Abbildung der Realität hinausgeht. Er bezieht sich dabei auf die „unbewussten Gehalte“ der Fotografie, die durch die menschliche Wahrnehmung entstehen. Das Kapitel zeichnet ein Bild von Benjamins Faszination für die besondere Fähigkeit der Fotografie, Momente einzufangen, die im normalen Wahrnehmungsfluss verloren gehen.
II. Die Kleine Geschichte der Fotografie:
- 1. Intention und Vorgehensweise: Dieses Kapitel beleuchtet die Intention und Vorgehensweise Benjamins in seiner „Kleinen Geschichte der Photographie“. Es werden die Fragmentarität des Textes, seine bildhafte Sprache und der Fokus auf Emotionen beschrieben. Benjamin eröffnet eine neue Perspektive auf die Fotografie, die die Interpretation des Lesers erfordert.
- 2. Ästhetik-Theorie: Benjamin stellt eine Theorie zur Ästhetik der Fotografie vor, die sich mit der Fähigkeit des Mediums auseinandersetzt, die Wahrheit des Objekts darzustellen. Er teilt die Geschichte der Fotografie in drei Phasen ein: die Blütezeit der Daguerreotypie, die Zeit der Industrialisierung und die Zeit des Verfalls des Geschmacks. Die „Aura“ der Fotografie spielt in diesem Kapitel eine zentrale Rolle.
Schlüsselwörter
Die „Kleine Geschichte der Photographie“ beschäftigt sich mit zentralen Themen wie der Aura der Fotografie, der Fähigkeit des Mediums, die Vergangenheit und Zukunft zu spiegeln, der Rolle der Psychologie und des Unbewussten bei der Bildinterpretation, der Beziehung zwischen Fotografie und Technik sowie der Geschichte des Mediums. Wichtige Schlüsselwörter sind: Aura, Augenblick, „unbewusster Gehalt“, Ästhetik, Industrialisierung, Visitformat, „Visitkartenepidemie“, David Octavius Hill, Roland Barthes, „Die helle Kammer“.
- Quote paper
- Margit Maier (Author), 2004, Mehr als nur ein Augenblick. Zu Walter Benjamins "Die kleine Geschichte der Photographie", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34456