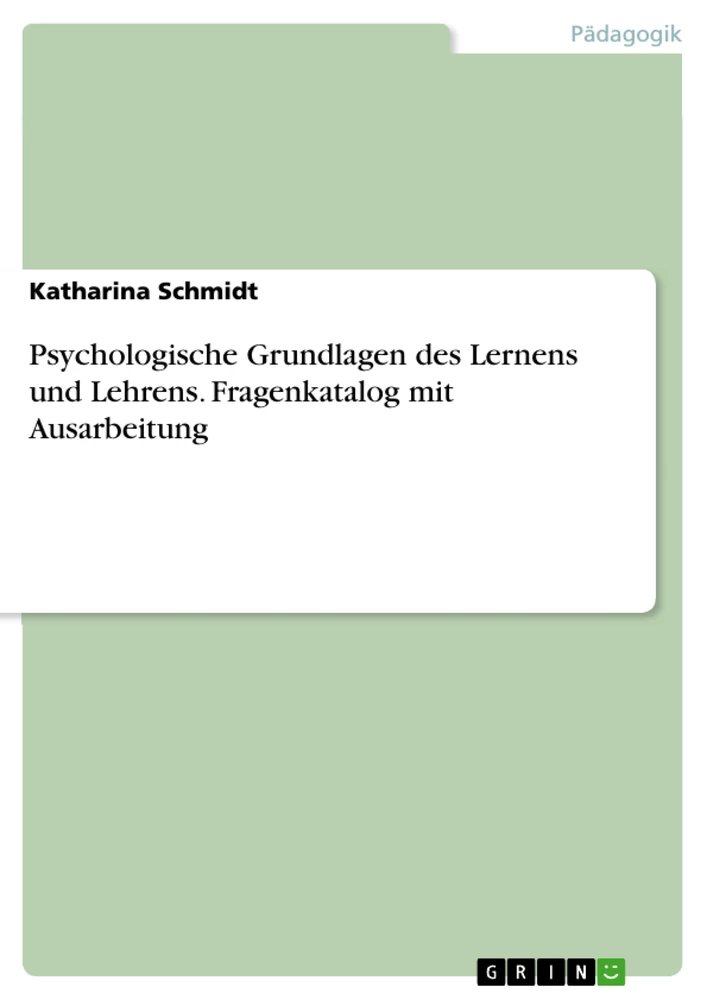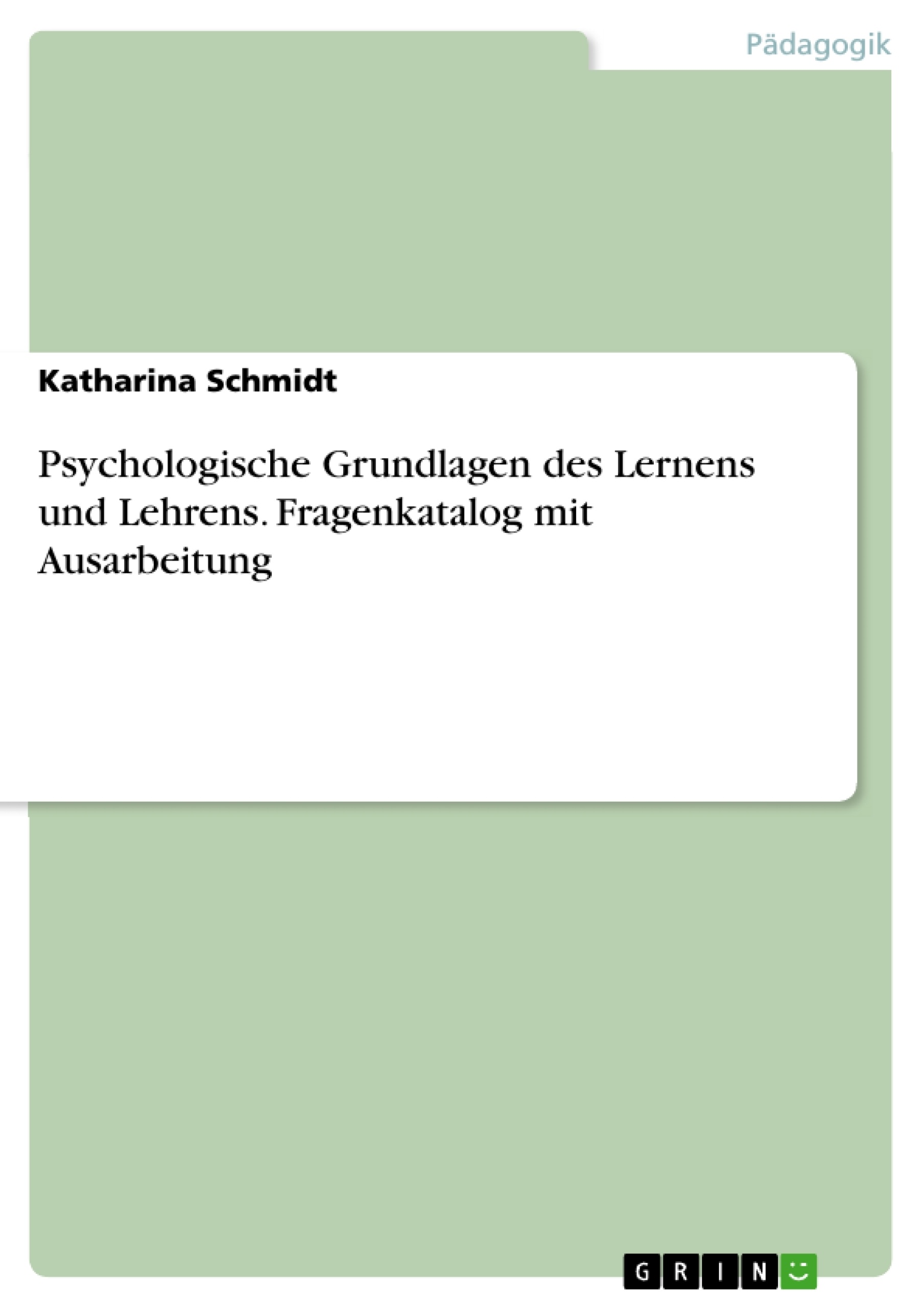Dies ist ein ausgearbeiteter Fragenkatalog der Veranstaltung "Psychologische Grundlagen des Lernens und Lehrens" an der Universität Erfurt im Hauptfach "Pädagogik der Kindheit" aus dem SS 2008. Enthalten sind über 100 Fragen, die in Stichpunkten beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist der Unterschied zwischen inzidentellem und intentionalem Lernen?
- Was ist ,,klassisches Konditionieren“ (oder respondentes K.)?
- Skizzieren Sie kurz die Sichtweise von Lernen als Verhaltensänderung (Operante Konditionierung)!
- Nennen und erläutern Sie jeweils kurz die vier operanten Lernprinzipien und geben Sie jeweils ein pädagogisch relevantes Beispiel für jedes der vier operanten Lernprinzipien!
- Was bedeutet ,,negative Verstärkung“? Erklären sie bitte an einem Beispiel!
- Erläutern sie bitte anhand der Theorie des klassischen Konditionierens die Entstehung von Schulangst. Verwenden sie dabei bitte die entsprechenden Fachbegriffe!
- Wie müssen wirksame Strafen beschaffen sein?
- Was spricht gegen Strafen im Sinne einer verhaltenspsychologischen Sichtweise von Lernen?
- Welche Alternativen zu Strafen gibt es aus verhaltenspsychologischer Sicht?
- Skizzieren sie kurz „Lernen am Modell\"!
- Weshalb ist Lernen am Modell pädagogisch relevant?
- Erläuterung der Begriffe „Proposition“, „Schema\",,,mentales Modell“ und „,Skript“ mit Beispielen.
- ,,Konkrete Bilder werden besser behalten als abstrakte“. Diskutieren Sie bitte diese Annahme: Durch welche Theorie wird diese Annahme gestützt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit den verschiedenen Theorien und Konzepten des Lernens und der Verhaltensänderung. Er behandelt sowohl klassische Konditionierung als auch operante Konditionierung und deren Relevanz für die Pädagogik. Darüber hinaus werden wichtige Lernformen wie "Lernen am Modell" und kognitive Prozesse wie die Bildung von Propositionen, Schemata und mentalen Modellen erläutert. Der Text beleuchtet auch die Bedeutung von Bildhaftigkeit für das Lernen und die Frage, wie wirksame Strafen beschaffen sein müssen.
- Klassische und Operante Konditionierung
- Lernprinzipien und deren Anwendung in der Pädagogik
- Lernen am Modell und seine Relevanz für den Bildungsprozess
- Kognitive Prozesse und Wissensrepräsentation
- Bedeutung von Bildhaftigkeit für das Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Der Text beginnt mit der Unterscheidung zwischen inzidentellem und intentionalem Lernen, wobei inzidentelles Lernen als unabsichtliches, beiläufiges Lernen hervorgehoben wird.
- Kapitel 2: Das Kapitel erklärt das klassische Konditionieren, das auf der Verbindung von Reizen und der daraus resultierenden Reizsubstitution basiert. Es erläutert die drei Phasen des klassischen Konditionierens: Kontrollphase, Konditionierungsphase und Löschungsphase.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel stellt die Sichtweise von Lernen als Verhaltensänderung (operante Konditionierung) vor und beschreibt die beiden Formen des operanten Konditionierens, die zum Aufbau eines Verhaltens führen (positive und negative Verstärkung), sowie die beiden Formen, die zum Abbau des Verhaltens führen (Bestrafung und Löschung).
- Kapitel 4: Das Kapitel präsentiert die vier operanten Lernprinzipien (positive Verstärkung, negative Verstärkung, Bestrafung und Löschung) und erläutert diese anhand von pädagogisch relevanten Beispielen.
- Kapitel 5: Das Kapitel erklärt das Konzept der "negativen Verstärkung" und gibt ein Beispiel, wie sie im pädagogischen Kontext eingesetzt werden kann.
- Kapitel 6: Anhand der Theorie des klassischen Konditionierens wird die Entstehung von Schulangst erläutert. Es werden die entsprechenden Fachbegriffe verwendet, um die Prozesse der Reizassoziation und der konditionierten Reaktion zu verdeutlichen.
- Kapitel 7: Dieses Kapitel behandelt die Frage, wie wirksame Strafen beschaffen sein müssen, um unerwünschtes Verhalten zu reduzieren. Es werden Faktoren wie Intensität, unmittelbare Anwendung und Vermeidung von verstärkenden Eigenschaften der Strafe diskutiert.
- Kapitel 8: Das Kapitel beleuchtet die Kritik an Strafen aus verhaltenspsychologischer Sicht und argumentiert, dass Strafen zwar effektiv sein können, aber auch unerwünschte Nebeneffekte haben können.
- Kapitel 9: Das Kapitel präsentiert verschiedene Alternativen zu Strafen aus verhaltenspsychologischer Sicht, wie z.B. Extinktion (Löschung), Auszeit und Folgekosten sowie differentielle Verstärkung.
- Kapitel 10: Das Kapitel skizziert die Theorie des "Lernens am Modell" nach Albert Bandura und beschreibt, wie Verhaltensänderungen durch Beobachtung und Nachahmung erfolgen können.
- Kapitel 11: Dieses Kapitel erläutert die pädagogische Relevanz des "Lernens am Modell" und zeigt, wie Personen mit Vorbildcharakter (z.B. Lehrer/Eltern) einen erheblichen Einfluss auf das Verhalten von Kindern haben können.
- Kapitel 12: Das Kapitel erklärt die Begriffe "Proposition", "Schema", "mentales Modell" und "Skript" und illustriert diese anhand von Beispielen. Es wird gezeigt, wie diese Konzepte die Repräsentation von Wissen und Handlungsabläufen im menschlichen Gedächtnis beschreiben.
- Kapitel 13: Das Kapitel diskutiert die Annahme, dass konkrete Bilder besser behalten werden als abstrakte. Es wird erläutert, wie die Theorie der dualen Kodierung nach Paivio diese Annahme stützt und den "Bildüberlegenheitseffekt" erklärt.
Schlüsselwörter
Klassische Konditionierung, Operante Konditionierung, Verstärkung, Bestrafung, Lernen am Modell, Proposition, Schema, Mentales Modell, Skript, Duale Kodierung, Bildüberlegenheitseffekt, Schulangst, Pädagogik, Verhaltensänderung.
- Quote paper
- Katharina Schmidt (Author), 2008, Psychologische Grundlagen des Lernens und Lehrens. Fragenkatalog mit Ausarbeitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344484