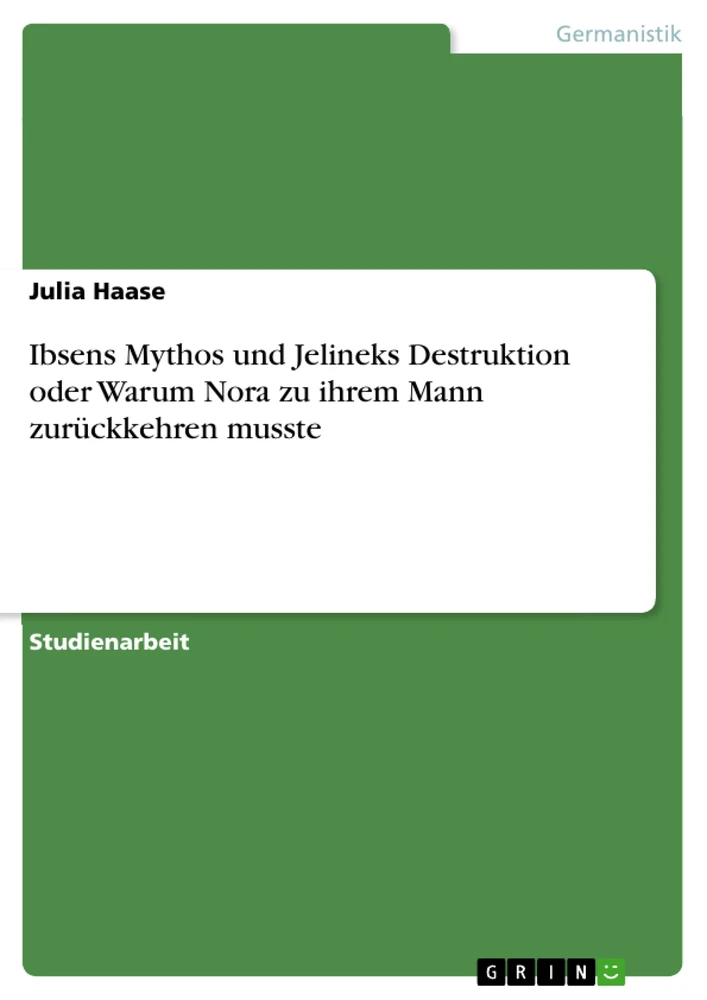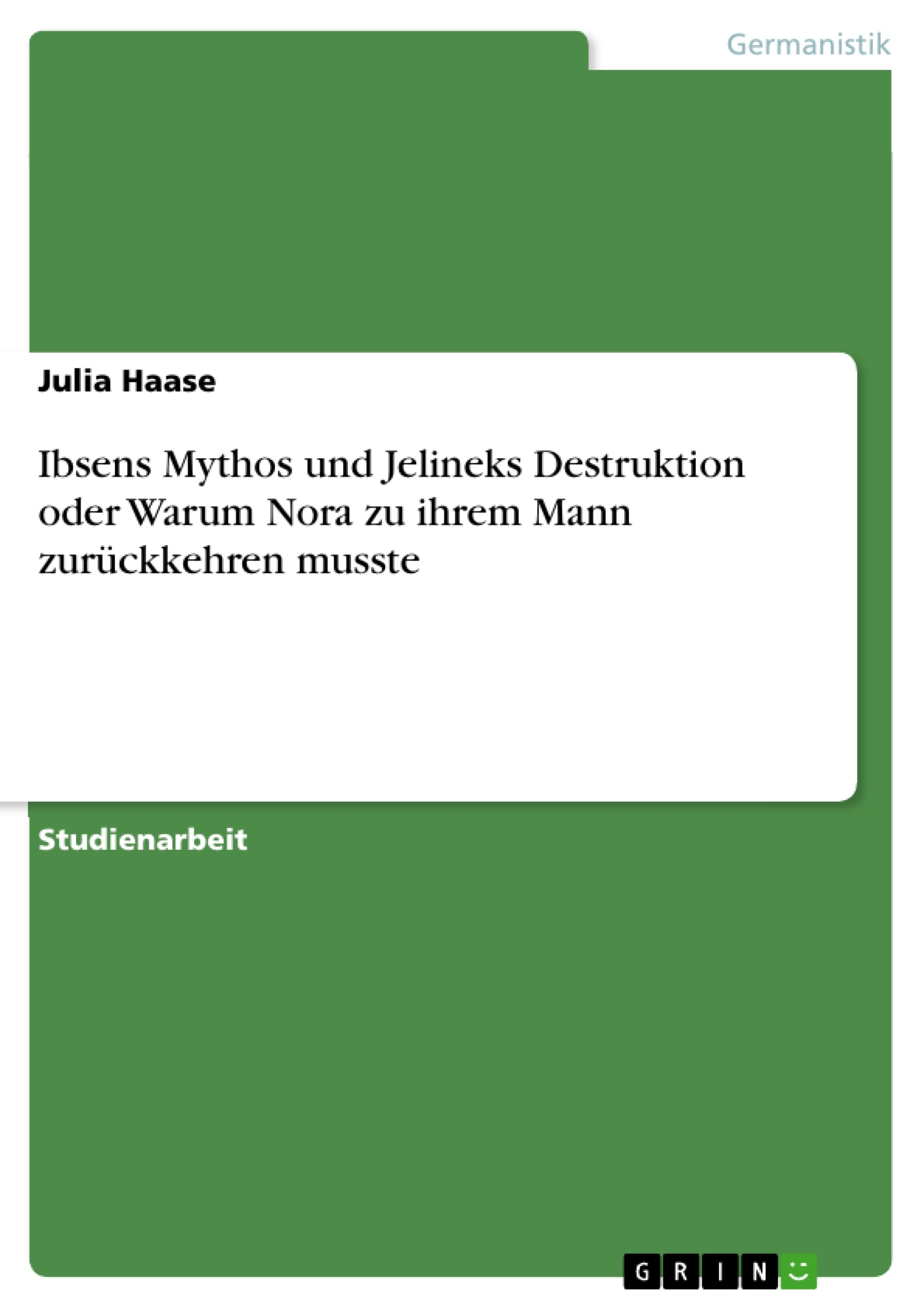Einhundert Jahre nachdem hinter Henrik Ibsens Nora beim Verlassen ihres Puppenheims die „Tür dröhnend ins Schloss“ fiel und dies von der zeitgenössischen Frauenbewegung enthusiastisch als Vorbild für die Befreiung der Frau aus ihrer Unterdrückung durch den Mann gefeiert wurde, fand 1979 die Uraufführung von Elfriede Jelineks erstem Theaterstück „Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften“ statt. Es ist als Fortsetzung des Originals „Nora (Ein Puppenheim)“ zu verstehen und legt die Vision von Noras Zukunft dar, indem es inhaltlich direkt am von Ibsen entworfenen offenen Ende ansetzt. Nora hat sich von ihrem Mann emanzipiert und will nun ihren Emanzipationsprozess auf gesellschaftlicher Ebene weiterführen, Ibsen sah diesem Vorhaben offenbar optimistisch entgegen. Jelinek hingegen zeichnet ein sehr pessimistisches Bild und widmet sich der Frage nach der generellen (Un-)Möglichkeit von weiblicher Emanzipation im Kontext von männlicher Hegemonie in den die Gesellschaft konstituierenden Bereichen der Politik, Ökonomie und geschlechtsspezifischen Rollenzuweisung.
Im Folgenden sollen die beiden Werke Ibsens und Jelineks zunächst separat betrachtet werden. Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit Ibsens Drama. Anfangs wird der historische Zusammenhang beleuchtet, in den sich Ibsens Nora-Stück einordnet. Anhand dessen sollen die Konzeption des Dramas erklärt und Gründe benannt werden, die den optimistischen Ausgang motivierten. Im Anschluss erfolgt eine detaillierte Interpretation der Handlung des Stücks, wobei das Augenmerk insbesondere auf die in der Literatur vieldiskutierte Wandlung Noras gerichtet wird und Argumente für die Wahrscheinlichkeit ihrer vermeintlich unrealistisch schnellen Veränderung benannt werden. Ferner wird die kritische Aussage des Stücks herausgearbeitet. Des Weiteren sollen einige Punkte in Bezug auf die Emanzipationsthematik und Ibsens Sicht auf das Geschlechterverhältnis erläutert werden. Der gesamte erste Teil ist überdies dazu angedacht, die von Ibsen geschaffenen Voraussetzungen der Nora-Figur und zum Thema der Emanzipation aufzuzeigen, an die Jelinek aus ihrer Perspektive mit ihrer Fortsetzung anknüpft. Ibsens Original als Bedingung für das Werk Jelineks wird eingehend betrachtet, um späterhin in der Fortführung wiederaufgenommene bzw. veränderte Motive genau analysieren und vergleichen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ibsens „Nora (Ein Puppenheim)“
- Familie und Emanzipation: Der historische Kontext des Nora-Stücks
- Das Nora-Stück Ibsens: Warum Nora ihren Mann verließ
- Wirkliche Emanzipation oder unrealistischer Optimismus?
- Jelineks Fortsetzung: „Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften“
- Voraussetzungen zum Textverständnis
- Die politische und gesellschaftskritische Position Jelineks
- Die ästhetische Position Jelineks
- Das Nora-Stück Jelineks: Warum Nora zu ihrem Mann zurückkehren musste
- Optimismus und Mythos, Pessimismus und Destruktion: Ein Vergleich der beiden Werke
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den beiden Theaterstücken „Nora (Ein Puppenheim)“ von Henrik Ibsen und „Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften“ von Elfriede Jelinek. Ziel ist es, die beiden Werke unter dem Schwerpunkt der Emanzipationsthematik zu betrachten und deren jeweilige Aussage in den Kontext der geschichtlichen Entwicklungen und der gesellschaftlichen Verhältnisse zu stellen.
- Der historische Kontext der Emanzipationsbewegung im späten 19. Jahrhundert
- Die Interpretation der Handlung und der Figuren in Ibsens „Nora (Ein Puppenheim)“
- Jelineks Kritik an der männlichen Hegemonie und die Destruktion von Emanzipationsmythen
- Der Vergleich der beiden Werke hinsichtlich ihrer Theaterästhetik und ihrer Aussage zur weiblichen Emanzipation
- Die Frage nach der (Un-)Möglichkeit von weiblicher Emanzipation im Kontext von männlicher Hegemonie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die beiden Nora-Stücke in den Kontext der Emanzipationsbewegung und skizziert die Argumentationslinie der Arbeit. Der erste Teil widmet sich Ibsens „Nora (Ein Puppenheim)“ und beleuchtet den historischen Kontext des Stücks. Anschließend erfolgt eine detaillierte Interpretation der Handlung und der Wandlung Noras, wobei die kritische Aussage des Stücks im Hinblick auf das Geschlechterverhältnis herausgearbeitet wird.
Der zweite Teil behandelt Jelineks „Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften“. Zunächst werden ihre politische und ästhetische Position erläutert, um im Anschluss die inhaltliche Interpretation des Stücks vorzunehmen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Prozess der Entmythologisierung von Emanzipation und der „Natur der Frau“.
Im letzten Teil werden die beiden Werke hinsichtlich ihrer Theaterästhetik, ihrer Aussage und des Problems der Emanzipation verglichen. Die Motivation Jelineks, eine Fortsetzung von Ibsens Drama zu schreiben, wird erläutert und die Frage nach den Gründen für die Umkehrung von Ibsens Optimismus in absoluten Pessimismus wird aufgeworfen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Emanzipation, Gender, Patriarchat, Geschlechterverhältnis, Theaterästhetik, Henrik Ibsen, Elfriede Jelinek, „Nora (Ein Puppenheim)“, „Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften“, Mythos, Destruktion, Optimismus, Pessimismus.
- Quote paper
- Julia Haase (Author), 2003, Ibsens Mythos und Jelineks Destruktion oder Warum Nora zu ihrem Mann zurückkehren musste, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34446