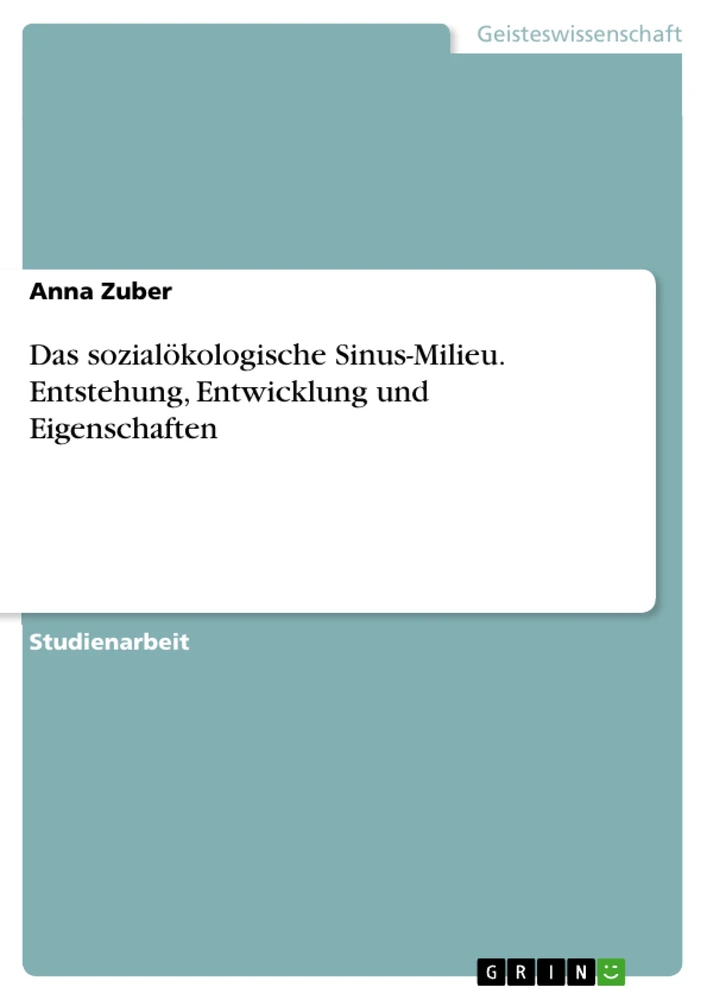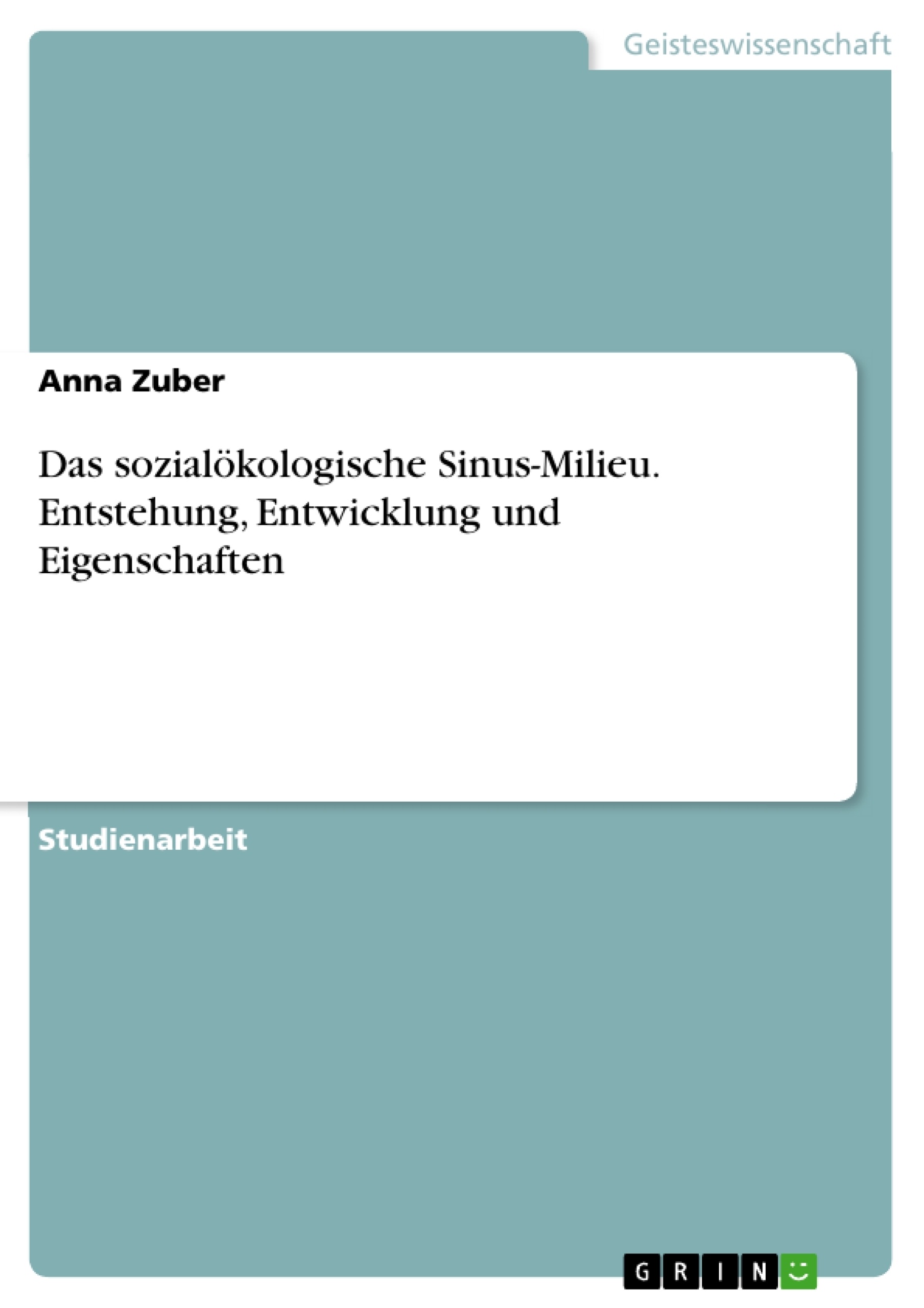Sie kaufen überdurchschnittlich oft Biolebensmittel, beziehen Ökostrom und leben naturverbunden. Durch einen nachhaltigen Lebensstil wollen sie die Umwelt, das Klima und ihre Gesundheit schützen. Für die dem „sozialökologischen Milieu“ zugeordneten Menschen spielt der Umweltgedanke im Alltag eine große Rolle.
Seit der Aktualisierung seines Modells im Jahr 2010 unterteilt Sinus Sociovision (das Sinus-Institut in Heidelberg) die deutsche Bevölkerung in zehn Milieus , darunter das Sozialökologische, welches 7,2% der deutschen Bevölkerung ausmacht. Während einige Milieunamen wie „Hedonisten“ oder „Bürgerliche Mitte“ bereits im Vorgängermodell vorkamen, war die Bezeichnung „Sozialökologische“ noch nie Teil der Sinus-Typologie.
Betrachtet man das Modell von 2009, so fällt auf, dass kein ökologisches Leitmilieu existierte, dessen Name auf eine umweltfreundliche Ausrichtung des Lebensinhalts schließen ließe. Dies lädt den Betrachter ein anzunehmen, ein gänzlich umweltbewusster Lebensstil sei ein neues Phänomen. Gab es vor 2010 nicht genug konsumkritische, naturnahe Bürger, deren Alltag vom Umweltbewusstsein geprägt war, um sie in einem Milieu zu gruppieren? Welche demographischen und soziokulturellen Eigenschaften sind typisch für das sozialökologische Milieu?
Die vorliegende Arbeit soll Antwort auf diese Fragen geben, indem sie die Entstehung und Entwicklung der Lebenswelten beschreibt, in denen Umweltbewusstsein und –verhalten eine zentrale Rolle spielten und spielen. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts kritisierte die jugendliche Bürgerbewegung die Verstädterung, die Naturvernichtung und die Konsummentalität, wodurch zahlreiche Heimat- und Naturschutzorganisationen gegründet wurden. Der Fokus dieser Arbeit liegt allerdings auf der Entwicklung ab 1970. Zum einen entstand die Umweltbewegung zu Anfang jenes Jahrzehnts, und zum anderen veröffentlichte das Sinus-Institut Ende der 70er Jahre das erste Milieumodell für Westdeutschland. Die Geschichte der Umweltbewegung und die Verbreitung des Ökologiegedankens werden also mit der Veränderung der Sinus-Milieumodelle in Verbindung gebracht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konzept der Sinus-Milieus
- Die Entwicklung der ökologisch affinen Milieus vor dem Hintergrund der Umweltbewegung
- 1970 bis 1983
- 1983 bis 1995
- 1997 in Ostdeutschland
- 1995 bis 2009
- Das Sozialökologische Milieu im Sinus-Modell von 2010
- Mögliche Gründe für die Entstehung des Sozialökologischen Milieus zwischen 2001 und 2010
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung des sozialökologischen Milieus im Sinus-Modell. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen der Umweltbewegung und der Veränderung der Milieustrukturen in der deutschen Bevölkerung, insbesondere die Frage, warum dieses Milieu erst seit 2010 explizit im Sinus-Modell erscheint. Die Arbeit stützt sich auf Sekundärliteratur und bezieht Daten des Sinus-Instituts und des Umweltbundesamtes ein.
- Entstehung und Entwicklung des sozialökologischen Milieus im Sinus-Modell.
- Beziehung zwischen Umweltbewegung und der Veränderung der Milieustrukturen.
- Analyse der soziodemographischen und soziokulturellen Eigenschaften des sozialökologischen Milieus.
- Diskussion möglicher Gründe für das späte Auftreten eines expliziten „sozialökologischen“ Milieus im Sinus-Modell.
- Anwendung des Sinus-Milieu-Konzepts zur Analyse von Konsumverhalten und Lebensstilen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des sozialökologischen Milieus im Sinus-Modell ein und stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für dessen erstmalige explizite Darstellung im Jahr 2010. Sie skizziert den Forschungsansatz, der die Verbindung zwischen Umweltbewegung und der Entwicklung der Milieustrukturen untersucht, und benennt die verwendeten Quellen. Die Autorin erläutert ihr persönliches Interesse an der Thematik, begründet durch eigenes Engagement im Umweltschutz und die Auseinandersetzung mit dem Milieukonzept im Rahmen eines Soziologieseminars.
Das Konzept der Sinus-Milieus: Dieses Kapitel beschreibt das Milieukonzept des Sinus-Instituts, seine Methodik und Anwendung in der Markt- und Politikforschung. Es erläutert die Erhebungsmethoden (qualitative und quantitative Interviews), die verwendeten Indikatoren (40 Statements zur Ermittlung von Werteprofilen), und die Darstellung der Milieus in der „Kartoffelgrafik“, die die soziale Lage und die Werteorientierung der Milieus visualisiert. Das Kapitel betont die fließenden Übergänge zwischen den Milieus und die Möglichkeit, dass eine Person mehreren Milieus angehören kann. Der Zusammenhang zwischen Schichtzugehörigkeit und Milieuzugehörigkeit wird ebenfalls diskutiert.
Die Entwicklung der ökologisch affinen Milieus vor dem Hintergrund der Umweltbewegung: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung ökologisch orientierter Lebensstile und deren Reflexion im Sinus-Modell im zeitlichen Verlauf. Es setzt die Entwicklung der Sinus-Milieus in den Kontext der Umweltbewegung und untersucht, wie sich das Umweltbewusstsein in den verschiedenen Phasen der Modellentwicklung widerspiegelt. Der Fokus liegt auf der Frage, warum ein explizit ökologisches Milieu erst spät im Modell auftaucht, obwohl umweltbewusstes Handeln bereits früher existierte. Der Abschnitt behandelt die Umweltbewegung ab 1970 und ihren Einfluss auf die Entwicklung von Werten und Lebensstilen.
Das Sozialökologische Milieu im Sinus-Modell von 2010: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Charakteristika des sozialökologischen Milieus im Sinus-Modell von 2010. Es beschreibt die typischen Eigenschaften der diesem Milieu zugehörigen Personen, ihre Werte, Lebensstile und Konsumgewohnheiten. Der Anteil der Bevölkerung, der diesem Milieu zugeordnet wird, wird ebenfalls genannt und diskutiert. Der Abschnitt vergleicht das sozialökologische Milieu möglicherweise mit anderen, ähnlichen Milieus im Sinus-Modell und analysiert seine Position innerhalb der gesamten Milieustruktur.
Mögliche Gründe für die Entstehung des Sozialökologischen Milieus zwischen 2001 und 2010: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der Faktoren, die zur Entstehung und zum expliziten Auftreten des sozialökologischen Milieus im Sinus-Modell geführt haben. Es untersucht gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in diesem Zeitraum, die möglicherweise zu einer verstärkten Sichtbarkeit und Bedeutung von ökologischen Werten und Lebensstilen beigetragen haben. Es werden möglicherweise demographische Veränderungen und der Einfluss der Medien auf die Wahrnehmung ökologischer Themen diskutiert.
Schlüsselwörter
Sinus-Milieus, Sozialökologisches Milieu, Umweltbewegung, Ökologie, Konsumverhalten, Lebensstil, Wertewandel, Sozialstruktur, Marktforschung, Politikforschung, Demographie, Soziokultur.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Entstehung und Entwicklung des sozialökologischen Milieus im Sinus-Modell
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung des sozialökologischen Milieus im Sinus-Modell. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen der Umweltbewegung und der Veränderung der Milieustrukturen in der deutschen Bevölkerung und fragt insbesondere nach den Gründen für das erstmalige explizite Auftreten dieses Milieus im Sinus-Modell im Jahr 2010.
Welche Methode wird verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Sekundärliteratur und bezieht Daten des Sinus-Instituts und des Umweltbundesamtes ein. Sie analysiert die Entwicklung ökologisch orientierter Lebensstile im Kontext der Umweltbewegung und untersucht, wie sich das Umweltbewusstsein in den verschiedenen Phasen der Modellentwicklung des Sinus-Instituts widerspiegelt.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Das Konzept der Sinus-Milieus, Die Entwicklung der ökologisch affinen Milieus vor dem Hintergrund der Umweltbewegung (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Zeitabschnitten), Das Sozialökologische Milieu im Sinus-Modell von 2010, Mögliche Gründe für die Entstehung des Sozialökologischen Milieus zwischen 2001 und 2010, und Schluss.
Was wird im Kapitel "Das Konzept der Sinus-Milieus" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt das Milieukonzept des Sinus-Instituts, seine Methodik und Anwendung. Es erläutert die Erhebungsmethoden (qualitative und quantitative Interviews), die verwendeten Indikatoren und die Visualisierung der Milieus in der „Kartoffelgrafik“. Der Zusammenhang zwischen Schichtzugehörigkeit und Milieuzugehörigkeit wird ebenfalls diskutiert.
Was wird im Kapitel "Die Entwicklung der ökologisch affinen Milieus..." behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung ökologisch orientierter Lebensstile im Sinus-Modell im zeitlichen Verlauf, beginnend ab 1970. Es untersucht den Einfluss der Umweltbewegung auf die Entwicklung von Werten und Lebensstilen und fragt nach den Gründen für das späte Auftreten eines explizit ökologischen Milieus im Modell.
Was sind die zentralen Charakteristika des sozialökologischen Milieus im Sinus-Modell von 2010?
Das Kapitel "Das Sozialökologische Milieu im Sinus-Modell von 2010" beschreibt die typischen Eigenschaften der diesem Milieu zugehörigen Personen, ihre Werte, Lebensstile und Konsumgewohnheiten. Der Bevölkerungsanteil dieses Milieus wird ebenfalls diskutiert und ein Vergleich mit ähnlichen Milieus vorgenommen.
Welche möglichen Gründe für die Entstehung des sozialökologischen Milieus werden untersucht?
Das Kapitel "Mögliche Gründe für die Entstehung des Sozialökologischen Milieus..." analysiert gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Entwicklungen zwischen 2001 und 2010, die möglicherweise zu einer verstärkten Sichtbarkeit und Bedeutung ökologischer Werte und Lebensstilen beigetragen haben. Demographische Veränderungen und der Einfluss der Medien werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sinus-Milieus, Sozialökologisches Milieu, Umweltbewegung, Ökologie, Konsumverhalten, Lebensstil, Wertewandel, Sozialstruktur, Marktforschung, Politikforschung, Demographie, Soziokultur.
- Arbeit zitieren
- Anna Zuber (Autor:in), 2011, Das sozialökologische Sinus-Milieu. Entstehung, Entwicklung und Eigenschaften, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344437