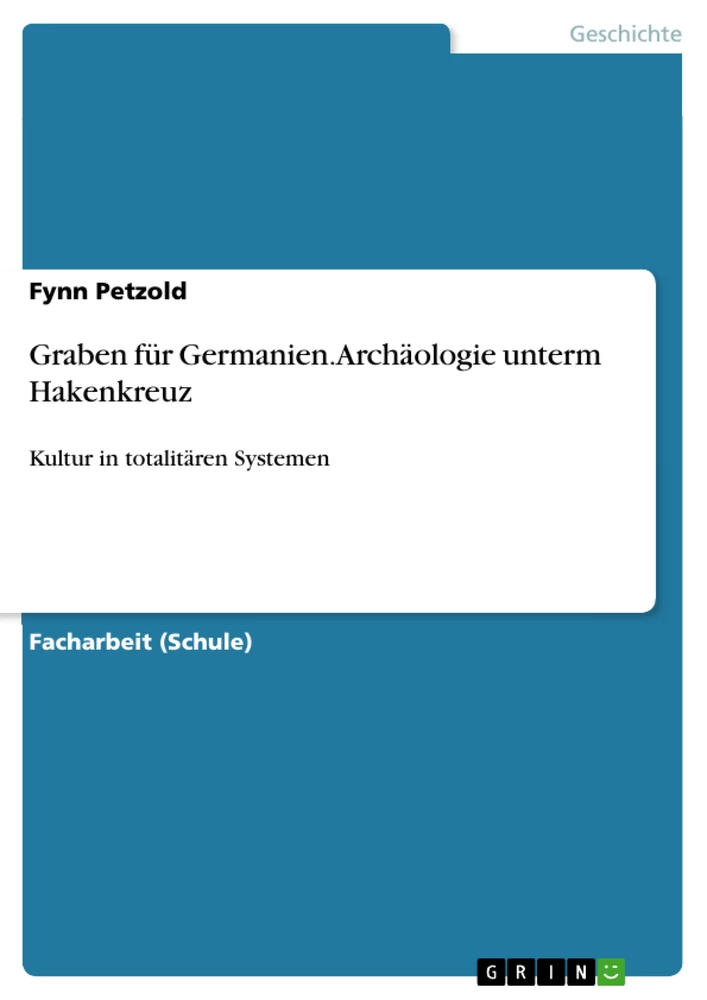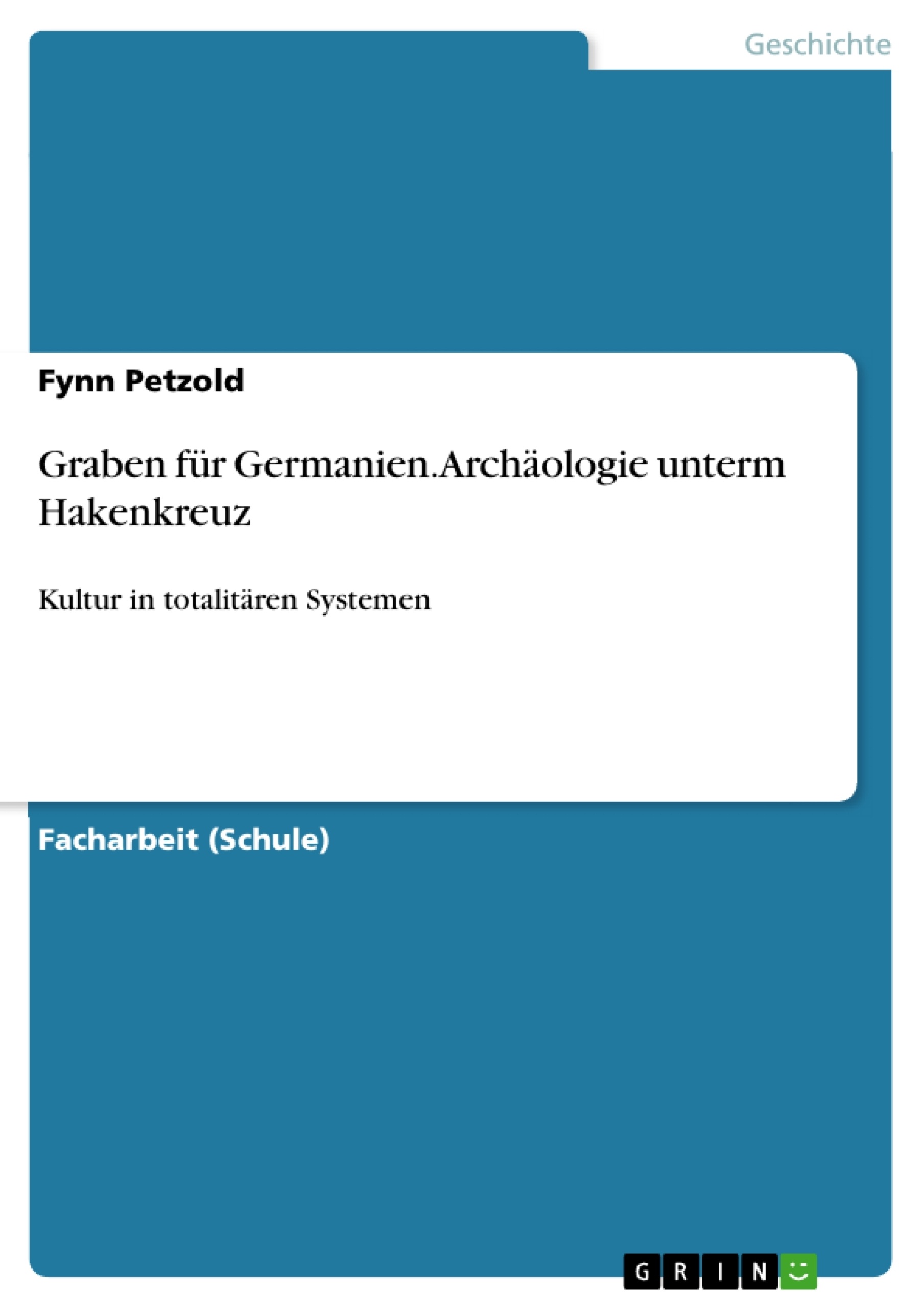„Graben für Germanien“ – damit ist die Rolle der „Archäologie unterm Hakenkreuz“ in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945) ziemlich treffend beschrieben.
In dieser Facharbeit untersuche ich die politische Instrumentalisierung der Archäologie im „Dritten Reich“. Besonders befasse ich mich mit dem „Mythos Germanien“. Der im 19. Jahrhundert aufkommende Nationalismus und später der Rassismus, waren auf der Suche nach einer gemeinsamen Wurzel. Man erfand das Konstrukt einer geschichtlichen Abstammung der Deutschen von den Germanen und einer durch die Ahnen legitimierte Überlegenheit der „nordischen Rasse“ gegenüber allen anderen Rassen. Nationalsozialisten konnten auf dem im 19. Jahrhundert bereits im Entstehen gewesenen „Mythos Germanien“ aufbauen und ihn mit Propagandamaßnahmen in den Köpfen der Menschen verfestigen.
Renommierte Wissenschaftler sind jedoch der Meinung, dass die Germanen ein geschichtliches Gebilde sind, an dem Archäologen, NS-Wissenschaftler, aber auch Laien- und Heimatforscher mitgearbeitet haben. „Die Germanen als ein einheitliches Volk hat es nie gegeben.“ Zu dieser Erkenntnis gelangten die Autoren Jo Siegler und Frank Endres, die im Bereich der Germanenforschung tätig sind.
In dieser Facharbeit wird die Rolle des "Germanen-Mythos" und der Archäologie in der Zeit des Nationalsozialismus untersucht und bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Thematik
- Leitfragen
- Herangehensweise
- Motive der Zusammenarbeit zwischen Archäologen und Ideologen
- Situation der Archäologie vor 1933
- Absichten der Archäologen
- Interessen der Nationalsozialisten ab 1933
- Gustaf Kossinna - ein Wegbereiter der NS-Archäologie
- Kossinna als Wegbereiter
- Kritik an Kossinnas Methoden
- Die Archäologie ab 1933
- Aus Archäologie wird NS-Archäologie
- Die NS-Archäologie blüht und floriert
- Rivalitäten unter den NS-Forschungsorganisationen
- Das „Ahnenerbe“ der SS
- Der „,Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte“
- Heinrich Himmler gegen Alfred Rosenberg
- Ausgrabungen im Nationalsozialismus
- Allgemein
- Moorleichen als Legitimation für die Verfolgung Homosexueller
- Hunte 1 - ein Beispiel aus der Region
- Germanien – Propagierung einer Idee
- Germanien im NS-Alltag
- Die Wirtschaft nutzt den Mythos - ein Beispiel
- Fortgang nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
- Zustände nach 1945
- Umgang mit der Schuld
- Herbert Jankuhn – die Karriere geht weiter
- Der Mythos lebt weiter
- Gründe für das Fortbestehen
- Germanenbilder in der Alltagskultur
- Abschließende Betrachtung
- Persönliche Reflexion
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Facharbeit befasst sich mit der politischen Instrumentalisierung der Archäologie im „Dritten Reich“ und analysiert die Rolle der „Archäologie unterm Hakenkreuz“ in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945).
- Die Instrumentalisierung der Archäologie zur Konstruktion des „Mythos Germanien“
- Die Rolle von Archäologen und Ideologen bei der Propagierung des „Mythos Germanien“
- Die Organisation und Rivalitäten der NS-Forschungsorganisationen
- Die Auswirkungen der NS-Archäologie auf Ausgrabungen und Interpretationen
- Das Fortleben des „Mythos Germanien“ bis in die Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der „Archäologie unterm Hakenkreuz“ ein und stellt die Leitfragen sowie die Herangehensweise der Facharbeit dar. Kapitel 2 beleuchtet die Motive der Zusammenarbeit zwischen Archäologen und Nationalsozialisten, indem es die Situation der Archäologie vor 1933, die Absichten der Archäologen und die Interessen der Nationalsozialisten ab 1933 untersucht. Kapitel 3 präsentiert Gustaf Kossinna als einen Wegbereiter der NS-Archäologie und kritisiert seine Methoden. Kapitel 4 beschreibt die Entwicklung der Archäologie ab 1933 und die Entstehung der NS-Archäologie. Kapitel 5 thematisiert die Rivalitäten zwischen den NS-Forschungsorganisationen, insbesondere zwischen dem „Ahnenerbe“ der SS und dem „,Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte“.
Kapitel 6 beleuchtet die Ausgrabungen im Nationalsozialismus, darunter die Nutzung von Moorleichen zur Legitimation der Verfolgung Homosexueller und das Beispiel der Ausgrabung Hunte 1 in Nordwestdeutschland. Kapitel 7 analysiert die Propagierung des „Mythos Germanien“ im NS-Alltag und die Nutzung des Mythos durch die Wirtschaft. Kapitel 8 beschäftigt sich mit den Zuständen nach 1945, dem Umgang mit der Schuld und der Fortsetzung der Karriere des ehemaligen SS-Archäologen Herbert Jankuhn. Kapitel 9 untersucht die Gründe für das Fortleben des „Mythos Germanien“ und seine Präsenz in der Alltagskultur.
Schlüsselwörter
Die Facharbeit befasst sich mit den Themen „Archäologie unterm Hakenkreuz“, „NS-Archäologie“, „Mythos Germanien“, „Ideologie“, „Propaganda“, „Ausgrabungen“, „Moorleichen“, „Germanen“, „nationalsozialistische Ideologie“, „wissenschaftliche Instrumentalisierung“, „Herbert Jankuhn“, „Gustaf Kossinna“, „Ahnenerbe“, „Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte“, „Nachkriegszeit“, „Fortleben des Mythos“.
- Quote paper
- Fynn Petzold (Author), 2015, Graben für Germanien. Archäologie unterm Hakenkreuz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343509