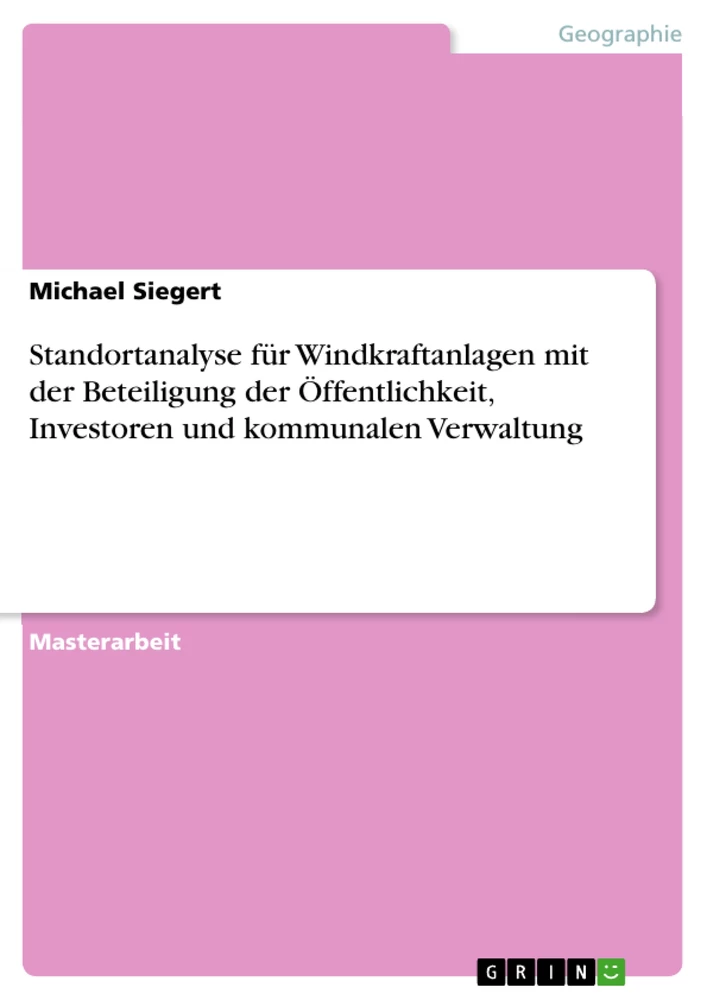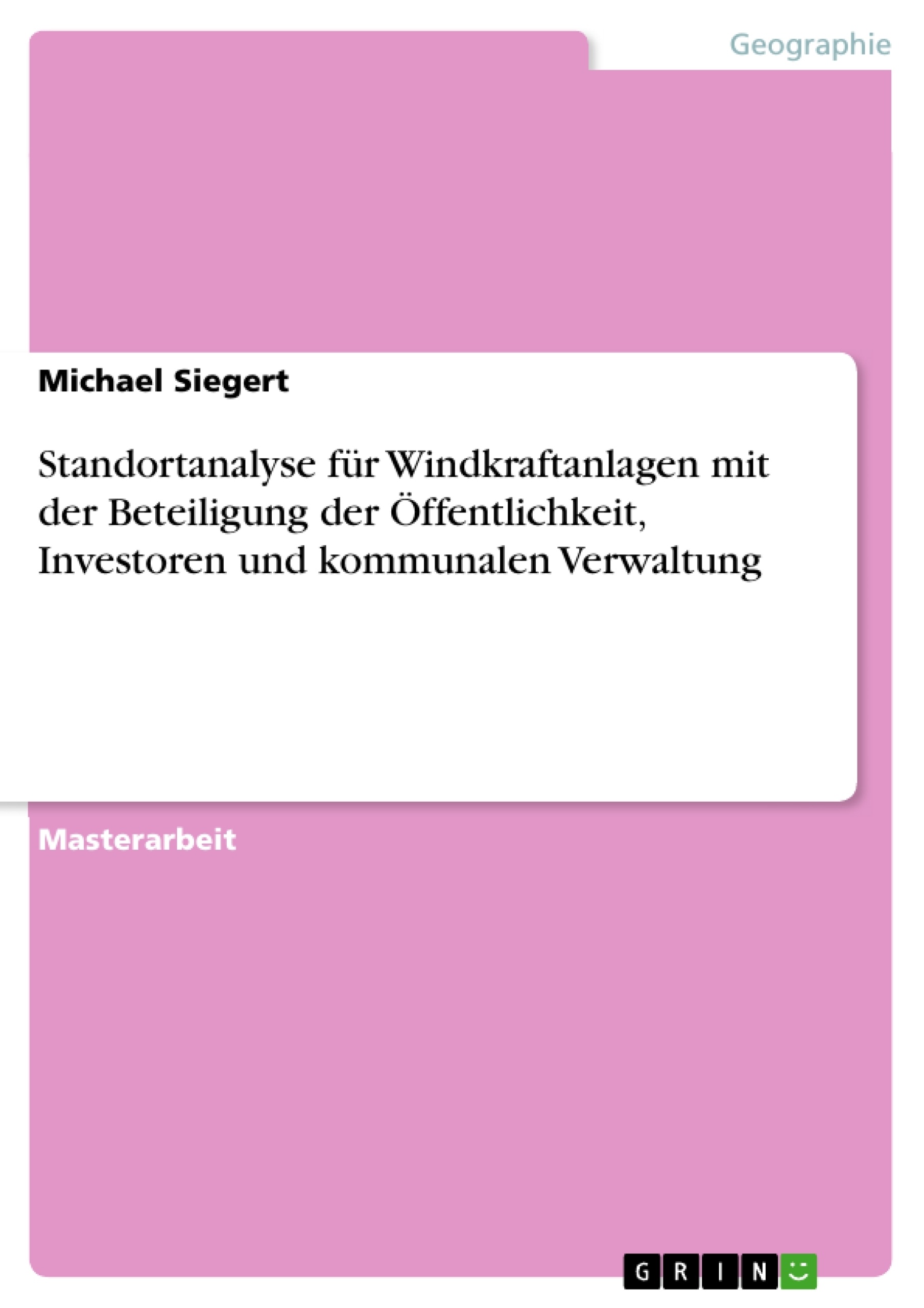GIS-gestützte Standortanalysen für Windkraftanlagen unter Berücksichtigung der relevanten Stakeholder
Die Energiewende genießt im Allgemeinen eine breite gesellschaftliche und politische Akzeptanz. Geht es jedoch darum, geeignete Standorte für Windkraftanlagen (WKA) zu finden, zeigt sich auch sehr schnell das damit verbundene Konfliktpotential. Eine grundlegende Ursache dieses Konfliktpotentials liegt in der räumlich dezentralen Verteilung der Windenergieerzeugung und deren negativen externen Effekte, die durch ihre Größe und Rotorbewegung begründet sind. Die raumbezogenen Probleme sind dabei überwiegend in den Bereichen Naturschutz, Landschaftsbildschutz und Immissionsschutz gelagert. Aufgrund der daraus resultierenden Konfliktpotentiale muss der Ausbau der Windenergie raumplanerisch gesteuert werden. Zusammengefasst stellt die Suche nach optimalen Standorten für Windkraftanlagen eine vielschichtige Herausforderung dar, die auf der Basis von GIS-gestützten Analyseverfahren zeitnah, problemnah und objektiv unterstützt werden kann. Grundlegendes Ziel der verschiedenen Analysemethoden ist es, mit einem stufenweisen Analyseverfahren die Ausschlusskriterien so zu konkretisieren und zu verdichten, das final Eignungsflächen für WKA ermittelt werden, die ein möglichst niedriges Risiko an Raumnutzungskonflikten zur Folge haben. In diesem Sinne wurde im Rahmen der Masterarbeit das Untersuchungsgebiet des Landkreises Dahme-Spreewald durch mehrstufige geometrische Operationen in Ausschlussflächen (Tabuzonen) und Potentialflächen eingeteilt. Hierfür wurden im Vorfeld die notwendigen Geodaten (z.B. Landnutzung, Schutzgebiete) in ein GIS implementiert und die Ausschlussflächen definiert, die sich aus den verschiedenen Regelwerken der Raumordnung und Rechtsprechungen ergeben. Die meisten dieser Flächen stellen Harte Tabuzonen dar. Die Weichen Tabuzonen wurden über das Puffern der Harten Tabuzonen mit den jeweiligen Mindestabstandsregeln für WKA-Bebauungen ermittelt. In einem weiteren Schritt wurden sämtliche Ausschlussflächen mit dem Vereinigen-Tool zusammengefasst. Über die Radierfunktion konnten unter Abzug der Ausschlussflächen vom Untersuchungsgebiet die Potentialflächen ermittelt werden, die sich weiterhin in Eignungsflächen und Restriktionsflächen unterteilen ließen.
Weiterhin können über GIS-basierte Standortanalysen Konflikte im Vorfeld reduziert werden, die im Zusammenhang mit einer negativen optischen Landschaftsbildbeeinträchtigung stehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Hintergründe und Problemstellung
- 1.2 Zielstellungen
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Definitionen und Erläuterungen
- 2.1 Geodaten, Geoinformationssysteme und Standortanalysen
- 2.2 Aufbau und Funktionsweise einer Windkraftanlage
- 3 Raumplanerische Rahmenbedingungen für den Ausbau der Windenergie
- 3.1 Das Raumordnungsgesetz (ROG)
- 3.2 Die regionalplanerische Steuerung der Windkraftnutzung
- 3.3 Bedeutung des Raumordnungsverfahrens für den Ausbau der Windenergie
- 4 Stakeholder-spezifische Anforderungen an WKA-Standortanalysen
- 4.1 Kommunale Verwaltung
- 4.2 Potentielle Investoren
- 4.3 Öffentlichkeit
- 5 Methoden und Algorithmen GIS-gestützter WKA-Standortanalysen
- 5.1 GIS-basierte WKA-Flächenpotentialanalysen
- 5.2 Anzahl der installierbaren WKA & Ausschluss nach Mindestflächengröße
- 5.3 GIS-gestützte Analysen zur Landschaftsbildbeeinträchtigung durch WKA
- 5.3.1 3D Visualisierung
- 5.3.2 Sichtbarkeitsanalysen
- 6 Fallbeispiel Dahme-Spreewald - Flächenpotentialanalyse für WKA
- 6.1 Darstellung der Grundlagen für das Fallbeispiel
- 6.1.1 Abgrenzung und Beschreibung des Untersuchungsgebietes
- 6.1.2 Grundlagen zur verwendeten Software
- 6.1.3 Geodätisches Bezugssystem der Geodaten
- 6.1.4 Datengrundlagen
- 6.2 Grundannahmen
- 6.2.1 Beschreibung der Referenz-Windkraftanlage
- 6.2.2 Windhöffigkeit
- 6.2.3 Kriterienkatalog für Tabuzonen und Restriktionsflächen
- 6.2.4 Kriterium der Hangneigung
- 6.2.5 Kriterien der Mindestflächengröße und der Anordnung der WKA
- 6.3 Ablauf der GIS-basierte Flächenpotentialanalyse für WKA
- 6.3.1 Ermittlung der Ausschlussflächen nach Windhöffigkeit
- 6.3.2 Ermittlung der Tabuzonen
- 6.3.3 Ermittlung der Eignungs- und Restriktionsflächen
- 6.3.4 Ausschluss nach dem Kriterium Hangneigung
- 6.3.5 Ermittlung der optimalen WKA-Verteilung
- 6.3.6 Quantifizierung des Flächenpotentials und der potentiell installierbaren WKA
- 7 Fallbeispiel Bergholz-Rehbrücke - Analyse der Landschaftsbildbeeinflussung
- 7.1 Datengrundlage des Fallbeispiels
- 7.2 3D-Modellierung von geplanten Windkraftprojekten
- 7.3 Sichtbarkeitsanalysen für geplante Windkraftprojekte
- 8 Fallbeispiel Märkische Heide - Ermittlung ökonomischer & ökologischer Kennzahlen
- 8.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes – die Gemeinde Märkische Heide
- 8.2 Ergänzende Erläuterungen
- 8.3 Berechnung der ökonomischen und ökologischen Kennzahlen
- 8.3.1 Berechnung der Windleistungspotentiale pro WKA und Fläche
- 8.3.2 Berechnung des Stromertragspotentials pro Fläche
- 8.3.3 Berechnung der potentiellen Jahresauslastung der WKA am Standort
- 8.3.4 Berechnung des Anteils des Stromertragspotentials am Stromjahresverbrauch
- 8.3.5 Berechnung der CO2 Vermeidung
- 9 Ergebnisse der WKA-Standortanalysen für das Fallbeispiel Märkische Heide
- 9.1 Potentielles WKA-Entwicklungsgebiet 19
- 9.1.1 Lagebeschreibung, Landnutzung und Restriktionskriterien
- 9.1.2 Standortbezogenes Ressourcenangebot und Ertragspotentiale
- 9.1.3 Gemeindebezogene Kennzahlen
- 9.2 Potentielles WKA-Entwicklungsgebiet 20
- 9.2.1 Lagebeschreibung, Landnutzung und Restriktionskriterien
- 9.2.2 Standortbezogenes Ressourcenangebot und Ertragspotentiale
- 9.2.3 Gemeindebezogene Kennzahlen
- 9.3 Potentielles WKA-Entwicklungsgebiet 21
- 9.3.1 Lagebeschreibung, Landnutzung und Restriktionskriterien
- 9.3.2 Standortbezogenes Ressourcenangebot und Ertragspotentiale
- 9.3.3 Gemeindebezogene Kennzahlen
- 9.4 Potentielles WKA-Entwicklungsgebiet 23
- 9.4.1 Lagebeschreibung, Landnutzung und Restriktionskriterien
- 9.4.2 Standortbezogenes Ressourcenangebot und Ertragspotentiale
- 9.4.3 Gemeindebezogene Kennzahlen
- 9.5 Potentielles WKA-Entwicklungsgebiet 24
- 9.5.1 Lagebeschreibung, Landnutzung und Restriktionskriterien
- 9.5.2 Standortbezogenes Ressourcenangebot und Ertragspotentiale
- 9.5.3 Gemeindebezogene Kennzahlen
- 10 Webbasierte Darstellung der Standortanalyse für das Fallbeispiel Märkische Heide
- 10.1 Bedeutung des Internets für Investoren, Öffentlichkeit und kommunale Verwaltung
- 10.2 Aufbau der Website
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendung GIS-basierter Verfahren zur optimalen Standortauswahl von Windkraftanlagen (WKA). Besonderer Fokus liegt auf der Einbindung von Öffentlichkeit, Investoren und kommunaler Verwaltung. Die Arbeit zielt darauf ab, geeignete Analyseverfahren zu erläutern, praktisch anzuwenden und die Ergebnisse für verschiedene Stakeholdergruppen ansprechend zu visualisieren, beispielsweise über eine Internetplattform.
- GIS-basierte Standortanalysemethoden für Windkraftanlagen
- Stakeholder-spezifische Anforderungen an Standortanalysen
- Raumplanerische Rahmenbedingungen für den Ausbau der Windenergie
- Ökonomische und ökologische Bewertung von WKA-Standorten
- Webbasierte Visualisierung und Kommunikation der Analyseergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Hintergrund der Arbeit, ausgehend von den Klimaschutzzielen der EU und Deutschlands. Sie erläutert die Herausforderungen beim Ausbau der Windenergie, insbesondere die Konflikte bei der Standortauswahl, und begründet die Notwendigkeit GIS-basierter Analysen unter Einbezug verschiedener Stakeholder.
2 Definitionen und Erläuterungen: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Geoinformationssysteme (GIS), Geodaten, und Standortanalysen. Es erklärt den Aufbau und die Funktionsweise von Windkraftanlagen, insbesondere Anlagen mit horizontaler Drehachse, und erläutert wichtige Parameter wie Nabenhöhe und Rotordurchmesser.
3 Raumplanerische Rahmenbedingungen für den Ausbau der Windenergie: Dieses Kapitel beschreibt die rechtlichen und planerischen Rahmenbedingungen für den Ausbau der Windenergie in Deutschland, mit Fokus auf das Raumordnungsgesetz (ROG) und die regionalplanerische Steuerung. Es erläutert die Kategorien Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete und die Bedeutung des Raumordnungsverfahrens.
4 Stakeholder-spezifische Anforderungen an WKA-Standortanalysen: Hier werden die spezifischen Anforderungen der drei Haupt-Stakeholdergruppen – kommunale Verwaltung, potentielle Investoren und Öffentlichkeit – an WKA-Standortanalysen dargestellt. Es werden die Informationsbedürfnisse und Interessen jeder Gruppe im Detail beschrieben.
5 Methoden und Algorithmen GIS-gestützter WKA-Standortanalysen: Dieses Kapitel erläutert die Methoden und Algorithmen, die für GIS-gestützte WKA-Standortanalysen verwendet werden, insbesondere im Kontext der Software ArcGIS. Es beschreibt verschiedene Ansätze, von rasterbasierten Multi-Criteria Analysen bis hin zu vektorbasierten Methoden und Algorithmen wie „Ausschneiden“, „Puffer“, „Vereinigen“ und „Radieren“.
6 Fallbeispiel Dahme-Spreewald - Flächenpotentialanalyse für WKA: Dieses Kapitel beschreibt die praktische Anwendung der in Kapitel 5 erläuterten Methoden am Beispiel des Landkreises Dahme-Spreewald. Es detailliert die Datengrundlagen, die verwendeten Algorithmen und den Ablauf der Flächenpotentialanalyse, inklusive der Ermittlung von Tabuzonen, Restriktionsflächen und Eignungsflächen.
7 Fallbeispiel Bergholz-Rehbrücke - Analyse der Landschaftsbildbeeinflussung: Dieses Kapitel zeigt die Anwendung von 3D-Visualisierung und Sichtbarkeitsanalysen zur Bewertung der Landschaftsbildbeeinträchtigung durch WKA anhand eines kleineren Testgebietes. Es beschreibt die benötigten 3D-Geodaten und die Durchführung der Analysen in ArcScene.
8 Fallbeispiel Märkische Heide - Ermittlung ökonomischer & ökologischer Kennzahlen: Dieses Kapitel präsentiert die ökonomische und ökologische Bewertung von potentiellen WKA-Standorten in der Gemeinde Märkische Heide. Es beschreibt die Berechnungsmethoden für Kennzahlen wie Windleistungspotential, Stromertragspotential, Volllaststunden, Anteil am Stromverbrauch und CO2-Vermeidung.
9 Ergebnisse der WKA-Standortanalysen für das Fallbeispiel Märkische Heide: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Standortanalysen für verschiedene potentielle WKA-Entwicklungsgebiete in Märkische Heide, untergliedert nach Lagebeschreibung, Ressourcenangebot, Ertragspotentialen und Gemeindebezogenen Kennzahlen.
10 Webbasierte Darstellung der Standortanalyse für das Fallbeispiel Märkische Heide: Dieses Kapitel beschreibt die Bedeutung des Internets für die Kommunikation und Beteiligung von Stakeholdern bei Windkraftprojekten und den Aufbau einer webbasierten Plattform zur Visualisierung und Kommunikation der Analyseergebnisse.
Schlüsselwörter
Windkraftanlagen, Standortanalyse, Geoinformationssysteme (GIS), Raumordnung, Raumordnungsgesetz (ROG), Stakeholder, Öffentlichkeit, Investoren, Kommunale Verwaltung, Erneuerbare Energien, Energiewende, Landschaftsbildbeeinträchtigung, Wirtschaftlichkeit, CO2-Vermeidung, ArcGIS, Open Data.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: GIS-gestützte Standortanalyse von Windkraftanlagen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Anwendung von Geoinformationssystemen (GIS) zur optimalen Standortauswahl von Windkraftanlagen (WKA). Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Einbindung und Berücksichtigung der Interessen verschiedener Stakeholdergruppen wie der Öffentlichkeit, Investoren und der kommunalen Verwaltung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, geeignete GIS-basierte Analyseverfahren zur WKA-Standortanalyse zu erläutern, praktisch anzuwenden und die Ergebnisse für verschiedene Stakeholdergruppen ansprechend zu visualisieren, z.B. über eine Internetplattform. Es geht um die Optimierung der Standortauswahl unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Faktoren sowie der rechtlichen Rahmenbedingungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: GIS-basierte Standortanalysemethoden, stakeholder-spezifische Anforderungen an Standortanalysen, raumplanerische Rahmenbedingungen für den Ausbau der Windenergie, ökonomische und ökologische Bewertung von WKA-Standorten und die webbasierte Visualisierung und Kommunikation der Analyseergebnisse.
Welche Methoden werden in der Arbeit eingesetzt?
Die Arbeit verwendet GIS-basierte Methoden und Algorithmen, insbesondere im Kontext der Software ArcGIS. Es werden sowohl rasterbasierte Multi-Criteria-Analysen als auch vektorbasierte Methoden wie „Ausschneiden“, „Puffer“, „Vereinigen“ und „Radieren“ eingesetzt. Zusätzlich werden 3D-Visualisierung und Sichtbarkeitsanalysen zur Bewertung der Landschaftsbildbeeinträchtigung durchgeführt.
Welche Fallbeispiele werden untersucht?
Die Arbeit beinhaltet drei Fallbeispiele: Dahme-Spreewald (Flächenpotentialanalyse), Bergholz-Rehbrücke (Landschaftsbildanalyse) und Märkische Heide (ökonomische und ökologische Kennzahlenberechnung und webbasierte Darstellung).
Wie werden die Ergebnisse visualisiert und kommuniziert?
Die Ergebnisse werden sowohl in der Arbeit selbst als auch über eine webbasierte Plattform visualisiert und kommuniziert. Die Webseite dient der Information und Beteiligung verschiedener Stakeholdergruppen.
Welche Stakeholdergruppen werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die spezifischen Anforderungen der kommunalen Verwaltung, potentieller Investoren und der Öffentlichkeit an WKA-Standortanalysen. Die Informationsbedürfnisse und Interessen jeder Gruppe werden detailliert beschrieben.
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen und planerischen Rahmenbedingungen für den Ausbau der Windenergie in Deutschland, mit Fokus auf das Raumordnungsgesetz (ROG) und die regionalplanerische Steuerung. Die Kategorien Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete werden erläutert.
Welche ökonomischen und ökologischen Kennzahlen werden berechnet?
Im Fallbeispiel Märkische Heide werden ökonomische und ökologische Kennzahlen berechnet, darunter Windleistungspotential, Stromertragspotential, Volllaststunden, Anteil am Stromverbrauch und CO2-Vermeidung.
Welche Software wird verwendet?
Die Arbeit verwendet hauptsächlich ArcGIS als GIS-Software.
Welche Datengrundlagen werden verwendet?
Die Arbeit verwendet verschiedene Geodaten, deren spezifische Quellen und Bezugssysteme in den jeweiligen Kapiteln detailliert beschrieben werden. Open Data wird teilweise verwendet.
- Quote paper
- Michael Siegert (Author), 2015, Standortanalyse für Windkraftanlagen mit der Beteiligung der Öffentlichkeit, Investoren und kommunalen Verwaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343358