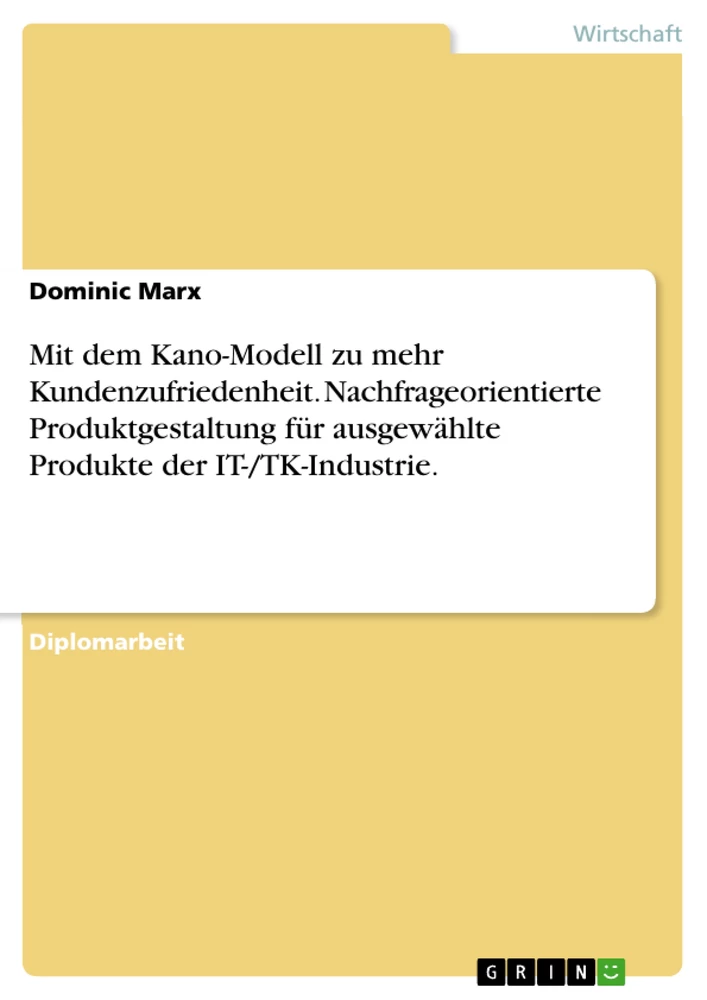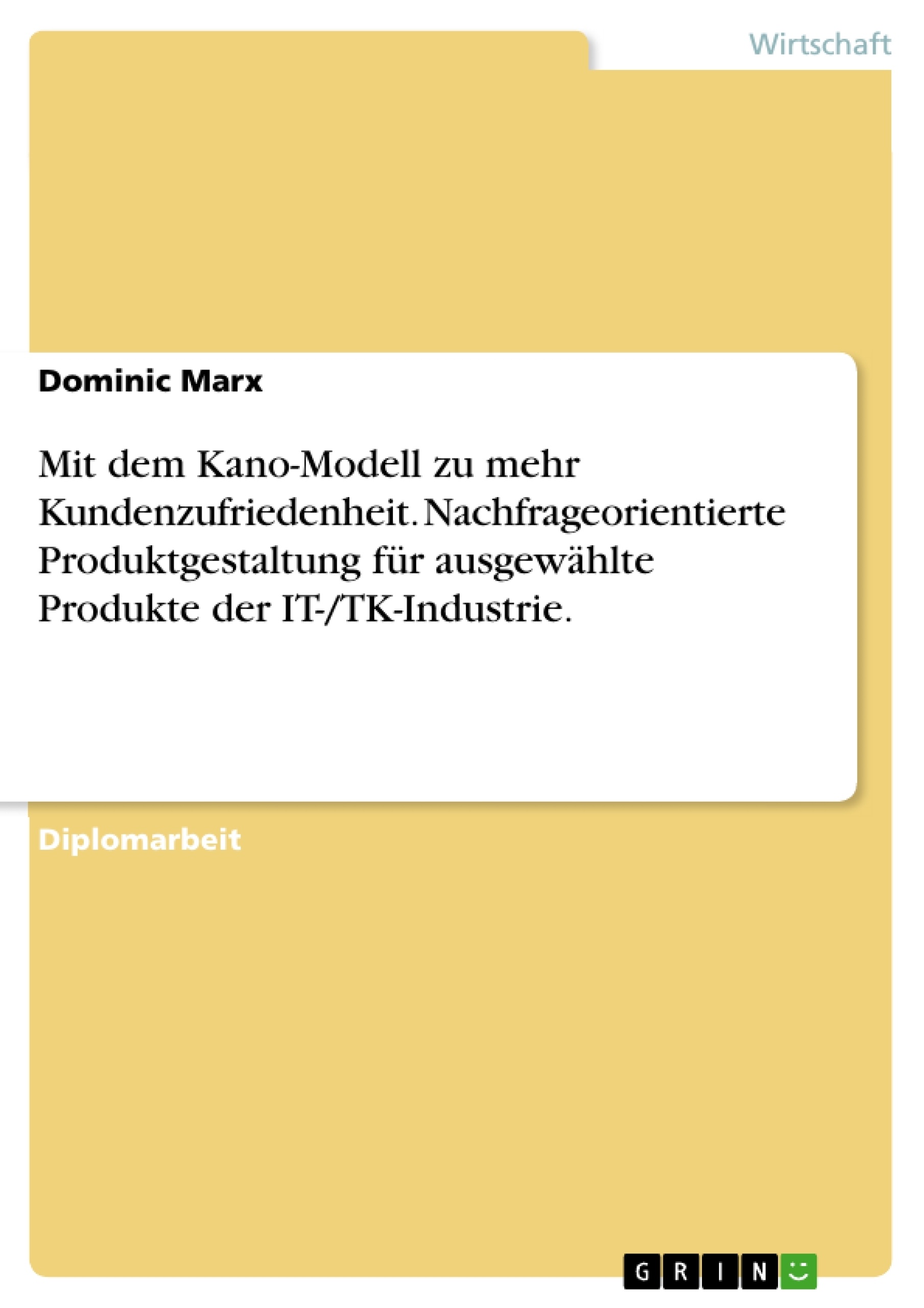Gerätehersteller der IT-/TK-Industrie vernachlässigen bei der Entwicklung und Vermarktung ihrer Produkte immer noch eine Fokussierung auf kundenrelevante Anforderungen aus dem Markt. Ihre Produkte entstammen oftmals lediglich internen technischen Überlegungen und entsprechen objektiven Qualitätskriterien, die aus den Unternehmen erwachsen.
Für die Zwecke des Marketing und daraus folgend einer marktorientierten Produktgestaltung ist es jedoch im allgemeinen untauglich, von einer objektiven Produktqualität auszugehen, da ein solches Konstrukt ein eindimensionales Bewertungssystem voraussetzt, während Güter aus Kundensicht in Wirklichkeit Aggregate aus Nutzenkomponenten und Eigenschaften darstellen. Ohne ein subjektives Zielsystem lassen sich die einzelnen Elemente jedoch nicht miteinander verknüpfen. Deshalb bietet sich ein teleologischer Qualitätsbegriff an, welcher ein subjektives Urteil im Hinblick individueller Nutzenerwartungen und somit eine Eignung des Produktes für einen intendierten Verwendungszweck darstellt.
Praktiker benötigen Hilfsmittel und Methoden, welche ihnen helfen, ein tieferes Verständnis bzgl. der Bedürfnisse und Anforderungen der Nachfrager zu erlangen. Hierzu eignet sich besonders das Kano-Modell der Kundenzufriedenheit als Ausgangspunkt für ein Quality Function Deployment-Projekt.
Die Kano-Methode ermöglicht Kundenanforderungen zu strukturieren und ihren Einfluss auf die Zufriedenheit als erfolgsbestimmende Größe zu ermitteln. Hierbei ist besonders darauf hinzuweisen, dass sich die Kano-Methode insbesondere für komplexe Produkte mit einer großen Anzahl unterschiedlicher Produktanforderungen eignet und sich der Aufwand einer Kano-Untersuchung auch nur bei diesen lohnt.
Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Produkte zeichnen sich deshalb durch eine große Komplexität hinsichtlich der Anforderungen aus und sind somit sehr geeignet für die Anwendung des Kano-Modells. Anhand einer durchgeführten empirischen Studie mit ausgewählten Produkten der IT-/TK-Industrie wird anschaulich die Vorgehensweise zur Anwendung des Kano-Modells erläutert und die zahlreichen Möglichkeiten der Analyse und Visualisierung der Untersuchungsergebnisse in der Praxis vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Definition des Untersuchungsgegenstands
- Begriffliche Grundlagen und Untersuchungsgegenstand
- Das Konzept eines Netzwerks
- Der Aufbau eines Netzwerks
- Technologien und weitere Begriffsklärungen
- Struktur des Kano-Modells
- Theoretische Grundlagen
- Das Qualitätsmanagement
- Das Kano-Modell
- Das Zufriedenheitskonzept
- Kano-Kategorien
- Ablauf eines Kano-Projekts
- Identifikation von Produktanforderungen
- Konstruktion des Fragebogens
- Durchführung der Kundeninterviews
- Auswertung und Interpretation
- Auswertung nach Häufigkeiten
- Segmentspezifische Auswertung
- Auswertung bei Gleichverteilung von Attractives und Indifferents
- Auswertungsregel bei nicht eindeutigen Zuordnungen
- Category Strength
- Total Strength
- Self-Stated Importance
- Self-Stated Importance und Revealed Importance
- Der Zufriedenheitsstiftungskoeffizient
- Der Quality-Improvement-Index
- Adjusted Improvement Ratio
- Interpretation fragwürdiger und entgegengesetzter Anforderungen
- Weitere Analyseverfahren
- Kritische Betrachtung des Kano-Modells
- Formulierung der Antwortmöglichkeiten
- Ableitung des Kano-Diagramms
- Vergleich des Kano-Modells mit traditionellem Ansatz
- Gütekriterien
- Objektivität
- Reliabilität
- Validität
- Eine empirische Untersuchung
- Identifikation der Produktanforderungen
- Konstruktion des Fragebogens
- Durchführung der Interviews
- Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
- Auswertung nach Häufigkeiten
- Auswertung bei Doppeltkategorisierungen
- Category Strength und Total Strength
- Signifikanz der Zuordnungen
- Self-Stated Importance
- Zusammenhang zwischen Self-Stated Importance und Kano-Kategorien
- Der Zufriedenheitsstiftungskoeffizient
- Interpretation fragwürdiger und entgegengesetzter Antworten
- Wettbewerbspositionierung
- Zusammenfassung und Ausblick
- Kano-Modell der Kundenzufriedenheit
- Produktgestaltung in der IT-/TK-Industrie
- Identifikation von Kundenanforderungen
- Empirische Untersuchung zur Anwendung des Kano-Modells
- Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die nachfragerorientierte Produktgestaltung unter Anwendung des Kano-Modells der Kundenzufriedenheit für ausgewählte Produkte der IT-/TK-Industrie. Ziel ist es, die Anwendung des Kano-Modells in der Praxis zu demonstrieren und dessen Potenzial für die Produktentwicklung aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit vor. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den begrifflichen Grundlagen und dem Untersuchungsgegenstand, insbesondere mit dem Konzept und Aufbau von Netzwerken sowie relevanten Technologien. Kapitel 3 erläutert die Struktur des Kano-Modells, inklusive seiner theoretischen Grundlagen, dem Ablauf eines Kano-Projekts und der kritischen Betrachtung des Modells. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Anwendung des Kano-Modells in der IT-/TK-Industrie. Die Zusammenfassung und der Ausblick in Kapitel 5 fassen die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und geben Handlungsempfehlungen für die zukünftige Produktgestaltung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe Kano-Modell, Kundenzufriedenheit, Produktgestaltung, IT-/TK-Industrie, empirische Untersuchung, Kundenanforderungen und Handlungsempfehlungen. Die Studie analysiert die Anwendung des Kano-Modells in der Praxis und liefert wertvolle Erkenntnisse für die Produktentwicklung in der IT-/TK-Industrie.
- Quote paper
- Dominic Marx (Author), 2001, Mit dem Kano-Modell zu mehr Kundenzufriedenheit. Nachfrageorientierte Produktgestaltung für ausgewählte Produkte der IT-/TK-Industrie., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34328