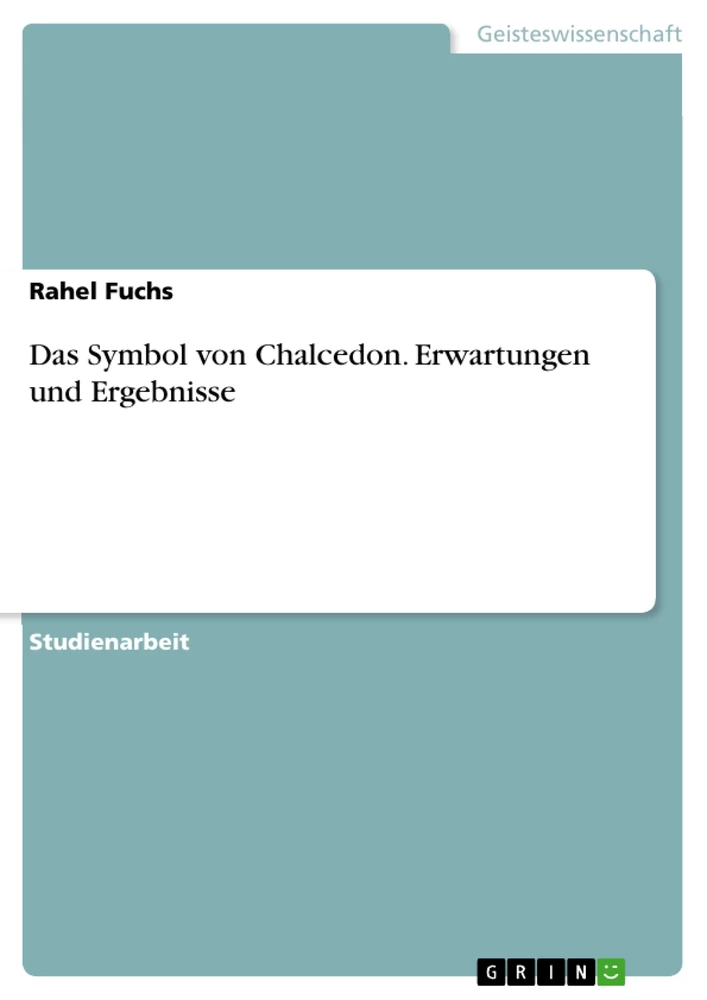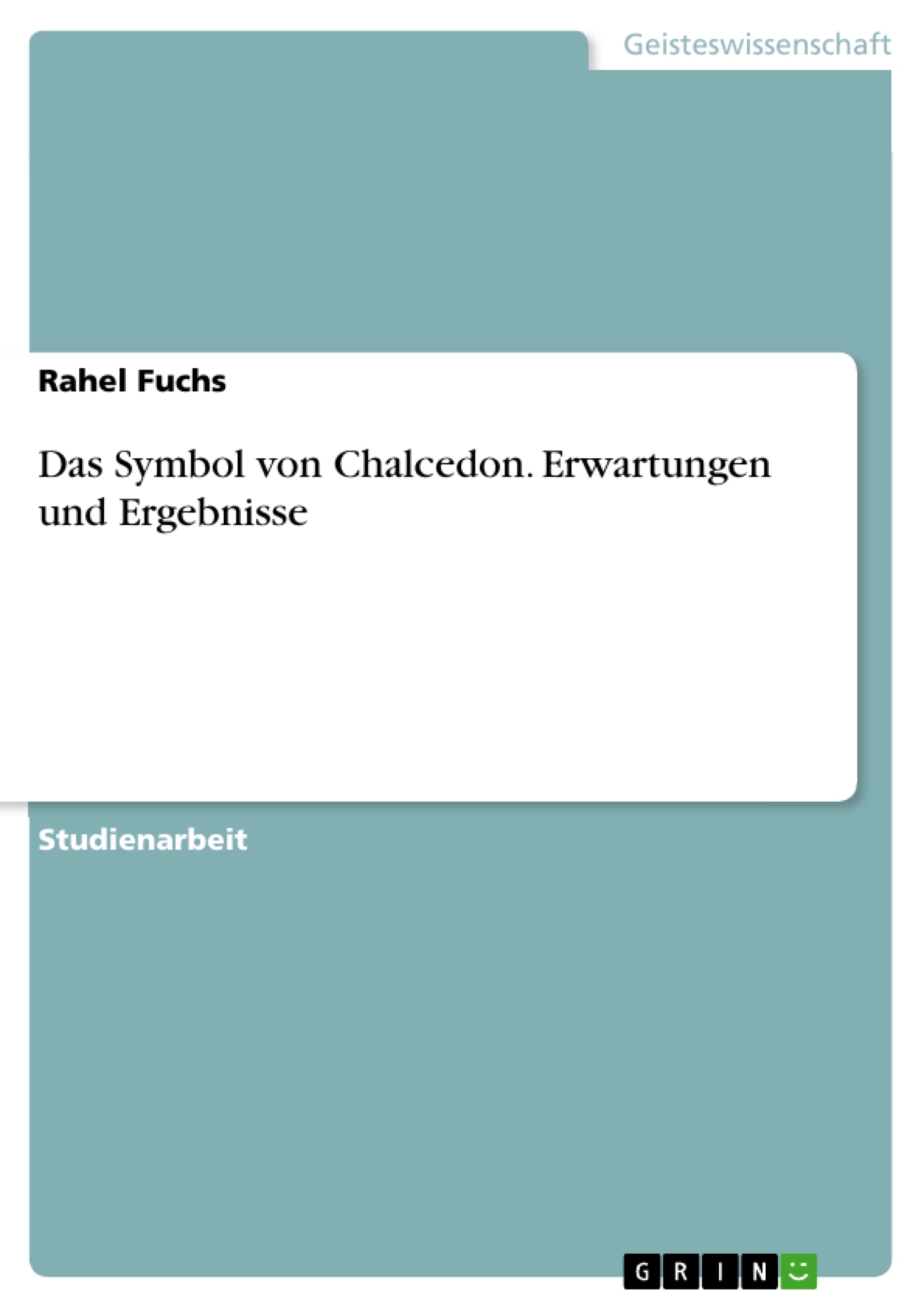Die Arbeit weist eine Vierteilung auf: Da sich die Grundeinstellungen der beteiligten Parteien zum Konzil von Chalcedon z.T. aus dem historischen Kontext und der Vorgeschichte des Konzils ergeben, soll zunächst auf wichtige
Ereignisse und Konflikte vor 451 eingegangen werden. Dabei wird die Herkunft wichtiger Lehrtraditionen, auf die das Chalcedonense aufbaut, deutlich.
Im Anschluss werden Kaiser, Papst und Bischöfe in Hinblick auf ihre Ziele, Befürchtungen und Widerständen vorgestellt. Für jede Person oder Personengruppe wird die Grundhaltung in zwei bis drei Punkten formuliert und eine Frage für den weiteren Verlauf der Arbeit aufgestellt.
Im dritten Teil, der sich besonders dem Symbol von Chalcedon als wichtiges Ergebnis des Konzils zuwendet, und im vierten Teil, der sich der Geschichte nach 451 widmet, wird nach und nach auf diese Grundhaltungen eingegangen und die formulierten Fragen beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Christologische Debatten vor dem Konzil von Chalcedon 451
- 2.1 Das Konzil von Nicaea 325
- 2.2 Das Konzil von Konstantinopel 381
- 2.3 Der Nestorianische Streit und Versuche der Einigung
- 2.3.1 Die Grundpositionen: Alexandrien und Antiochia
- 2.3.2 Das Konzil von Ephesus 431 als erster Versuch der Streitschlichtung
- 2.3.3 Die Unionsformel 433
- 2.4 Der Eutychianische Streit 448-451
- 2.4.1 Ein radikalisierter Monophysitismus
- 2.4.2 Stellungnahme des Papstes Leo I
- 2.4.3 Ein weiteres Konzil in Ephesus 449 – eine „Räubersynode“
- 3 Ein neues Konzil – Erwartungen und Befürchtungen
- 3.1 Kaiser Marcians Erwartungen an ein neues Konzil
- 3.2 Papst Leo I. und seine Befürchtungen
- 3.3 Die Bischöfe und ihr Widerstand
- 4 Das Symbol von Chalcedon 451
- 4.1 Einberufung des Konzils
- 4.2 Der Weg zur Glaubensformel
- 4.3 Die Glaubensformel von Chalcedon als Kompromiss(versuch)
- 4.4 Theologie des Chalcedonense
- 5 Ergebnisse des Konzils von Chalcedon: Annahme und Ablehnung der christologischen Formel
- 5.1 Rom und Konstantinopel
- 5.2 Die „Monophysiten“
- 5.2.1 Erste Widerstände: Ägypten, Palästina und Syrien
- 5.2.2 Ein erster Kompromissversuch: Das Enkyklion von Basiliscus
- 5.2.3 Ein zweiter Kompromissversuch: Das Henotikon Zenons und das Acacianische Schisma
- 6 Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Hintergründe, Erwartungen und Ergebnisse des Konzils von Chalcedon (451). Sie analysiert die christologischen Debatten vor dem Konzil, die unterschiedlichen Positionen der beteiligten Parteien (Kaiser Marcian, Papst Leo I., die Bischöfe), und den Prozess der Entstehung der Glaubensformel von Chalcedon. Die Arbeit beleuchtet den Kontext der vorhergehenden Konzilien und Streitigkeiten, um das Zustandekommen des Kompromisses besser zu verstehen.
- Die christologischen Debatten des 4. und 5. Jahrhunderts
- Die Rolle von Kaiser Marcian, Papst Leo I. und den Bischöfen im Vorfeld und während des Konzils
- Die Entstehung und der Inhalt der Glaubensformel von Chalcedon
- Die Rezeption und Ablehnung der chalcedonensischen Formel
- Die Bedeutung des Konzils von Chalcedon für die Geschichte der christlichen Kirche
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der christologischen Debatten des 4. und 5. Jahrhunderts ein und skizziert die Bedeutung des Konzils von Chalcedon als Höhepunkt dieser Auseinandersetzungen. Sie benennt die drei zentralen Akteure (Kaiser Marcian, Papst Leo I., die Bischöfe) und kündigt die Struktur der Arbeit an, die sich mit deren Zielen, Befürchtungen und Widerständen auseinandersetzt. Die Arbeit verfolgt den Ansatz, die jeweiligen Positionen dieser Akteure im Kontext der vorangegangenen Debatten zu verstehen und im weiteren Verlauf der Arbeit zu analysieren.
2 Christologische Debatten vor dem Konzil von Chalcedon 451: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die wichtigsten christologischen Debatten vor 451, beginnend mit dem Konzil von Nicäa (325) und dem arianischen Streit, gefolgt vom Konzil von Konstantinopel (381) und den Auseinandersetzungen um Nestorius und Eutyches. Es werden die verschiedenen christologischen Positionen und die daraus resultierenden Konflikte erläutert. Die Bedeutung dieser vorherigen Konzilien und Debatten für die spätere Entwicklung der Glaubensformel von Chalcedon wird hervorgehoben. Das Kapitel dient als historischer Kontext und legt die Grundlage für das Verständnis der Herausforderungen, die das Konzil von Chalcedon zu bewältigen hatte.
3 Ein neues Konzil – Erwartungen und Befürchtungen: Dieses Kapitel präsentiert die unterschiedlichen Perspektiven der drei Hauptgruppen – Kaiser Marcian, Papst Leo I., und die Bischöfe – auf das bevorstehende Konzil. Es beschreibt die Erwartungen des Kaisers an eine neue, verbindliche Glaubensformel, die Befürchtungen des Papstes bezüglich der möglichen Abkehr von der orthodoxen Lehre und den Widerstand einzelner Bischöfe gegen eine weitere Intervention in den theologischen Debatten. Durch die Darstellung der verschiedenen Interessen und Ängste wird der komplexe Hintergrund für die Verhandlungen auf dem Konzil deutlich.
4 Das Symbol von Chalcedon 451: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Verlauf und dem Ergebnis des Konzils von Chalcedon. Es beschreibt den Prozess der Entwicklung der Glaubensformel, die als Kompromiss zwischen verschiedenen christologischen Positionen betrachtet werden kann. Die theologischen Implikationen der Formel werden beleuchtet und ihr Stellenwert im Rahmen der weiteren christlichen Geschichte wird angedeutet.
5 Ergebnisse des Konzils von Chalcedon: Annahme und Ablehnung der christologischen Formel: Dieses Kapitel analysiert die Reaktionen auf das Konzil von Chalcedon und die Akzeptanz oder Ablehnung der neuen Glaubensformel in verschiedenen Teilen der christlichen Kirche. Es beschreibt die Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern und Gegnern der Formel, insbesondere die Widerstände der Monophysiten, und die Versuche, durch Kompromisse die Einheit der Kirche wiederherzustellen. Das Kapitel zeigt, dass die Formel von Chalcedon nicht zu einer dauerhaften Lösung der christologischen Kontroversen führte.
Schlüsselwörter
Konzil von Chalcedon, Christologie, Monophysitismus, Nestorianismus, Papst Leo I., Kaiser Marcian, Glaubensformel, Konzil von Nicäa, Konzil von Konstantinopel, kirchliche Einheit, theologische Debatten, Kompromiss, orthodoxe Lehre.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Das Konzil von Chalcedon (451)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Hintergründe, Erwartungen und Ergebnisse des Konzils von Chalcedon (451). Im Fokus stehen die christologischen Debatten vor dem Konzil, die unterschiedlichen Positionen der beteiligten Parteien (Kaiser Marcian, Papst Leo I., die Bischöfe) und der Prozess der Entstehung der Glaubensformel von Chalcedon. Die Arbeit beleuchtet den Kontext der vorhergehenden Konzilien und Streitigkeiten, um das Zustandekommen des Kompromisses besser zu verstehen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die christologischen Debatten des 4. und 5. Jahrhunderts, die Rolle von Kaiser Marcian, Papst Leo I. und den Bischöfen, die Entstehung und den Inhalt der Glaubensformel von Chalcedon, deren Rezeption und Ablehnung sowie die Bedeutung des Konzils für die Geschichte der christlichen Kirche.
Welche Konzilien und Streitigkeiten werden vor dem Konzil von Chalcedon behandelt?
Die Arbeit beschreibt die wichtigsten christologischen Debatten vor 451, beginnend mit dem Konzil von Nicäa (325) und dem arianischen Streit, gefolgt vom Konzil von Konstantinopel (381) und den Auseinandersetzungen um Nestorius und Eutyches. Die verschiedenen christologischen Positionen und die daraus resultierenden Konflikte werden erläutert, um den historischen Kontext für das Verständnis des Konzils von Chalcedon zu liefern.
Wie werden die Positionen von Kaiser Marcian, Papst Leo I. und den Bischöfen dargestellt?
Die Arbeit präsentiert die unterschiedlichen Perspektiven dieser drei Hauptgruppen auf das Konzil. Sie beschreibt die Erwartungen des Kaisers an eine neue Glaubensformel, die Befürchtungen des Papstes bezüglich der orthodoxen Lehre und den Widerstand einzelner Bischöfe gegen weitere Interventionen in theologischen Debatten. Die Darstellung der verschiedenen Interessen und Ängste soll den komplexen Hintergrund der Verhandlungen auf dem Konzil verdeutlichen.
Wie wird die Entstehung und der Inhalt der Glaubensformel von Chalcedon beschrieben?
Die Arbeit beschreibt den Verlauf und das Ergebnis des Konzils von Chalcedon. Sie beschreibt den Prozess der Entwicklung der Glaubensformel als Kompromiss zwischen verschiedenen christologischen Positionen und beleuchtet deren theologischen Implikationen sowie deren Stellenwert in der weiteren christlichen Geschichte.
Wie wird die Rezeption der Glaubensformel von Chalcedon dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Reaktionen auf das Konzil und die Akzeptanz oder Ablehnung der neuen Glaubensformel in verschiedenen Teilen der christlichen Kirche. Sie beschreibt die Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern der Formel, insbesondere die Widerstände der Monophysiten, und die Versuche, durch Kompromisse die Einheit der Kirche wiederherzustellen. Die Arbeit zeigt auf, dass die Formel von Chalcedon keine dauerhafte Lösung der christologischen Kontroversen brachte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis der Seminararbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Konzil von Chalcedon, Christologie, Monophysitismus, Nestorianismus, Papst Leo I., Kaiser Marcian, Glaubensformel, Konzil von Nicäa, Konzil von Konstantinopel, kirchliche Einheit, theologische Debatten, Kompromiss, orthodoxe Lehre.
Welche Kapitel beinhaltet die Seminararbeit und worum geht es in diesen?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Christologische Debatten vor Chalcedon, Erwartungen und Befürchtungen vor dem Konzil, Das Symbol von Chalcedon, Ergebnisse des Konzils und Abschließende Bemerkungen. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik, beginnend mit dem historischen Kontext und den Vorläuferdebatten bis hin zu den Folgen des Konzils und den langfristigen Auswirkungen auf die christliche Kirche.
- Quote paper
- Rahel Fuchs (Author), 2015, Das Symbol von Chalcedon. Erwartungen und Ergebnisse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342710