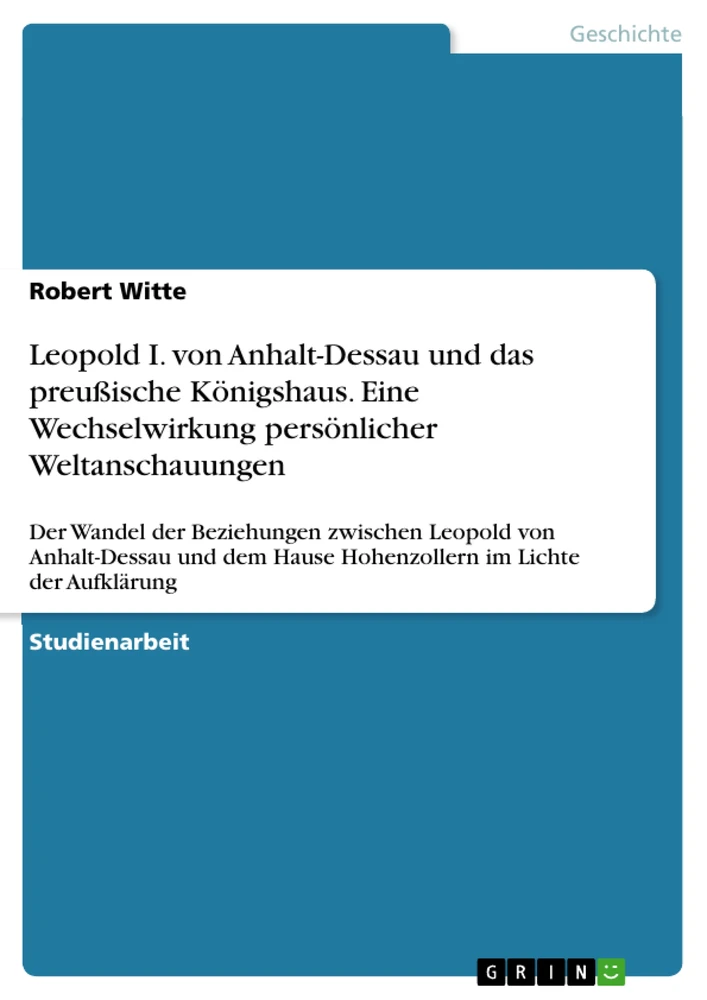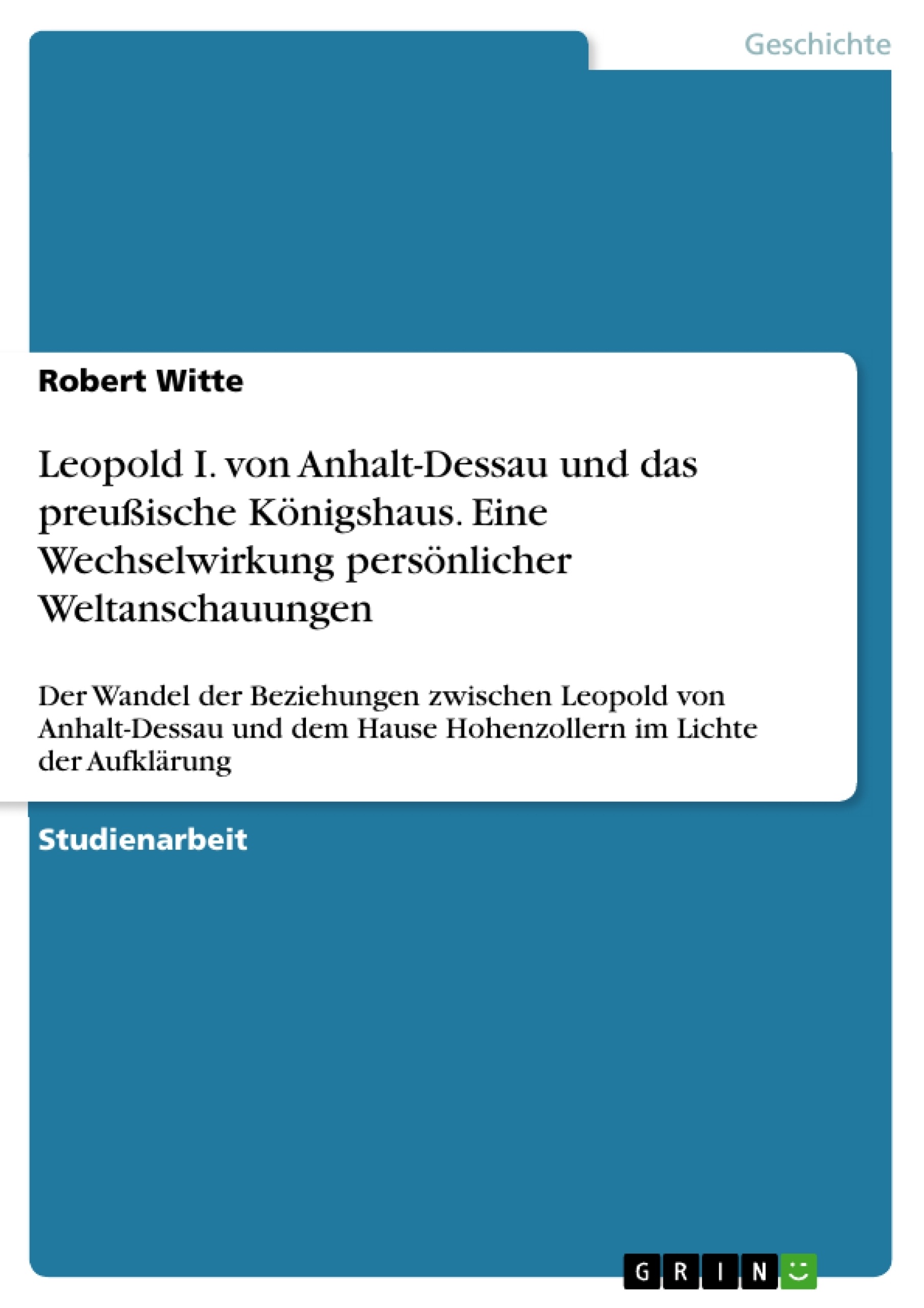Mit der Aufklärung veränderten sich neben den traditionellen Vorstellungen von Herrschaft und Macht auch individuelle politische Strukturen am preußisch-brandenburgischen Hof. Betrachtet man vor diesem Hintergrund die Beziehungen zwischen dem kleinen Fürstentum Anhalt-Dessau und dem preußischen Königshof, kommt man nicht umhin beim Übergang der Thronfolge vom „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I zu dessen Sohn, der später einmal Friedrich der Große genannt werden wird, eine Verschlechterung der Verhältnisse zu erkennen, die nicht ausschließlich mit persönlichen Charakteristika der Beteiligten und damit verbundenen Problemen erklärbar erscheinen.
Vielmehr kann man zu der Vermutung gelangen, dass Leopold I. von Anhalt-Dessau inmitten dieses fühlbaren Epochenwandels als Symbol eines tief verwurzelten Glaubens an die absolute Selbstherrschaft der vergangenen Jahrzehnte unvermeidbar seinen Einfluss am Königshof verlieren musste. Diese Vermutung, eines Zusammenhangs zwischen einsetzender Aufklärung und dem Bedeutungsverlust des anhaltinischen Fürstentums für das Königreich Preußen, zu untersuchen, ist demzufolge zentrales Ziel der vorliegenden Arbeit.
Zwischen einem Brief Friedrich Wilhelms I., in welchem der König dem anhaltinischen Leopold I. schreibt: „Ew. Liebden können aber versichert sein, daß ich Ihr guter Freund bin“ und der Zurechtweisung des Fürsten von Anhalt-Dessau durch Friedrich den Großen: „wan sie noch habiler als Cesar weren und Meine Ordres nicht acurat und Strikte nachleben, so hülft mihr das übrige nicht mehr“ liegen nicht nur 30 Jahre Geschichte und eine Generation der Hohenzollern-Dynastie, sondern darüber hinaus ein grundlegender geistiger Wandel, der das Verständnis von Politik und Gesellschaft nachhaltig änderte.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Der "Soldatenkönig" und der "Alte Dessauer" - Zwei vom alten Schlag?
- Friedrich Wilhelm I.: Das Spiegelbild einer Zeit
- Das Preußische Oberhaupt und Leopold I. von Anhalt-Dessau - Politische Überzeugung als Basis einer Freundschaft
- Friedrich II. und Leopold I. - Eine Beziehung der Gegensätze
- Friedrich der Große: Ein „roi philosophe“
- Die Beziehungen zu Leopold von Anhalt-Dessau - Mehr Auseinandersetzung als Verständigung
- Der Epochenwandel der „Aufklärung“ als Zäsur für den anhaltinischen Einfluss am Königshof?
- Der Aufstieg Leopold I. - Abbild einer Epoche der absoluten Selbstherrschaft?
- Der politische Bedeutungsverlust Anhalt-Dessaus für das Herzogtum Brandenburg als Folge einer Welt im Wandel?
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das zentrale Ziel dieser Arbeit ist es, den Zusammenhang zwischen der einsetzenden Aufklärung und dem Bedeutungsverlust des anhaltinischen Fürstentums für das Königreich Preußen zu untersuchen. Dazu wird die Beziehung zwischen Leopold I. von Anhalt-Dessau und den preußischen Königen Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. im Kontext der sich verändernden politischen und gesellschaftlichen Strukturen im 18. Jahrhundert beleuchtet.
- Der Wandel der Beziehungen zwischen Leopold I. von Anhalt-Dessau und dem preußischen Königshaus im Kontext der Aufklärung.
- Die Auswirkungen der Aufklärung auf die Herrschaftsstrukturen im preußisch-brandenburgischen Raum.
- Die Rolle des "Alten Dessauers" als Symbol für die absolute Selbstherrschaft der Vergangenheit.
- Die Bedeutung von persönlicher Weltanschauung und politischen Überzeugungen in der Gestaltung der Beziehungen zwischen den beiden Fürstenhäusern.
- Der Einfluss des Epochenwandels auf die politische Bedeutung Anhalt-Dessaus.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit untersucht die Beziehungen zwischen dem "Alten Dessauer" Leopold I. von Anhalt-Dessau und den beiden preußischen Königen Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. in drei Abschnitten.
Im ersten Abschnitt wird das Verhältnis zwischen Leopold I. und Friedrich Wilhelm I., dem "Soldatenkönig", beleuchtet. Die Freundschaft der beiden Männer, die durch einen langjährigen Briefwechsel dokumentiert ist, steht im Fokus. Der Abschnitt analysiert die politische, gesellschaftliche und herrschaftliche Ansichten Friedrich Wilhelms I., um die Rolle des anhaltinischen Fürsten unter seiner Herrschaft zu verstehen.
Der zweite Abschnitt analysiert die Beziehung zwischen Leopold I. und Friedrich II., dem späteren Friedrich dem Großen. Dieser Teil der Arbeit setzt sich mit den Veränderungen in der Stellung des anhaltinischen Fürsten am preußischen Hof auseinander und untersucht, wie sich die einsetzenden Ideen der Aufklärung auf das Verhältnis der beiden Männer auswirkten.
Im dritten Abschnitt wird der Versuch unternommen, die Veränderungen in den Beziehungen zwischen Leopold I. und den preußischen Königen in einen Gesamtkontext der Aufklärung einzubeziehen. Leopold I. wird als Sinnbild für überholte geistige Strukturen analysiert, um zu untersuchen, inwieweit sein Charakter und seine herrschaftspolitischen Ansichten dem Fürstentum Anhalt-Dessau im 18. Jahrhundert zu Rang und Namen verhelfen konnten.
Schlüsselwörter
Leopold I. von Anhalt-Dessau, Friedrich Wilhelm I., Friedrich II., Preußen, Anhalt-Dessau, Aufklärung, absolute Selbstherrschaft, politische Überzeugung, gesellschaftlicher Wandel, Briefwechsel, Beziehungen, Epochenwandel, Herrschaftsstrukturen.
- Quote paper
- Robert Witte (Author), 2013, Leopold I. von Anhalt-Dessau und das preußische Königshaus. Eine Wechselwirkung persönlicher Weltanschauungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342689