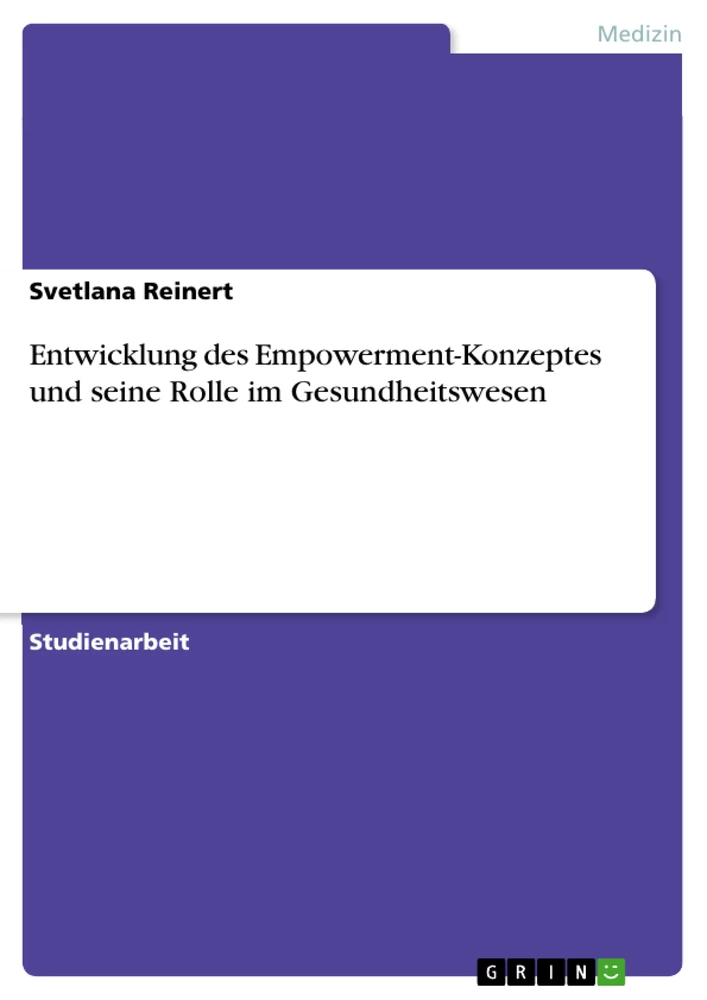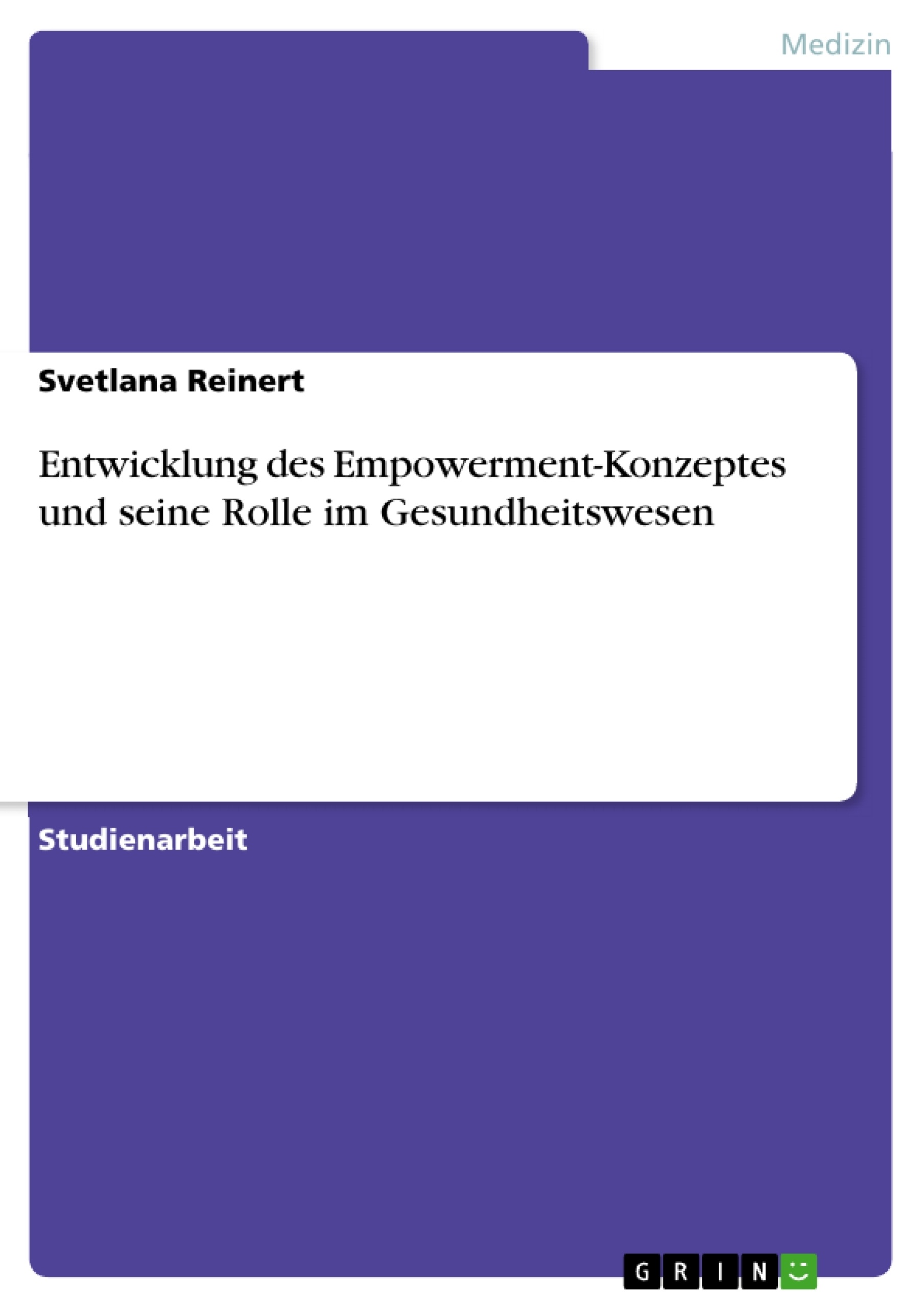Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der unterschiedlichen Entwicklung des Empowerments in der Sozialarbeit, der Wirtschaft und der Situation in der Gesundheitsförderung und der Beratung in der Pflege. Die verschiedenen Perspektiven der einzelnen Akteure, die politischen Faktoren und verwandte Konzepte (Salutogenese, Resilienz) in der Gesundheitsförderung und in der Pflege werden dabei mitgedacht. Den Abschluss bildet die Analyse von Stärken und Schwächen des Empowerment-Konzeptes insbesondere bei der Umsetzung in einem Empowerment-Prozess.
Das Empowerment-Konzept ist in den letzten Jahrzehnten im Gesundheitswesen, Politik und Gesellschaft ein wichtiges Thema geworden. Bereits seit den ersten Ansätzen von Empowerment in der Pflege wird in den Gesundheitswissenschaften und der Gesundheitspolitik darüber debattiert, was Empowerment in der Pflege für die Gesellschaft bedeuteten könnte, wie man es etablieren kann, und wie weit man es etablieren darf.
Die Vernetzung der beteiligten Akteure im Empowerment-Prozess macht deutlich, dass jede dieser Positionen andere Ziele, Wertvorstellungen und Interessen bezüglich der eigenen Per-spektive hat: Die Patienten streben nach Erhaltung oder Wiedergewinnung von Gesundheit und Lebensgestaltung; Die Leistungserbringer (Krankenhäuser, Kliniken, Ärzte, Pflegeperso-nal, ambulante Dienste) wünschen sich im Rahmen von Empowerment umsetzbare Modelle und Handlungsanweisungen, um ihre fachlichen Kompetenzen angemessen einsetzen zu können; die Versicherer suchen nach Modellen und Programmen, wie sie die Kosten reduzieren und die Versicherten qualitativ hoch beraten und begleiten können, die Vertreter der Gesundheitspolitik möchten einen kostengünstigen und qualitativ hohen gesetzlichen und gesellschaftlichen Rahmen schaffen, der den formulierten Interessen der Akteure entgegen kommt.
Bereits über einen längeren Zeitraum wird in den Gesundheitswissenschaften und der Gesundheitspolitik diskutiert, was Empowerment in der Gesundheitsförderung und Beratung in der Pflege für die Gesellschaft bedeuteten könnte, wie man es gesellschaftlich etablieren könnte, und wie weit dieses Konzept erfolgreich in der Umsetzung sein könnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aktualität des Themas im internationalen Kontext
- 2.1. Zur Entwicklung des Empowerment-Konzeptes
- 2.2. Bestimmung des Begriffs Empowerment
- 3. Empowerment auf verschiedenen Ebenen
- 3.1. Die individuelle Ebene
- 3.2. Die interaktive Ebene
- 3.3. Die institutionelle Ebene
- 3.4. Die strukturelle Ebene
- 4. Empowerment im Unternehmen
- 5. Empowerment in der Gesundheitsförderung und in der Beratung in der Pflege
- 5.1. Zum Stellenwert von Gesundheit in der Bevölkerung
- 5.2. Die Perspektiven der beteiligten Akteure
- 5.2.1. Patienten
- 5.2.2. Leistungserbringer
- 5.2.3. Versicherer
- 5.2.4. Die Gesundheitspolitik
- 6. Das Empowerment-Prisma
- 7. Fazit
- 8. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entwicklung des Empowerment-Konzeptes und dessen Rolle im Gesundheitswesen. Sie analysiert die verschiedenen Perspektiven der beteiligten Akteure (Patienten, Leistungserbringer, Versicherer, Gesundheitspolitik) und betrachtet den Einfluss von verwandten Konzepten wie Salutogenese und Resilienz. Die Arbeit beleuchtet Stärken und Schwächen des Empowerment-Konzeptes in der Umsetzung.
- Entwicklung des Empowerment-Konzeptes
- Empowerment in verschiedenen Kontexten (Sozialarbeit, Wirtschaft, Gesundheitswesen)
- Perspektiven der Akteure im Gesundheitswesen bezüglich Empowerment
- Einfluss politischer Faktoren auf die Umsetzung von Empowerment
- Stärken und Schwächen des Empowerment-Konzeptes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Empowerment im Gesundheitswesen ein und beschreibt die wachsende Bedeutung des Konzepts in den letzten Jahrzehnten. Sie hebt die unterschiedlichen Perspektiven der beteiligten Akteure (Patienten, Leistungserbringer, Versicherer, Gesundheitspolitik) hervor und skizziert die Fragestellung der Arbeit: die Untersuchung der Entwicklung des Empowerments in verschiedenen Bereichen und seine Umsetzung im Gesundheitswesen.
2. Aktualität des Themas im internationalen Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet die internationale Bedeutung des Empowerment-Konzeptes im Kontext der Gesundheitsförderung, beginnend mit der Ottawa-Charta und den folgenden WHO-Konferenzen. Es betont die Zielsetzung der Befähigung von Individuen zur Selbstbestimmung über ihre Gesundheit und die Herausforderungen bei der Umsetzung dieses Konzepts auf globaler Ebene. Der Bezug zu den Konzepten der "Gesundheit für Alle" und der globalen Zusammenarbeit wird hergestellt.
2.1. Zur Entwicklung des Empowerment-Konzeptes: Dieses Kapitel beschreibt die Ursprünge des Empowerment-Konzeptes in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, der Frauenbewegung und der Selbsthilfebewegung. Es erläutert die Weiterentwicklung des Konzepts durch Julian Rappaport und seine Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Sozialarbeit, Gesundheitsförderung und Unternehmen. Die Vielseitigkeit und unterschiedliche Interpretationen des Begriffs werden angesprochen.
2.2. Bestimmung des Begriffs Empowerment: Dieses Kapitel befasst sich mit der heterogenen Verwendung des Begriffs "Empowerment" und präsentiert unterschiedliche Definitionen relevanter Autoren. Es hebt die verschiedenen Aspekte hervor, in denen Empowerment als Konzept, Prozess, Ziel, Mittel und Resultat verstanden wird, und betont die Notwendigkeit einer klaren Begriffsbestimmung für die vorliegende Arbeit.
3. Empowerment auf verschiedenen Ebenen: (Annahme: Kapitel 3 behandelt Empowerment auf verschiedenen Ebenen, wie im Inhaltsverzeichnis angedeutet). Dieses Kapitel würde die verschiedenen Ebenen des Empowerments (individuell, interaktiv, institutionell, strukturell) detailliert untersuchen und aufzeigen, wie Empowerment auf jeder dieser Ebenen wirkt und welche Herausforderungen sich dabei stellen. Es würde die Interaktionen zwischen den Ebenen und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes zur Stärkung des Empowerments beleuchten.
4. Empowerment im Unternehmen: Dieses Kapitel würde die Anwendung des Empowerment-Konzepts im unternehmerischen Kontext untersuchen. Es könnte die Vorteile und Herausforderungen für Unternehmen erörtern, die ihren Mitarbeitern mehr Eigenverantwortung und Entscheidungsbefugnisse geben. Mögliche Beispiele für erfolgreiche und weniger erfolgreiche Implementierungen werden betrachtet. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der unterschiedlichen Organisationsstrukturen und Führungsstile, die Empowerment in Unternehmen ermöglichen oder behindern.
5. Empowerment in der Gesundheitsförderung und in der Beratung in der Pflege: Dieses Kapitel analysiert den Stellenwert von Gesundheit in der Bevölkerung und die Perspektiven der beteiligten Akteure im Gesundheitswesen (Patienten, Leistungserbringer, Versicherer, Gesundheitspolitik) im Kontext von Empowerment. Es beleuchtet, wie Empowerment die Zusammenarbeit zwischen diesen Akteuren verbessern und die Gesundheitsversorgung optimieren kann. Die Bedeutung von Patientenrechten und die Rolle von Versicherern bei der Unterstützung von Empowerment-Initiativen werden erörtert.
6. Das Empowerment-Prisma: (Annahme: Kapitel 6 beinhaltet eine zusammenfassende Betrachtung der verschiedenen Aspekte von Empowerment). Dieses Kapitel bietet eine ganzheitliche Betrachtung des Empowerment-Konzeptes, indem es die zuvor diskutierten Aspekte zusammenführt und synthetisiert. Es würde die komplexen Wechselwirkungen der verschiedenen Ebenen und Perspektiven des Empowerments beleuchten und möglicherweise ein Modell oder eine Metapher zur Veranschaulichung der Thematik vorstellen.
Schlüsselwörter
Empowerment, Gesundheitswesen, Gesundheitsförderung, Pflege, Patienten, Leistungserbringer, Versicherer, Gesundheitspolitik, Selbstbestimmung, Befähigung, soziale Arbeit, Resilienz, Salutogenese, internationaler Kontext, Ottawa-Charta.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Empowerment im Gesundheitswesen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung des Empowerment-Konzeptes und dessen Rolle im Gesundheitswesen. Sie analysiert die verschiedenen Perspektiven der beteiligten Akteure (Patienten, Leistungserbringer, Versicherer, Gesundheitspolitik) und betrachtet den Einfluss von verwandten Konzepten wie Salutogenese und Resilienz. Die Arbeit beleuchtet Stärken und Schwächen des Empowerment-Konzeptes in der Umsetzung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung des Empowerment-Konzeptes, seine Anwendung in verschiedenen Kontexten (Sozialarbeit, Wirtschaft, Gesundheitswesen), die Perspektiven der Akteure im Gesundheitswesen, den Einfluss politischer Faktoren und die Stärken und Schwächen des Konzepts.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Aktualität des Themas im internationalen Kontext (inkl. Entwicklung des Empowerment-Konzeptes und Begriffsbestimmung), Empowerment auf verschiedenen Ebenen (individuell, interaktiv, institutionell, strukturell), Empowerment im Unternehmen, Empowerment in der Gesundheitsförderung und Pflege (inkl. Perspektiven der Akteure), Das Empowerment-Prisma (synthetische Betrachtung) und Fazit sowie Literaturverzeichnis.
Welche Akteure im Gesundheitswesen werden betrachtet?
Die Perspektiven von Patienten, Leistungserbringern, Versicherern und der Gesundheitspolitik werden im Detail analysiert, insbesondere im Hinblick auf ihre Rolle im Kontext von Empowerment.
Wie wird der Begriff "Empowerment" definiert?
Die Arbeit beleuchtet die heterogene Verwendung des Begriffs "Empowerment" und präsentiert unterschiedliche Definitionen relevanter Autoren. Es wird auf die verschiedenen Aspekte eingegangen, in denen Empowerment als Konzept, Prozess, Ziel, Mittel und Resultat verstanden wird.
Welche Ebenen des Empowerments werden unterschieden?
Die Arbeit untersucht Empowerment auf individueller, interaktiver, institutioneller und struktureller Ebene und analysiert die Interaktionen zwischen diesen Ebenen.
Welche Rolle spielt die internationale Perspektive?
Die internationale Bedeutung des Empowerment-Konzeptes im Kontext der Gesundheitsförderung wird beleuchtet, beginnend mit der Ottawa-Charta und den folgenden WHO-Konferenzen. Der Bezug zu "Gesundheit für Alle" und globaler Zusammenarbeit wird hergestellt.
Welche verwandten Konzepte werden berücksichtigt?
Die Arbeit betrachtet den Einfluss verwandter Konzepte wie Salutogenese und Resilienz auf das Empowerment-Konzept.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Empowerment, Gesundheitswesen, Gesundheitsförderung, Pflege, Patienten, Leistungserbringer, Versicherer, Gesundheitspolitik, Selbstbestimmung, Befähigung, soziale Arbeit, Resilienz, Salutogenese, internationaler Kontext, Ottawa-Charta.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse jedes Abschnitts beschreibt.
- Quote paper
- Svetlana Reinert (Author), 2015, Entwicklung des Empowerment-Konzeptes und seine Rolle im Gesundheitswesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342604