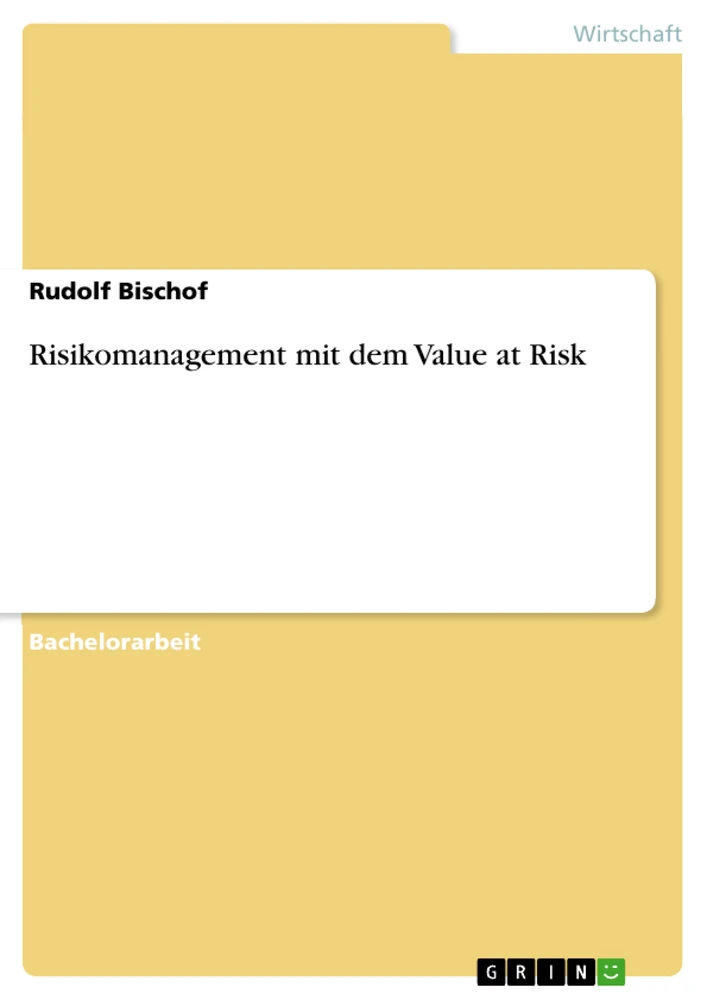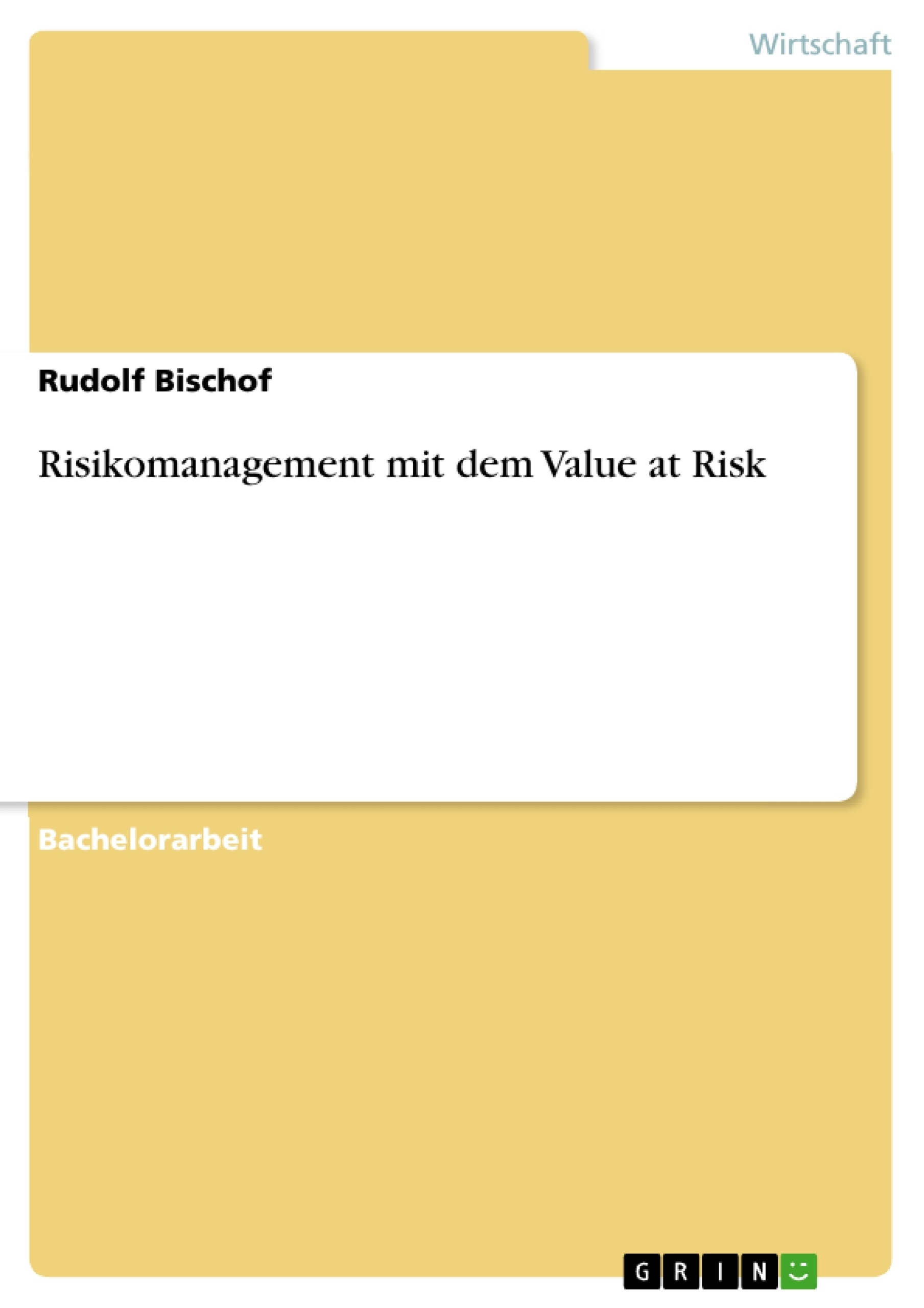Damit ein Unternehmen Gewinne erwirtschaftet muss es auch Risiken eingehen. Wichtig dabei ist, dass man diese Risiken richtig einschätzen kann. Das systematische Risikomanagement wird immer wichtiger. Es soll Gefahren abwehren und gleichzeitig die Chancen nutzen. Für börsennotierte Unternehmen wurde 1998 das KonTraG (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich) eingeführt. Es soll zeigen, ob sich der Vorstand bei einer Unternehmenskrise pflichtgemäß verhalten hat. Die Risikophasen sollen als ein strukturierter Prozess verstanden und protokolliert werden.
In dieser Arbeit werde ich einige Risikoarten erläutern und den Prozess des Risikomanagements darstellen. Der Hauptteil meiner Arbeit fokussiert sich auf die Risikoquantifizierung mit dem Value at Risk (im folgenden VaR genannt) und die Überprüfung seiner Güte. Der VaR ist eine Kennzahl, die den möglichen Verlust einer Position (z.B. Aktien) auf die stets ein Risiko einwirkt misst. Seit den achtziger Jahren, in denen sich das Volumen der Finanzderivaten permanent erhöht hat, sind die gängigen Risikokennzahlen nicht mehr aktuell und anwendbar. Der Markt benötigte eine Kennzahl, um diese Risiken besser prognostizieren zu können. Die Standardrisikomaße die z.B. nur den Grad der Abweichung um den Mittelwert quantifizieren waren nicht ausreichend.
Der VaR wurde bereits seit den Achtzigern, intern in großen Gesellschaften angewandt. Als erstes hat die Investmentbank Morgan Stanley den Value at Risk im „Risk Matrix“ der Öffentlichkeit vorgestellt, um die Marktrisiken einfacher zu interpretieren. Seinen Höhepunkt erlebte der VaR 1998, bedingt durch die gesetzliche Eigenkapitalunterlegung, auf Basis des VaR durch Basel 2 für Kreditinstitute. Auslöser für diese Regulierung waren unter anderem die immer höher werdenden Verluste aus Termingeschäften wie z.B. der Barings Investmentbank, die mit einen Verlust von über 1,5 Mrd. DM aus Aktienindextermingeschäften Bankrott anmelden mussten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Risikomanagement
- Risikoarten
- Phasen des Risikomanagement
- Risikoidentifikation
- Risikoquantifizierung
- Risikosteuerung
- Risikokontrolle
- Risikomessung mit dem Value at Risk (VaR)
- Definition des Value at Risk
- Statistische Hintergründe
- Modellparameter
- Halteperiode
- Konfidenzniveau
- Vorteile des Value at Risk
- Methoden zur Berechnung des Value at Risk
- Varianz-Kovarianz-Methode
- Delta-Normal-Ansatz
- Anwendung des Delta-Normal-Ansatzes
- Delta-Gamma-Ansatz
- Vor- und Nachteile der Varianz-Kovarianz-Methode
- Historische Simulation
- Anwendung der historischen Simulation
- Vor- und Nachteile der historischen Simulation
- Monte-Carlo-Simulation
- Anwendung der Monte-Carlo-Simulation
- Vor- und Nachteile der Monte-Carlo-Simulation
- Anwendung des VaR in dem Risikomanagement Prozess
- Kritik an dem VaR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Risikomanagement, insbesondere die Risikoquantifizierung mithilfe des Value at Risk (VaR). Ziel ist es, den VaR als Kennzahl zur Messung potenzieller Verluste in Finanzpositionen zu erläutern und verschiedene Berechnungsmethoden zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet zudem die Bedeutung des Risikomanagements im Kontext gesetzlicher Vorgaben.
- Einführung in das Risikomanagement und verschiedene Risikoarten
- Definition und Berechnung des Value at Risk (VaR)
- Vergleich verschiedener Methoden zur VaR-Berechnung (Varianz-Kovarianz-Methode, historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation)
- Integration des VaR in den Risikomanagementprozess
- Bewertung der Vor- und Nachteile des VaR
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Risikomanagements ein und erläutert die Bedeutung des VaR als Risikomaßzahl, insbesondere vor dem Hintergrund der gestiegenen Bedeutung von Finanzderivaten und gesetzlicher Regulierungen wie dem KonTraG. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und hebt die zentrale Rolle der Risikoquantifizierung mit dem VaR hervor. Der Bezug zu historischen Verlustereignissen wie dem Fall der Barings Bank unterstreicht die Notwendigkeit eines robusten Risikomanagements.
Risikomanagement: Dieses Kapitel definiert Risikomanagement allgemein als unternehmerisches Handeln unter Unsicherheitsbedingungen. Es beschreibt verschiedene Risikoarten, wie Kredit-, Operations-, Geschäfts- und Marktrisiken, und hebt die Bedeutung des Marktrisikos im Kontext der Arbeit hervor. Der Fokus liegt auf der systematischen Identifizierung und Bewältigung von Risiken, um sowohl Gefahren abzuwehren als auch Chancen zu nutzen. Das Kapitel betont, dass Risikomanagement nicht nur Compliance-orientiert sein sollte, sondern auch die Chancenfindung aktiv unterstützen muss.
Risikomessung mit dem Value at Risk (VaR): Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Value at Risk (VaR), seiner Definition und den statistischen Grundlagen seiner Berechnung. Es erläutert wichtige Modellparameter wie die Halteperiode und das Konfidenzniveau und diskutiert die Vorteile des VaR im Vergleich zu anderen traditionellen Risikomaßen. Das Kapitel legt den Grundstein für die detaillierte Betrachtung der verschiedenen Berechnungsmethoden in den folgenden Kapiteln.
Methoden zur Berechnung des Value at Risk: Dieses Kapitel beschreibt detailliert verschiedene Methoden zur Berechnung des VaR, darunter die Varianz-Kovarianz-Methode (inkl. Delta-Normal- und Delta-Gamma-Ansatz), die historische Simulation und die Monte-Carlo-Simulation. Für jede Methode werden die Anwendungsweise, die Vor- und Nachteile im Detail erläutert. Der Vergleich der Methoden erlaubt eine fundierte Beurteilung der jeweiligen Eignung für unterschiedliche Anwendungsszenarien.
Anwendung des VaR in dem Risikomanagement Prozess: Dieses Kapitel beschreibt die praktische Anwendung des VaR innerhalb des Risikomanagementprozesses. Es beleuchtet, wie die VaR-Berechnung in die einzelnen Phasen des Risikomanagements (Identifikation, Quantifizierung, Steuerung, Kontrolle) integriert wird und wie die Ergebnisse zur Risikosteuerung und -kontrolle genutzt werden können. Es wird auf die Einstufung von Risiken (kritische, wichtige Risiken) basierend auf dem VaR eingegangen.
Schlüsselwörter
Risikomanagement, Value at Risk (VaR), Risikoquantifizierung, Marktrisiko, Varianz-Kovarianz-Methode, Historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation, Risikokapital, KonTraG, Basel II.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Risikomessung mit Value at Risk (VaR)
Was ist der Inhalt dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Risikomanagement und konzentriert sich insbesondere auf die Risikoquantifizierung mithilfe des Value at Risk (VaR). Sie erläutert den VaR als Kennzahl zur Messung potenzieller Verluste in Finanzpositionen, analysiert verschiedene Berechnungsmethoden und beleuchtet die Bedeutung des Risikomanagements im Kontext gesetzlicher Vorgaben. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Risikomanagement, VaR-Definition und -Berechnung, verschiedene VaR-Berechnungsmethoden (Varianz-Kovarianz-Methode, historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation), die Anwendung des VaR im Risikomanagementprozess und eine abschließende Kritik am VaR.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Einführung in das Risikomanagement und verschiedene Risikoarten; Definition und Berechnung des Value at Risk (VaR); Vergleich verschiedener Methoden zur VaR-Berechnung (Varianz-Kovarianz-Methode, historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation); Integration des VaR in den Risikomanagementprozess; Bewertung der Vor- und Nachteile des VaR.
Welche Methoden zur VaR-Berechnung werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht detailliert drei Methoden zur Berechnung des Value at Risk: die Varianz-Kovarianz-Methode (inkl. Delta-Normal- und Delta-Gamma-Ansatz), die historische Simulation und die Monte-Carlo-Simulation. Für jede Methode werden die Anwendungsweise, Vor- und Nachteile ausführlich erläutert.
Wie wird der VaR im Risikomanagementprozess angewendet?
Die Arbeit beschreibt die praktische Anwendung des VaR in den einzelnen Phasen des Risikomanagements: Identifikation, Quantifizierung, Steuerung und Kontrolle. Es wird gezeigt, wie die VaR-Berechnung in den Prozess integriert wird und wie die Ergebnisse zur Risikosteuerung und -kontrolle genutzt werden können, inklusive der Einstufung von Risiken basierend auf dem VaR.
Welche Vor- und Nachteile des VaR werden diskutiert?
Die Arbeit bewertet die Vor- und Nachteile des VaR im Detail. Dies beinhaltet sowohl die Vorteile des VaR als Risikomaßzahl im Vergleich zu traditionellen Methoden als auch die Kritikpunkte und Limitationen des VaR.
Welche gesetzlichen Vorgaben werden im Kontext der Arbeit erwähnt?
Die Arbeit erwähnt im Kontext des Risikomanagements und der Bedeutung des VaR gesetzliche Vorgaben, beispielsweise das KonTraG (Kontroll- und Transparenzgesetz) und implizit Basel II.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Risikomanagement, Value at Risk (VaR), Risikoquantifizierung, Marktrisiko, Varianz-Kovarianz-Methode, Historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation, Risikokapital, KonTraG, Basel II.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine ausführliche Zusammenfassung der einzelnen Kapitel: Einleitung, Risikomanagement, Risikomessung mit dem Value at Risk (VaR), Methoden zur Berechnung des Value at Risk und Anwendung des VaR im Risikomanagementprozess. Diese Zusammenfassungen geben einen guten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
- Arbeit zitieren
- Rudolf Bischof (Autor:in), 2010, Risikomanagement mit dem Value at Risk, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342509