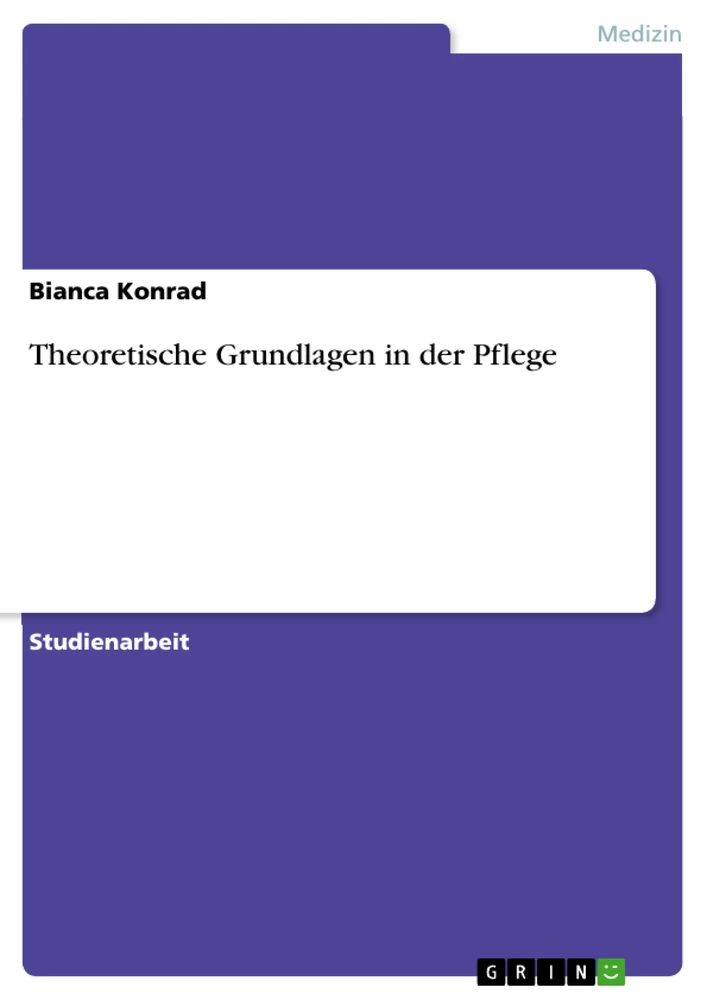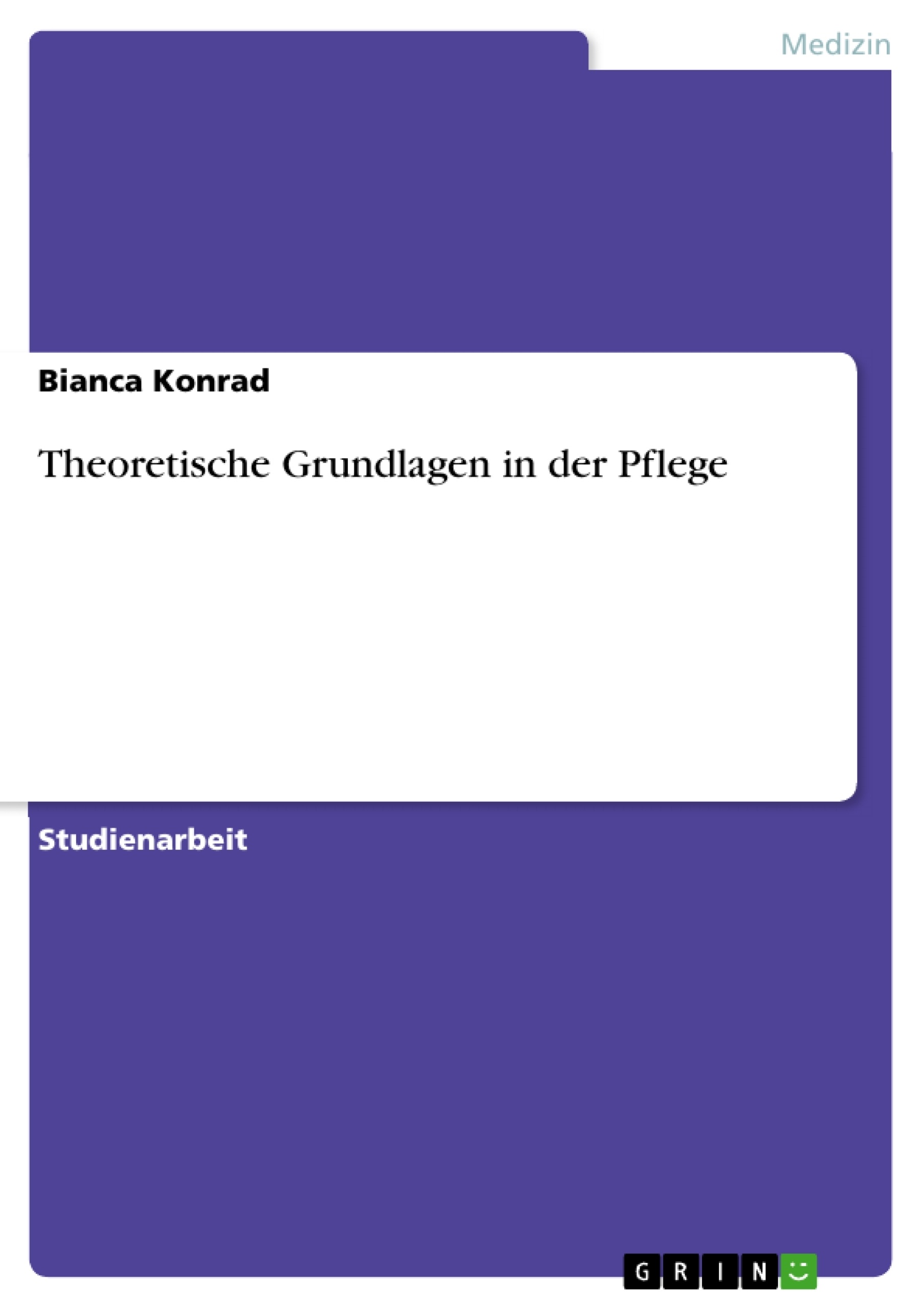Dieser Text behandelt die Grundlagen der Pflegetheorie.
Aus dem Text:
-Was ist unter einer Theorie zu verstehen;
-Was sind die Unterschiede zwischen Konzept, Modell und Theorie;
-Die globale Theorie am Beispiel Orem;
-Gründe für die weitere Theorieentwicklung
Inhaltsverzeichnis
- Was ist unter einer Theorie zu verstehen?
- Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen einem Konzept, einem Modell und einer Theorie?
- Was versteht man unter Theorienpluralismus? Was ist der überwiegende Konsens darüber?
- Beschreibung und Betrachtung einer globalen Theorie am Beispiel Orem.
- Welchen Zweck erfüllten globale Theorien und welche Hauptkritikpunkte werden in der Literatur genannt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht verschiedene Aspekte von Theorien in der Pflegewissenschaft. Sie beleuchtet die Definition und Abgrenzung von Konzepten, Modellen und Theorien, diskutiert den Theorienpluralismus in der Pflege und analysiert eine globale Theorie am Beispiel von Orems Selbstpflegedefizit-Theorie.
- Definition und Abgrenzung von Theorie, Konzept und Modell in der Pflege.
- Der Theorienpluralismus in der Pflegewissenschaft und der Konsens darüber.
- Analyse von Orems Selbstpflegedefizit-Theorie: Anwendung, Stärken und Schwächen.
- Zweck und Kritik an globalen Theorien in der Pflege.
- Entwicklung der Pflegetheorien im historischen Kontext.
Zusammenfassung der Kapitel
Was ist unter einer Theorie zu verstehen?: Der Text beginnt mit der etymologischen Bedeutung des Wortes "Theorie" und beleuchtet verschiedene Definitionen aus der Literatur. Es wird herausgestellt, dass es kein einheitliches wissenschaftliches Verständnis von Theorie gibt, aber dennoch einheitliche Kriterien wie logische Konsistenz, Informativität und Überprüfbarkeit erfüllt sein müssen. Der Abschnitt legt den Grundstein für das Verständnis von Theorien in der Pflege.
Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen einem Konzept, einem Modell und einer Theorie?: Dieser Abschnitt differenziert zwischen Konzept, Modell und Theorie. Konzepte werden als abstrakte Verallgemeinerungen von beobachtbaren Sachverhalten definiert, die die kleinsten Bausteine einer Theorie bilden. Modelle werden als vereinfachte Darstellungen tatsächlicher Sachverhalte beschrieben, die leichter verständlich sind. Theorien hingegen werden als miteinander in Beziehung stehende Konzepte dargestellt, die ein prognostisches Potential besitzen. Der Text hebt die unterschiedliche Verwendung der Begriffe Modell und Theorie hervor und illustriert dies anhand von Beispielen aus der Literatur.
Was versteht man unter Theorienpluralismus? Was ist der überwiegende Konsens darüber?: Dieser Abschnitt behandelt den Theorienpluralismus in der Pflege. Er beschreibt die historische Entwicklung von einem anfänglichen Bestreben nach einer einheitlichen Pflegetheorie hin zu einer Akzeptanz des Pluralismus, begründet durch das Fehlen einer einheitlichen Theorie in Medizin und Sozialwissenschaften. Der Text betont jedoch, dass trotz des konsensuellen Verständnisses des Theorienpluralismus, im klinischen Alltag oft noch das Bild einer einheitlichen Theorie dominiert.
Beschreibung und Betrachtung einer globalen Theorie am Beispiel Orem.: Dieser Abschnitt analysiert Orems Selbstpflegedefizit-Theorie. Die Theorie wird als allgemeine Theorie der Pflege beschrieben, die die Selbstpflegefähigkeit des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Ihre Anwendung in der Langzeitpflege wird diskutiert, wobei sowohl Stärken (Empowerment des Patienten) als auch Schwächen (starke Defizitorientierung) hervorgehoben werden. Der Text erwähnt die Notwendigkeit einer individuellen Anpassung der Theorie und vergleicht sie mit dem Modell Krohwinkels.
Welchen Zweck erfüllten globale Theorien und welche Hauptkritikpunkte werden in der Literatur genannt?: Der letzte Abschnitt beschreibt den Zweck globaler Theorien in der Pflege, nämlich die Emanzipation der Pflegewissenschaft von anderen Disziplinen. Er erwähnt die anfängliche Suche nach einer einheitlichen Theorie und die Kritik an globalen Theorien, die oft als zu abstrakt und wenig praxisrelevant angesehen werden. Die Entwicklung hin zu Theorien mittlerer Reichweite und praxisnahen Theorien wird als wichtiger Schritt in der Entwicklung der Pflegewissenschaft hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Pflegetheorie, Konzept, Modell, Theorienpluralismus, Selbstpflegedefizit-Theorie (Orem), globale Theorien, Pflegewissenschaft, Praxisrelevanz, Handlungsautonomie, Defizitorientierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Theorien in der Pflegewissenschaft
Was ist der Inhalt dieser Ausarbeitung?
Diese Ausarbeitung bietet einen umfassenden Überblick über Theorien in der Pflegewissenschaft. Sie umfasst eine Definition und Abgrenzung von Konzepten, Modellen und Theorien, eine Diskussion des Theorienpluralismus, eine Analyse der Selbstpflegedefizit-Theorie nach Orem und eine Betrachtung des Zwecks und der Kritik an globalen Theorien. Zusätzlich werden die Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter bereitgestellt.
Was wird unter einer Theorie in der Pflegewissenschaft verstanden?
Die Ausarbeitung beleuchtet verschiedene Definitionen von "Theorie" aus der Literatur und betont, dass es keine einheitliche wissenschaftliche Definition gibt. Jedoch müssen Kriterien wie logische Konsistenz, Informativität und Überprüfbarkeit erfüllt sein. Der Text differenziert zwischen Theorie, Konzept und Modell.
Wie unterscheiden sich Konzept, Modell und Theorie?
Konzepte werden als abstrakte Verallgemeinerungen von beobachtbaren Sachverhalten definiert. Modelle sind vereinfachte Darstellungen, die leichter verständlich sind. Theorien hingegen bestehen aus miteinander verbundenen Konzepten mit prognostischem Potential.
Was bedeutet Theorienpluralismus in der Pflege und was ist der Konsens dazu?
Der Theorienpluralismus beschreibt die Akzeptanz verschiedener Pflegetheorien. Die Ausarbeitung erklärt die historische Entwicklung von dem Wunsch nach einer einheitlichen Theorie hin zum Pluralismus, begründet durch das Fehlen einer solchen in Medizin und Sozialwissenschaften. Trotz des Konsenses dominiert im klinischen Alltag oft noch das Bild einer einheitlichen Theorie.
Wie wird Orems Selbstpflegedefizit-Theorie analysiert?
Die Ausarbeitung analysiert Orems Theorie als globale Theorie, die die Selbstpflegefähigkeit des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Ihre Anwendung in der Langzeitpflege wird diskutiert, inklusive Stärken (Empowerment) und Schwächen (starke Defizitorientierung). Die Notwendigkeit einer individuellen Anpassung und ein Vergleich mit dem Modell Krohwinkels werden erwähnt.
Welchen Zweck haben globale Theorien und welche Kritikpunkte gibt es?
Globale Theorien sollen die Pflegewissenschaft von anderen Disziplinen emanzipieren. Die Ausarbeitung beschreibt die anfängliche Suche nach einer einheitlichen Theorie und die Kritik an globalen Theorien als zu abstrakt und wenig praxisrelevant. Die Entwicklung hin zu Theorien mittlerer Reichweite und praxisnahen Theorien wird als wichtiger Fortschritt hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter umfassen: Pflegetheorie, Konzept, Modell, Theorienpluralismus, Selbstpflegedefizit-Theorie (Orem), globale Theorien, Pflegewissenschaft, Praxisrelevanz, Handlungsautonomie, Defizitorientierung.
- Quote paper
- Bianca Konrad (Author), 2016, Theoretische Grundlagen in der Pflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342463