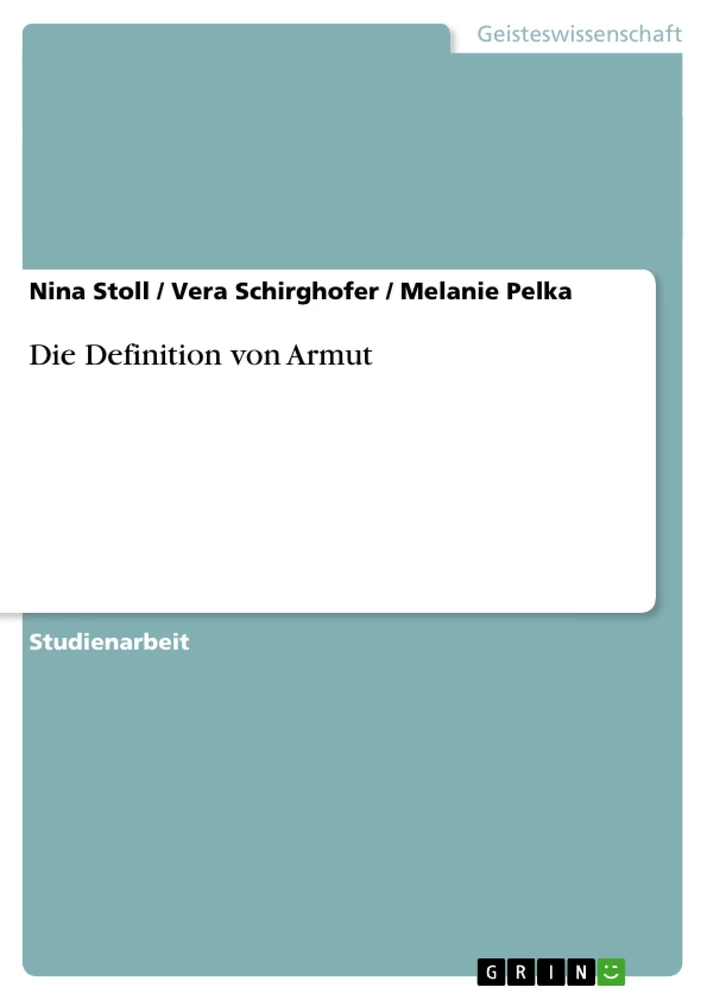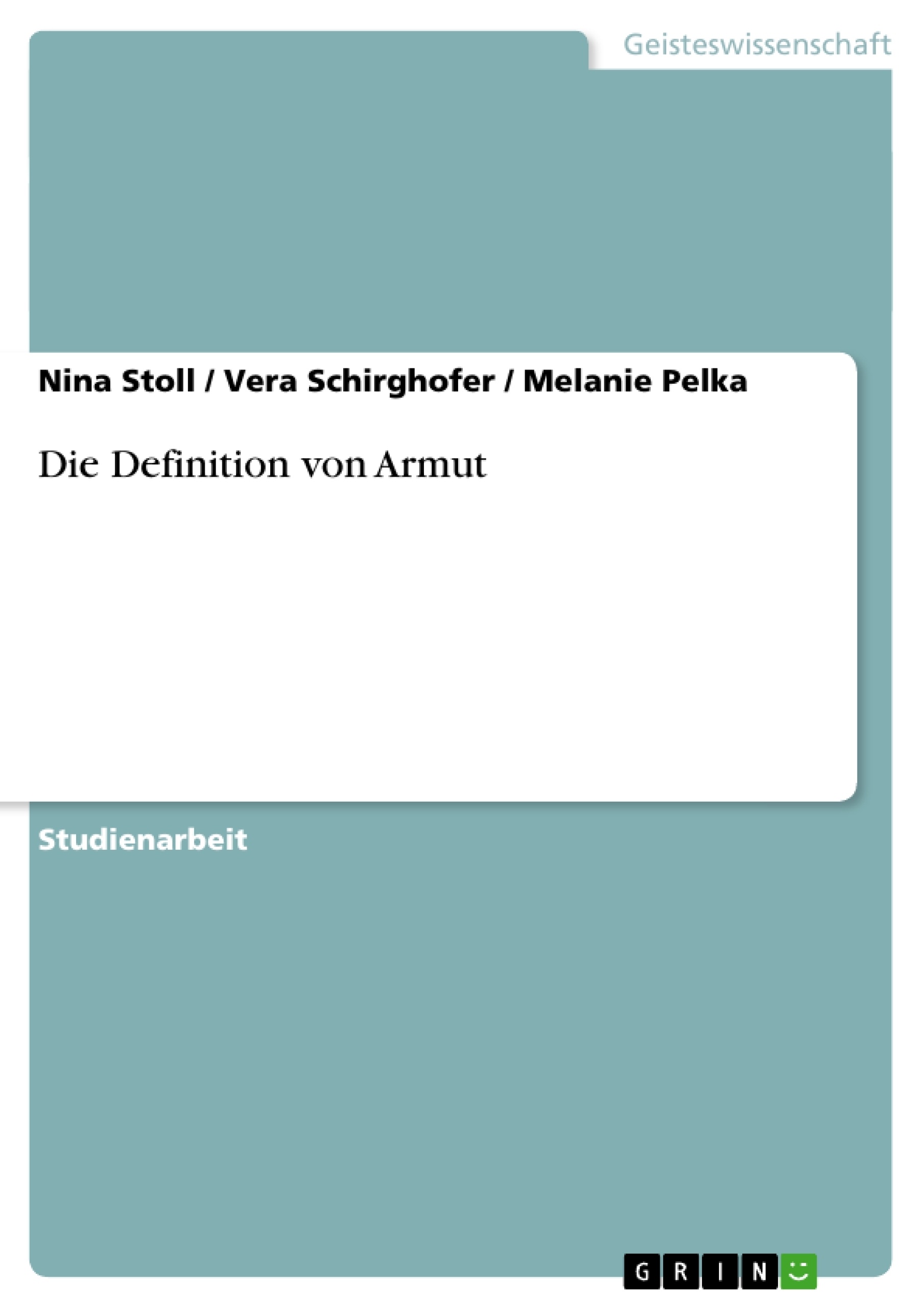In den letzten Jahren hat man in der öffentlichen Diskussion in Deutschland aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs den Eindruck, es würde „uns“ immer schlechter gehen und wir würden alle verarmen. Die steigende Zahl Arbeitsloser und Sozialhilfeempfänger trägt ein Übriges dazu bei. Doch die Frage, wann eine Person oder gar eine Gesellschaft als arm zu bezeichnen ist, ist nicht einfach zu beantworten. Dieses Referat soll daher versuchen einen Einblick in die Armutsdefinition und die Armutsforschung zu geben. Hierbei soll vor allem auf drei Aspekte eingegangen werden. Zum einen wäre da der Aspekt der räumlichen und zeitlichen Bedingung von Armut zu nennen. Dieser bedeutet, dass Armut von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich ausgelegt wird, in Entwicklungsländern versteht man daher etwas anderes unter Armut als in Industrieländern, wie es zum Bespiel in Deutschland der Fall ist. Außerdem verändert sich das Verständnis von Armut von Zeit zu Zeit, so dass sich die Definition an die gesellschaftlichen Veränderungen anpasst.
Ein weiterer Aspekt auf den wir eingehen möchten, ist Armut als ein relatives Problem. In Deutschland ist nicht die Frage des Überlebens entscheidend, sondern die Frage des menschenwürdigen Lebens. Armut steht also in Relation zu gesamtgesellschaftlichen Lebensgewohnheiten. Der dritte hier zu nennende Aspekt ist, dass Armut ein umfassender Begriff ist, es also nicht nur um monetäre Ressourcen (Mindesteinkommen) geht, sondern auch um Unterversorgung in zentralen Bereichen wie Bildung und Gesundheit. Des weiteren werden wir die verschiedenen Ansätze der Messung von Armut vorstellen, bevor wir uns den Risikogruppen, welche von Armut betroffen sein können, und die psychischen Auswirkungen auf diese zuwenden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition
- Absolute Armut
- Relative Armut
- Sichtbare Armut: Wohnungs- und Obdachlosigkeit
- Obdachlosigkeit
- Manifeste (Offene) Obdachlosigkeit
- Latente (Verdeckte) Obdachlosigkeit
- Wohnungslosigkeit
- Obdachlosigkeit
- Ansätze zur Messung
- Ressourcenansatz
- Lebenslagenansatz
- Bekämpfte und Verdeckte Armut
- Sozialhilfe
- Bekämpfte Armut
- Verdeckte Armut
- Risikogruppen in der Gesellschaft
- Alleinerziehende
- Kinderreiche Familien
- Kinder und Jugendliche
- Ausländer
- Arbeitslose
- Working poor
- Psychische und soziale Auswirkungen der Armut
- Kinder- und Jugendliche
- Langzeitarbeitslose
- Obdachlose und Wohnungslose
- Armutsbilder
- Armut als dauerhafte Lebenslage
- Armut als Einzelschicksal
- Neue Armut
- Verzeitlichte Armut
- Wachsende Armutskluft
- Zunehmende Polarisierung zwischen Arm und Reich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat befasst sich mit der Definition von Armut und bietet einen Einblick in die Armutsforschung. Es fokussiert sich auf drei zentrale Aspekte: die räumliche und zeitliche Bedingung von Armut, die Relativität des Begriffs und die umfassende Natur von Armut, die über monetäre Ressourcen hinausgeht. Darüber hinaus werden verschiedene Ansätze zur Messung von Armut vorgestellt, bevor Risikogruppen und die psychischen Auswirkungen auf diese beleuchtet werden.
- Definition von Armut und ihre Relativität
- Messung von Armut und unterschiedliche Ansätze
- Risikogruppen in der Gesellschaft, die von Armut betroffen sind
- Psychische und soziale Auswirkungen der Armut auf verschiedene Gruppen
- Verschiedene Perspektiven und Bilder von Armut
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Armut ein und stellt die Relevanz des Themas in der heutigen Gesellschaft dar. Das Kapitel „Begriffsdefinition“ erläutert die Unterscheidung zwischen absoluter und relativer Armut. Anschließend wird das Thema der „Sichtbaren Armut: Wohnungs- und Obdachlosigkeit“ behandelt, wobei verschiedene Formen der Obdachlosigkeit und die Ursachen ihrer Entstehung beleuchtet werden.
Das Kapitel „Ansätze zur Messung“ beschreibt verschiedene Methoden zur Messung von Armut, darunter der Ressourcenansatz, der Lebenslagenansatz und die Unterscheidung zwischen bekämpfter und verdeckter Armut. Im Anschluss werden „Risikogruppen in der Gesellschaft“ untersucht, die besonders von Armut betroffen sind, wie z.B. Alleinerziehende, kinderreiche Familien, Kinder und Jugendliche, Ausländer, Arbeitslose und Working poor.
Schließlich werden die „Psychischen und sozialen Auswirkungen der Armut“ auf verschiedene Gruppen diskutiert. Dabei werden die Folgen von Armut für Kinder und Jugendliche, Langzeitarbeitslose und Obdachlose und Wohnungslose betrachtet.
Schlüsselwörter
Armut, absolute Armut, relative Armut, Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit, Risikogruppen, Sozialhilfe, Messung, Lebenslagenansatz, Ressourcenansatz, Auswirkungen, Armutsbilder, Polarisierung, Ungleichheit.
- Quote paper
- Nina Stoll (Author), Vera Schirghofer (Author), Melanie Pelka (Author), 2005, Die Definition von Armut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34215