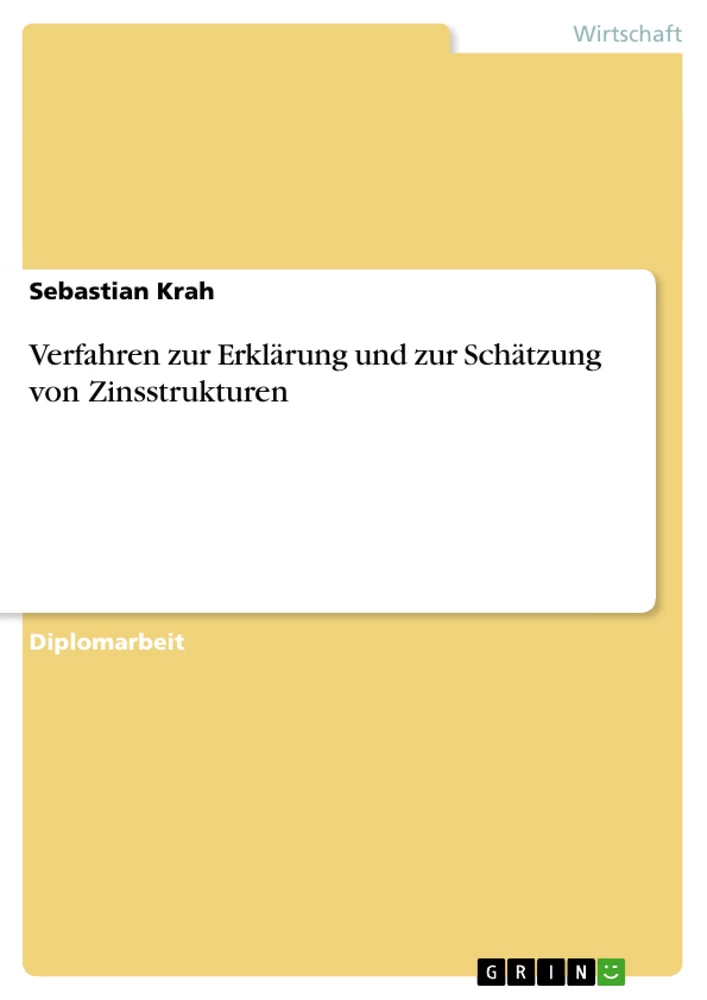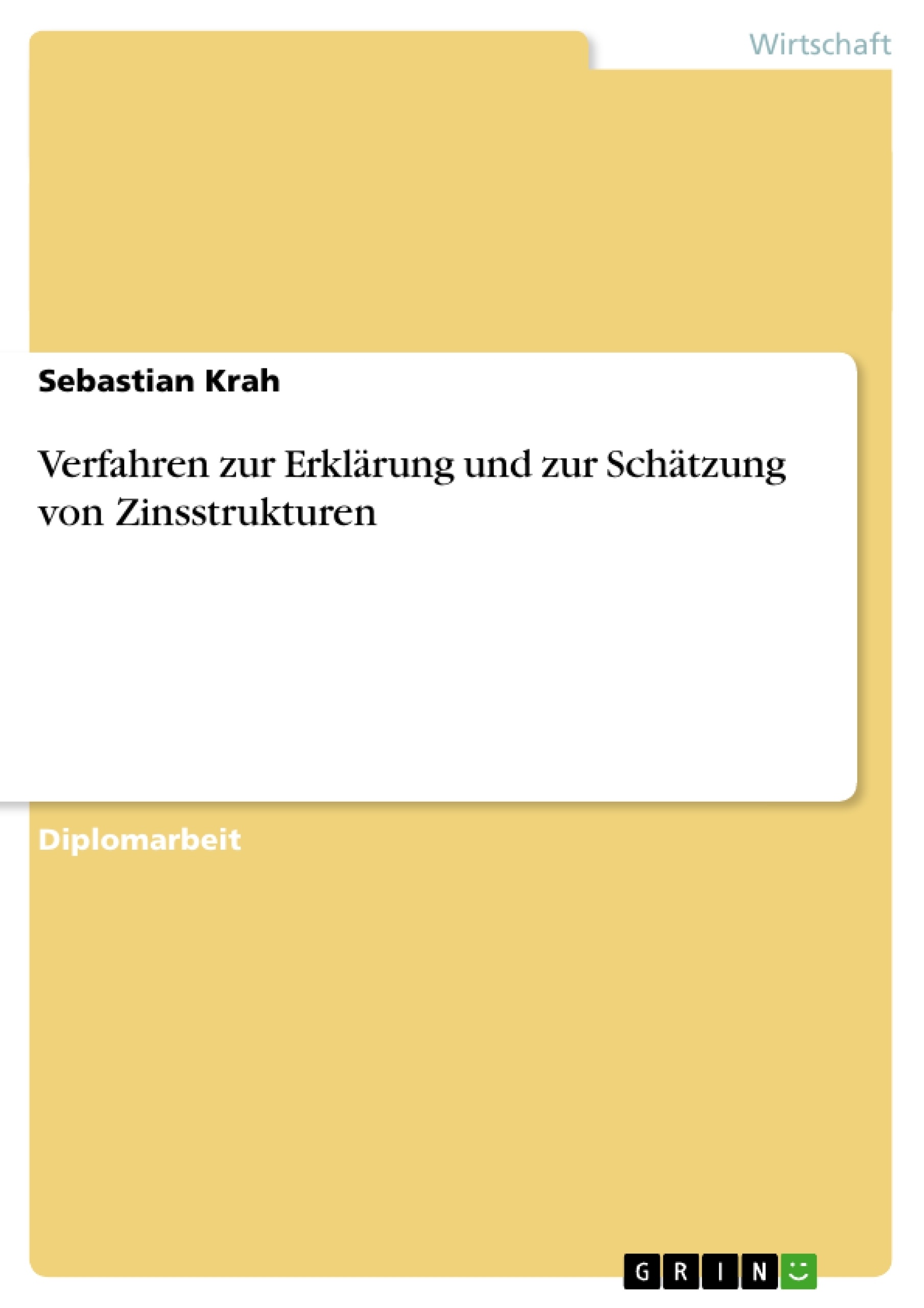In volkswirtschaftlichen Modellen sowie in betriebswirtschaftlichen Theorien, so z. B. in der Investitionstheorie und im Bondmanagement, wird zur Modellbeschreibung bzw. als Basis für Berechnungen oftmals ein einziger „Marktzinssatz“ zu Grunde gelegt. Die Unterstellung eines solchen Zinssatzes widerspricht jedoch empirischen Beobachtungen, nach denen sich auf den Geld-, Kapital- und Kreditmärkten verschiedene Zinssätze für unterschiedliche Anlagezeiträume, Bonitäten der Emittenten und andere Merkmale feststellen lassen.
Insbesondere der Zusammenhang zwischen der Verzinsung von festverzinslichen Wertpapieren und deren Laufzeiten ist in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung von steigendem Interesse. Kenntnisse über diesen Zusammenhang, als Fristigkeitsstruktur der Zinssätze oder auch Zinsstruktur bezeichnet, bieten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis.
Ein Einsatzgebiet stellt die Bewertung von zinsabhängigen Finanztiteln, u. a. von Kuponanleihen, dar. In einfachen Barwertberechnungen wird zur Ermittlung des arbitragefreien Preises eines Bonds eine nicht realistische flache Zinsstrukturkurve unterstellt. Bei Kenntnis der Zinsstruktur kann der Wert von Anleihen mittels einer modifizierten Barwertformel unter Verwendung periodenspezifischer Zinssätze wesentlich exakter bestimmt werden.
Im Bereich des Bondmanagements eröffnet sich ein weiteres Anwendungsgebiet hinsichtlich verbesserter Immunisierungsstrategien von Portfolios festverzinslicher Wertpapiere gegen Zinsänderungsrisiken. Während das gewöhnliche Konzept der Duration ebenfalls eine flache Zinsstrukturkurve voraussetzt, sind auf komplexeren Annahmen beruhende Durationsmodelle in der Lage, die zeitliche Entwicklung nichtflacher Zinsstrukturen zu berücksichtigen. Es lassen sich daher genauere Aussagen bezüglich des Zinsänderungsrisikos von Anleihen treffen und Strategien zur verbesserten Immunisierung von Portfolios erarbeiten.
Geschäftsbanken haben in ihrer Funktion als Finanzintermediär u. a. die Aufgabe der Fristentransformation zu erfüllen. Durch Fristeninkongruenzen zwischen Aktiv- und Passivgeschäft entstehen Zinsänderungsrisiken, die eine Prognose der zukünftigen Zinsentwicklung notwendig machen. Diesem Zweck können Zinsstrukturschätzungen dienen. Sie ermöglichen Banken weiterhin, sich mittels dieser Informationen entdeckte Ineffizienzen auf den Kapitalmärkten zur Erzielung von Überschussrenditen nutzbar zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Relevanz der Thematik
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretische Ansätze zur Erklärung der Zinsstruktur
- 2.1 Grundlagen der Zinsstrukturtheorie
- 2.1.1 Definition und Eigenschaften der Zinsstruktur
- 2.1.2 Zinssätze und Risiken der Anlage
- 2.2 Die traditionelle Erwartungstheorie
- 2.3 Neuere erwartungstheoretische Modelle
- 2.3.1 Die modifizierte Erwartungstheorie von Lutz
- 2.3.2 Das Normalintervallmodell von Malkiel
- 2.4 Die Liquiditätsprämientheorie
- 2.5 Die allgemeine Präferenztheorie
- 2.6 Die Marktsegmentationshypothese
- 2.7 Die Preferred Habitat Theory
- 2.8 Zeitstetige Gleichgewichtsmodelle
- 2.8.1 Das Modell von Vasicek
- 2.8.2 Das Cox/Ingersoll/Ross-Modell
- 2.9 Bewertung der vorgestellten Ansätze
- 3. Verfahren zur Schätzung von Zinsstrukturen
- 3.1 Einführung
- 3.2 Das Verfahren von Carleton und Cooper
- 3.3 Approximation der Zinsstruktur durch ein Polynom
- 3.3.1 Das Verfahren von Chambers, Carleton und Waldman
- 3.3.2 Das Verfahren von Schaefer
- 3.4 Schätzung der Zinsstruktur durch Splines
- 3.4.1 Approximation durch quadratische Splines
- 3.4.2 Approximation mittels kubischer oder polynomialer Splines
- 3.4.3 Schätzung der Zinsstruktur durch exponentielle Splines
- 3.4.4 Anwendung von B-Splines bei der Zinsstrukturschätzung
- 3.4.5 Approximation der Zinsstruktur durch glättende Splines
- 3.5 Zinsstrukturschätzungen mittels parametrischer Verfahren
- 3.5.1 Das Verfahren von Echols und Elliot
- 3.5.2 Das Verfahren von Nelson und Siegel
- 3.5.3 Das Svensson-Verfahren
- 3.6 Beurteilung der Schätzverfahren
- 4. Untersuchung europäischer Zinsstrukturen
- 4.1 Schätzmethoden der Zentralbanken
- 4.2 Annahmen über europäische Zinsstrukturen
- 4.3 Datenbasis und -bearbeitung
- 4.4 Interpretation und Analyse der Ergebnisse
- 4.5 Kritische Würdigung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Erläuterung und Schätzung von Zinsstrukturen. Sie analysiert verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung der Zinsstruktur und präsentiert Verfahren zur Schätzung von Zinsstrukturen. Darüber hinaus untersucht die Arbeit europäische Zinsstrukturen und analysiert die Schätzmethoden, die von Zentralbanken angewandt werden.
- Theoretische Ansätze zur Erklärung der Zinsstruktur
- Verfahren zur Schätzung von Zinsstrukturen
- Untersuchung europäischer Zinsstrukturen
- Schätzmethoden der Zentralbanken
- Datenbasis und -bearbeitung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt die Relevanz der Arbeit. Es wird der Aufbau der Arbeit erläutert.
Kapitel 2 behandelt verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung der Zinsstruktur. Es werden die Grundlagen der Zinsstrukturtheorie, die traditionelle Erwartungstheorie, neuere erwartungstheoretische Modelle, die Liquiditätsprämientheorie, die allgemeine Präferenztheorie, die Marktsegmentationshypothese, die Preferred Habitat Theory sowie zeitstetige Gleichgewichtsmodelle vorgestellt und bewertet.
Kapitel 3 befasst sich mit Verfahren zur Schätzung von Zinsstrukturen. Es werden verschiedene Ansätze, wie das Verfahren von Carleton und Cooper, die Approximation der Zinsstruktur durch ein Polynom, die Schätzung der Zinsstruktur durch Splines, und Zinsstrukturschätzungen mittels parametrischer Verfahren, vorgestellt und beurteilt.
Kapitel 4 untersucht europäische Zinsstrukturen. Es werden Schätzmethoden der Zentralbanken, Annahmen über europäische Zinsstrukturen, die Datenbasis und -bearbeitung sowie die Interpretation und Analyse der Ergebnisse vorgestellt.
Schlüsselwörter
Zinsstruktur, Zinsstrukturtheorie, Erwartungstheorie, Liquiditätsprämientheorie, Marktsegmentationshypothese, Verfahren zur Schätzung von Zinsstrukturen, Splines, parametrische Verfahren, europäische Zinsstrukturen, Zentralbanken.
- Quote paper
- Sebastian Krah (Author), 2003, Verfahren zur Erklärung und zur Schätzung von Zinsstrukturen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34205