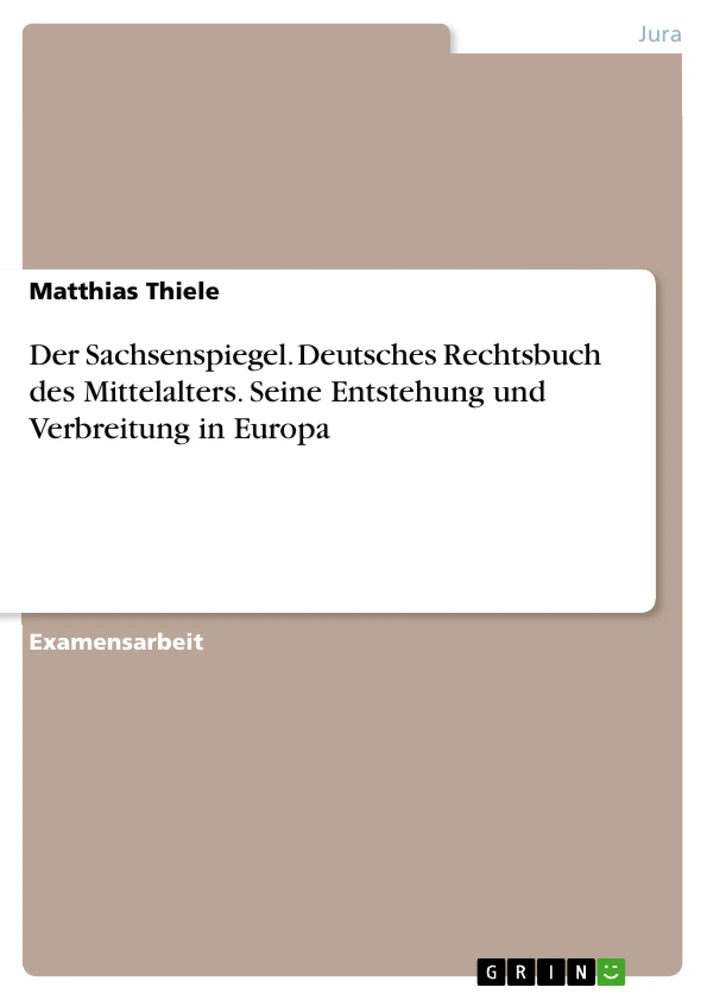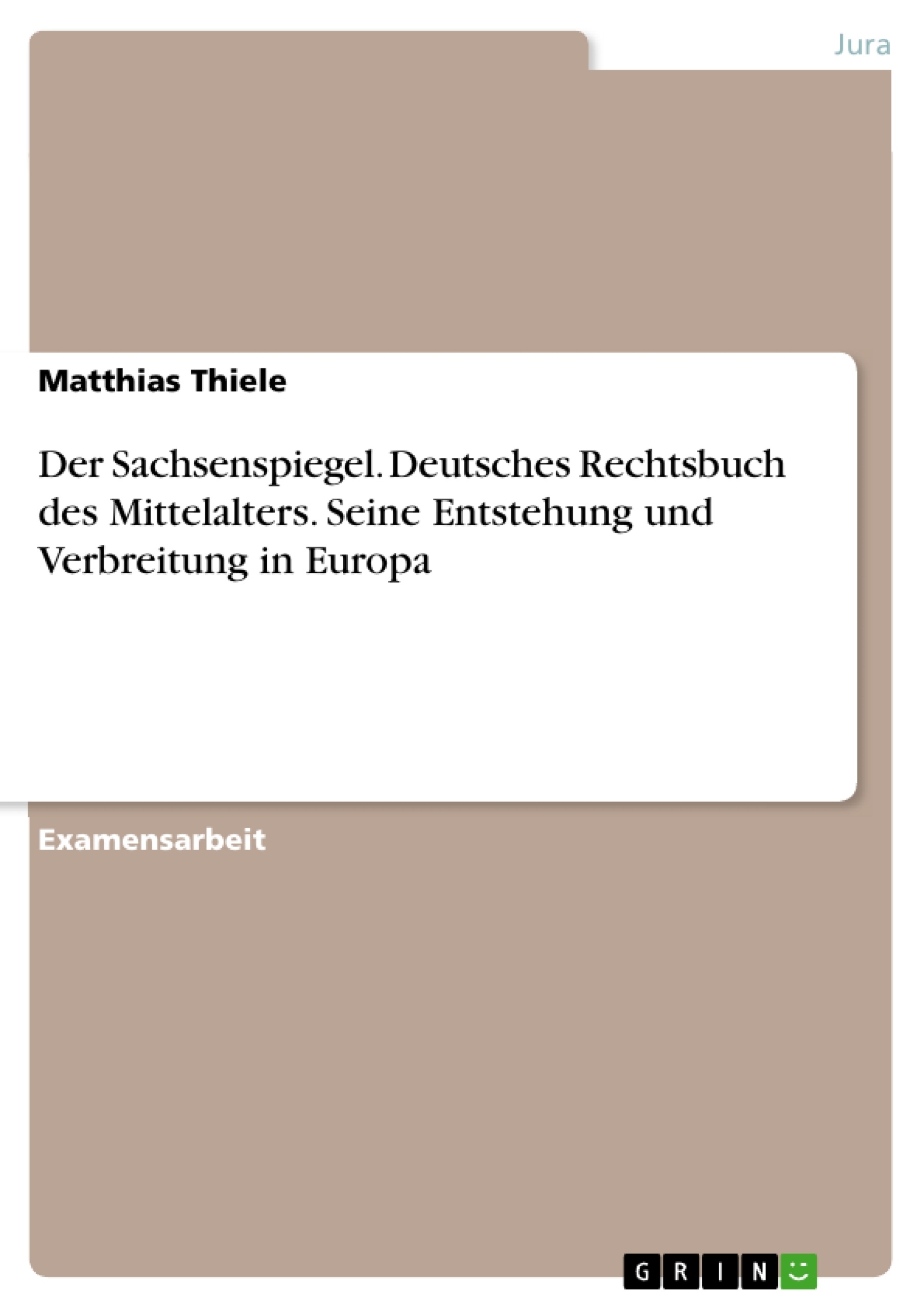Der Sachsenspiegel ist das einflussreichste deutsche Rechtsbuch des Hochmittelalters und Urbild einer ganzen Quellengattung. Diese Arbeit fasst Erkenntnisse und Probleme der Forschung in Bezug auf die Entstehung und Verbreitung insbesondere des Sachsenspiegels, aber auch des Magdeburger Rechts und der anderen Rechtsbücher (Deutschenspiegel, Schwabenspiegel) zusammen. Aufbau und Inhalt des Sachsenspiegels werden dagegen nur dann thematisiert, wenn dies für die die Bewertung einzelner Fragen notwendig ist.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung: Der geschichtliche Hintergrund
- Zeit des Umbruchs und der Schriftlichkeit
- Allgemeine Tendenzen
- Verschriftlichung des Rechts
- Der Elb-Saale-Ostharz-Raum
- Die Person Eike von Repgows
- Herkunft und Eckdaten
- Ausbildung und geistiges Umfeld
- Domschule Halberstadt
- Domschule Magdeburg
- Klosterschulen Halle
- Zisterzienser-Kloster Altzelle
- Stand Eike von Repgows
- Das Verhältnis den Großen
- Graf Hoyer von Falkenstein
- Graf Heinrich von Anhalt
- Erzbischof Albrecht II. von Magdeburg
- Zwischenfazit
- Der Sachsenspiegel
- Überlieferung
- Lateinische Urform
- Deutsche Fassung
- Entstehung
- Motivation Privatarbeit?
- Entstehungsort
- Burg Falkenstein
- Stiftsbibliothek Quedlinburg
- Zisterzienserkloster Altzelle
- Magdeburg
- Andere
- Datierung
- Aufbau und Inhalt
- Verbreitung
- 13. Jahrhundert
- Ungesicherte Einflüsse
- Verbreitung nach Osten und das Magdeburger Recht
- Norddeutschland und das Baltikum
- Niederrhein und Westeuropa
- Süddeutschland
- Entwicklung der Glosse und Verbreitung im 14./15. Jh.
- Livländischer Spiegel
- Entwicklung des polnisch-litauischen Sachsenrechts
- Südosteuropa
- Deutschland
- Glossierung
- Codici picturati
- Ausblick
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, Erkenntnisse und Probleme der Forschung zum Sachsenspiegel zusammenzufassen. Der Schwerpunkt liegt auf der Einordnung des Sachsenspiegels in den historischen Kontext seiner Entstehung und Verbreitung. Die Kapitel analysieren die Entstehung, die Struktur, die Inhalte und die Rezeption des Rechtsbuchs im Laufe der Jahrhunderte. Dabei werden wichtige historische Entwicklungen und Strömungen sowie die Rolle des Sachsenspiegels im Rechtsdiskurs des Mittelalters und der Neuzeit beleuchtet.
- Die Entstehung des Sachsenspiegels in einem Kontext des gesellschaftlichen und rechtlichen Wandels im 13. Jahrhundert.
- Die Bedeutung des Sachsenspiegels als einflussreiches Rechtsbuch im deutschen Sprachraum und dessen Verbreitung in verschiedenen Regionen Europas.
- Die Einordnung des Sachsenspiegels in die Entwicklung des Rechtsgedankens und dessen Rezeption in verschiedenen Epochen und Kulturen.
- Die Bedeutung des Sachsenspiegels für das Verständnis der Rechtsgeschichte und des Rechtsbewusstseins im deutschen Mittelalter und der Neuzeit.
- Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Sachsenspiegel und die Entwicklung der Sachsenspiegelforschung.
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Das Vorwort stellt den Sachsenspiegel als einflussreichstes deutsches Rechtsbuch des Mittelalters vor und beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen des Werks in verschiedenen Epochen.
- Einleitung: Der geschichtliche Hintergrund: Diese Einleitung stellt den historischen Kontext der Entstehung des Sachsenspiegels im frühen 13. Jahrhundert dar. Es werden die wichtigsten Veränderungen in der Gesellschaft, der Politik und der Rechtskultur des 12. Jahrhunderts und die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Rechtssprechung und die Rechtsfindung beleuchtet.
- Die Person Eike von Repgows: Dieses Kapitel bietet eine biographische Darstellung Eike von Repgows, des vermeintlichen Verfassers des Sachsenspiegels. Es geht auf seine Herkunft, seine Ausbildung und seine Stellung im gesellschaftlichen Kontext ein, sowie auf seine Beziehungen zu einflussreichen Persönlichkeiten seiner Zeit.
- Der Sachsenspiegel: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung, der Überlieferung, dem Aufbau und dem Inhalt des Sachsenspiegels. Es werden wichtige Fragen zur Entstehung des Rechtsbuches, wie beispielsweise die Motivation der Entstehung und der genaue Entstehungsort, beleuchtet. Außerdem wird der Inhalt des Sachsenspiegels in seinen wichtigsten Teilen vorgestellt.
- Verbreitung: Dieses Kapitel untersucht die Verbreitung des Sachsenspiegels im 13. Jahrhundert und die Entwicklungen in der Rezeption des Werks im 14. und 15. Jahrhundert. Es zeigt auf, wie der Sachsenspiegel in verschiedenen Regionen Europas rezipiert wurde und welche Auswirkungen er auf die lokale Rechtsentwicklung hatte.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter im Kontext des Sachsenspiegels sind: Rechtsgeschichte, Deutsches Recht, Sachsenspiegel, Eike von Repgow, Gewohnheitsrecht, Kanonisches Recht, Rechtskultur, Mittelalter, Rechtsentwicklung, Rezeption, Verbreitung, Forschung.
- Quote paper
- Matthias Thiele (Author), 2016, Der Sachsenspiegel. Deutsches Rechtsbuch des Mittelalters. Seine Entstehung und Verbreitung in Europa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341849