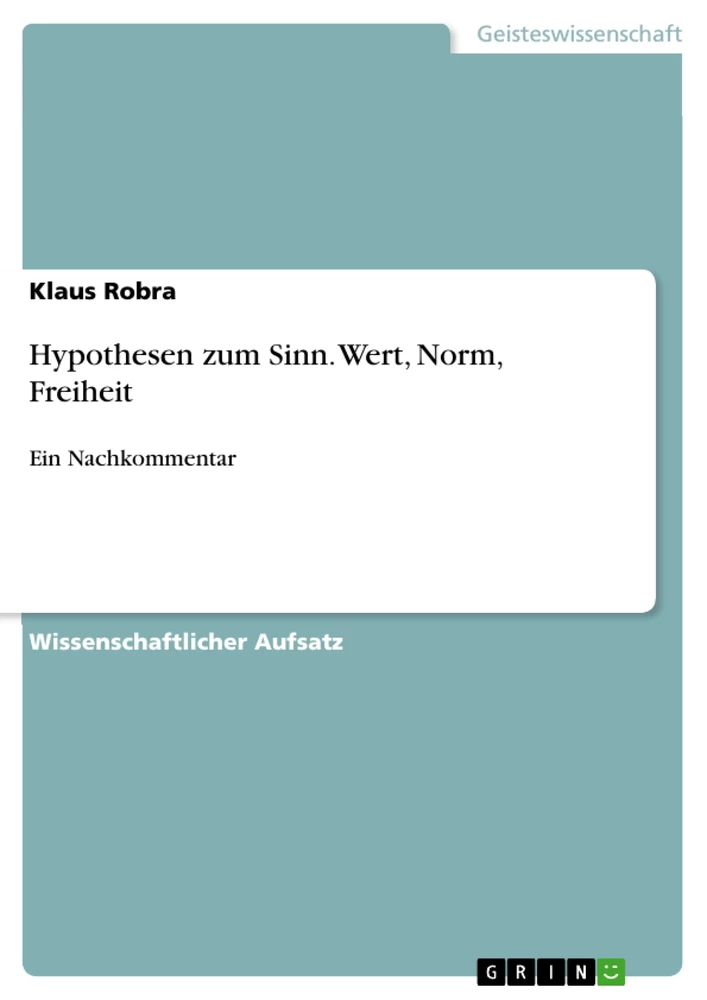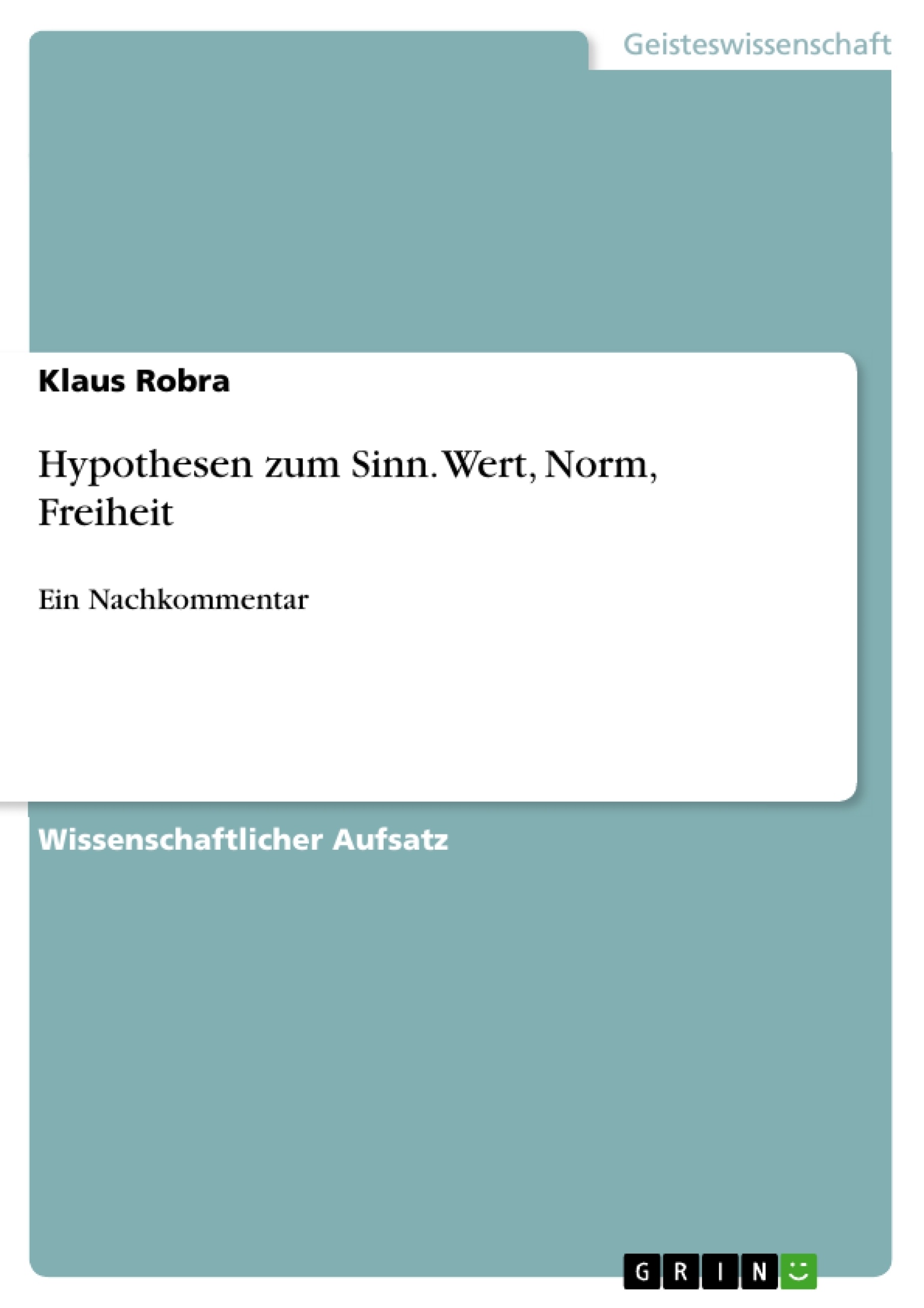Dieser kurze Aufsatz sind die „Hypothesen zum Sinn“. Sie sind eine Ergänzung zum bereits veröffentlichten Text „Wege zum Sinn“ und behandeln die Fragen: Wie definiert man den Sinn? Wie hängen Sinn und Wert mit Zielen, Zwecken und Zeiten zusammen?
Der Sinn des Seins liegt vermutlich in der Freiheit. Wir überblicken jedoch nicht das Ganze des Seins, nicht die Vergangenheit, zum Beispiel jenseits des „Urknalls“, und nicht die Zukunft: Big Crunch oder Reich der Freiheit, Nichts oder Alles? So dass man sich vielleicht mit dem Sinn, nicht des Seins, sondern von Sein begnügen könnte, mit willkürlich herausgegriffenem, aus dem Gesamtkontext des Ganzen herausgelöstem Sein, wie es Heidegger – vergeblich – versucht hat; vergeblich deshalb, weil er das Sein in einer „Fundamentalontologie“ ergründen wollte, aber letztlich dabei über das subjektive Dasein nicht wesentlich hinausgekommen ist.
Inhalt
Freiheit wozu und wovon?
Freiheit der Person: Wert oder Norm?
Sinn und Wert (‚Wege zum Sinn‘)
Vom Sinn und Reich der Freiheit (vs. „Sinnfeld“)
Ist ‚Sinn‘ folglich definierbar?
Literatur
Der Sinn des Seins liegt vermutlich in der Freiheit. Wir überblicken jedoch nicht (bzw. nicht mehr) das Ganze des Seins, nicht die Vergangenheit, z.B. jenseits des „Urknalls“, und nicht die Zukunft: Big Crunch oder Reich der Freiheit, Nichts oder Alles? So dass man sich vielleicht mit dem Sinn, nicht des Seins, sondern von Sein begnügen könnte, mit willkürlich herausgegriffenem, aus dem Gesamtkontext des Ganzen herausgelöstem Sein, wie es Heidegger – vergeblich – versucht hat; vergeblich deshalb, weil er das Sein in einer „Fundamentalontologie“ ergründen wollte, aber letztlich dabei über das subjektive Dasein nicht wesentlich hinausgekommen ist.
Ein anderer Weg der Ergründung des Sinns von Sein besteht darin, vom Sein als dem Noch-Nicht, dem Sein als Werden, auszugehen. Was sich sogleich aufhebt, wenn alles Werden unvermeidlich dem Vergehen zum Opfer fällt – was nicht überschaubar und nicht entscheidbar zu sein scheint.
Aber: Im Werden kann Neues, nie Dagewesenes entstehen – bis hin zur Auflösung des Seins in Information, aber auch bis hin zu der Möglichkeit, ein Reich der Freiheit zu errichten. Zu diskutieren ist daher die Frage:
Freiheit wozu und wovon?
Erstens Freiheit wovon: von Unfreiheit, d.h. von Not, Elend, Ausbeutung, Unterdrückung, Entfremdung, Verdinglichung; so dass alle Verhältnisse umzustürzen sind, in denen derartige Mängel, derartige Unfreiheiten herrschen. – Erreichbar nicht ohne Reformen, vielleicht nicht ohne Revolution. Denn Unfreiheit der genannten Art gibt es bekanntlich nach wie vor in Hülle und Fülle, zumal in unserer globalisierten Welt. Der Kampf dagegen fordert Engagement in höchstem Maße, nicht nur politisch, sondern auch allgemein existenziell, körperlich, seelisch, geistig, geistlich. Nicht alle Menschen sind dazu fähig und bereit. Und die wirklich Bereiten stoßen allenthalben auf den Widerstand derjenigen, die das bestehende Unrecht, die herrschende Ungerechtigkeit, die grassierende Unfreiheit mit allen Mitteln verteidigen: politisch, militärisch, sozio-ökonomisch, psychologisch, unter Einschluss raffiniertester Machtmittel der Manipulation, offener und versteckter Einflussnahme im Sinne der herrschenden Interessen, der Interessen der Herrschenden.
In dieser Lage befinden wir uns: zuweilen wie in einem Gefängnis (der Seele), oder auch: wie im eigenen Bewusstsein be- und ge-fangen. Wir treffen manchmal auf so viel Widerwärtiges, so viel bösen Widerstand gegen das Gute (bzw. natürlich gegen das, was wir für das Gute halten), dass wir an der eigenen Hoffnung zu verzweifeln drohen. Wir kommen zuweilen nicht voran, weder in der Theorie noch in der Praxis. Doch wir lassen uns gewiss das Denken nicht verbieten. Daher: Zweitens Freiheit wozu? Zunächst zur Gedankenfreiheit. Wir denken, was wir wollen, was wir können, was uns zuteil wird, was uns gerade durch den Kopf geht, was uns einfällt. „Was fällt Dir denn ein?“, lautet eine bekannte kritische Alltags- und Allerwelts-Frage. Was uns einfällt, kann nicht immer nur uns selbst betreffen, sondern auch unsere Mitmenschen. Wir können, dürfen und sollen alles denken, was wir wollen, müssen aber be-denken, dass wir mit unseren Gedanken nicht immer allein sind. Zumal dann nicht, wenn wir unsere Gedanken in Rede, Schrift und andere Taten umsetzen, kommunizieren. Dann – und nicht nur dann – müssen wir die Würde und die Freiheit unserer Mitmenschen, ihr Person-Sein, anerkennen und respektieren. Aber worin besteht nun diese Freiheit der Person, die ja sogar im Grundgesetz der BR Deutschland garantiert wird?
Freiheit der Person: Wert oder Norm?
Für Kant ist die Person ein absoluter, unbedingter Wert, und ihre Freiheit, alles tun zu dürfen, wird nur durch die Freiheit der Anderen begrenzt. ‚Absolut‘ im Sinne von ‚unbedingt‘ bedeutet nicht die Loslösung der Person von allem anderen, wohl aber den Anspruch auf die zumindest denkmögliche Ganzheit des Menschen, „le volume total de l’homme“, seinen gesamten „Umfang“, wie es Emmanuel Mounier ausgedrückt hat.[1] Wozu zweifellos auch alles gehört, was die Person im Laufe ihres Lebens erfährt, erlernt, erwirbt, durch eigenes Tun bewirkt, mithin die Persönlichkeit, die nicht von der leiblich-seelischen Konstitution der Person zu trennen ist.
Was aber bedeutet es, dass die Person – und erst recht als Persönlichkeit mit dem Recht auf „freie Entfaltung“ – unbedingten Wert hat? Bei Kant bedeutet es u.a., dass dieser Wert auch in der Ethik ausschlaggebend ist. Was zunächst fraglich zu sein scheint, zumal Kants Kategorischer Imperativ (im Folgenden: Kat. Imp.) gemeinhin als Musterbeispiel normativer Ethik gilt. Tatsächlich gibt jedoch im Kat. Imp. nicht die Norm, sondern der Wert den Ausschlag. Normativ ist zwar der Grundton: „Handle so, dass ...“ – eine unbedingte („kategorische“) Forderung, die anscheinend in sämtlichen Formulierungen des Kat. Imp. enthalten ist. Diese Unbedingtheit stimmt zwar mit der Sonderstellung der „absoluten“ personalen Würde überein, führt aber nicht zu einer Unterordnung des Wertes unter die Norm, sondern umgekehrt: dem Wert der Person unterstellt Kant im Kat. Imp. alles andere, auch die Normativität. Was schon in der „Grundformel“ deutlich sichtbar wird: Die handelnde Person soll sich nicht vornehmlich am eigenen Willen (der subjektiven „Maxime“), sondern an einer Allgemeinen Gesetzgebung und somit am Sittengesetz orientieren, das den nicht-bedingten, absoluten Wert der Person gewährleisten soll. In der „Selbstzweckformel“ steht für diesen höchsten Wert die gesamte Menschheit, die Kant für „heilig“ hält, im Unterschied zu der keineswegs immer heiligen Einzelperson. Nur diese höchste Wert-Stellung könne auch naturgemäß sein, wie es in der „Naturgesetz-Formel“ des Kat. Imp. zum Ausdruck kommt.
Dieses eigentümliche Verhältnis von Wert und Norm, die faktische Überordnung des Wertes über die Norm, ist bisher anscheinend auch auf höchstem Niveau philosophischer Auseinandersetzung – so zwischen Hilary Putnam und Jürgen Habermas – kaum oder gar nicht gewürdigt worden.[2] – Von hoher Bedeutsamkeit ist diese Wert-Schätzung des Wertes nicht zuletzt auch für die Sinnfrage. Denn was Wert hat, macht auch Sinn, kann und sollte ihn jedenfalls machen.
Sinn und Wert (‚Wege zum Sinn‘)
Sinn und Wert sind zweifellos keine Gegenstände der materiellen Welt. Liegt ihnen nicht trotzdem auch Materielles zu Grunde? Darüber wird nachzudenken sein. Jedenfalls können wir Sinn und Wert nicht anfassen, nicht unmittelbar anschauen, vielleicht gar nicht sinnlich erfahren. Dass aber sinnliche Erfahrung – wie z.B. Essen und Trinken, Sex-, Kunst- und Musik-Genuss – Sinn macht und Wert hat, steht wohl außer Frage.
Dennoch gehen die Vorstellungen über Sinn und Wert weit auseinander. Es gibt sie in schier unübersehbarer Fülle. Wahrscheinlich so oft, wie es überhaupt Individuen gibt, gegeben hat und geben wird; so dass es erstaunlich scheint, dass Sinn und Wert dennoch als Begriffe existieren, dass wir sie sprachlich verwenden und über sie diskutieren können. Es scheint möglich zu sein, an ihnen allgemein anerkannte Merkmale und Eigentümlichkeiten auszumachen.
Aber wozu? Wissen wir denn nicht genau, was Sinn macht und Wert hat? Wir wissen es sehr wohl. Sinnvoll ist für uns das, was wir für „richtig“ halten, und darin liegt für uns ein Wert des Sinnvollen. – Und was ist der Wert des Wertens? Nun, wir werten und urteilen anscheinend ständig, und zwar seit frühester Kindheit, vielleicht schon seit vorgeburtlicher Zeit. Der Fötus findet heraus, was ihm gut tut: Neues erleben, Fruchtwasser trinken, Arme und Beine bewegen u.a.m. Die hierzu erforderlichen Entwicklungen – und noch mehr diejenigen der Folgezeit in Sozialisation, Erziehung und Werte-Vermittlung – sind immer wieder eingehend analysiert worden.
Was folgt daraus für die Theorien von Sinn und Wert? Gelangt man vom Sinn zum Wert oder umgekehrt? Lässt sich von dem einen auf das andere schließen? Heidegger hielt es für falsch und ausgeschlossen, vom Wert zum Sinn gelangen zu wollen. Er fragte nach dem Sinn von Sein, lehnte es aber strikt ab, vom Werten bzw. von den Werten her einen Zugang zur Analyse des Seins zu suchen. Wer den Wert einer Person, einer Sache oder eines Sachverhalts einzuschätzen versucht, kann dies – laut Heidegger – nur tun, wenn er/sie die entsprechenden „Objekte seiner/ihrer Begierde“ , z.B. die Natur und ihre Schönheiten, liebe, kluge Menschen, Schmuckstücke, raffinierte Technik usw., auf ihre möglichen Vor- und Nachteile hin überprüft. Das so geprüfte Objekt verliert dabei sozusagen seine Unschuld. Ich erhebe – jedenfalls geistig, virtuell – Anspruch auf den „Gegenstand“, verändere sein Beziehungsgefüge und damit seine ursprüngliche „Seinsart“. Ich lasse die Dinge nicht immer, wie sie „sind“ bzw. zu sein scheinen, nicht unbedingt auf sich beruhen.
Nichtsdestoweniger frage ich: Versperre ich mir damit nicht den Zugang zu jeglicher Sinngebung für mein Tun, meine Hoffnungen und Bestrebungen? Ganz im Gegenteil! Ich kann ja, größtenteils seit früher Kindheit, nicht umhin, mein Urteilen, Werten und Einschätzen für völlig normal zu halten, für ganz sinnvoll, vielleicht sogar für lebensnotwendig, notwendig für das eigene Wohlergehen und das meiner Mitmenschen, wenn nicht gar für notwendig im Kampf ums Dasein, z.B. bei blitzschneller Reaktion in brenzligen Situationen, wobei mir nicht nur mein Verstand hilft, sondern in sehr hohem Maße auch mein unterbewusstes Sein, mein nicht-bewusstes Reaktionsvermögen.
Fazit: Was Wert hat, macht anscheinend stets auch Sinn (wovon Nicolai Hartmann fest überzeugt war). Rechnet man Faktoren wie Ziele, Zwecke und Zeiten hinzu, ergibt sich daraus all das Weitere, das ich meinem Buch WEGE ZUM SINN ausführlich dargelegt habe, darunter die Sinn- und Werte-Synthesen, die sich nicht nur auf den Sinn des Lebens, sondern auch der Geschichte und des Seins überhaupt beziehen. Es geht also u.a. um erste und letzte, existenziell berührende Fragen. Wobei auch die aktuellen Krisen – insbesondere die Globalisierungs-Krise – in anderem Licht erscheinen.
Vom Sinn und Reich der Freiheit (vs. „Sinnfeld“)
‚ Sinnan ‘, das indogermanische Etymon von ‚Sinn‘, bedeutet so viel wie ‚unterwegs sein, reisen, einer Fährte folgen‘. Wer sich auf dem Weg befindet, strebt einem Ziel entgegen, das durchweg räumlich und zeitlich bekannt und benannt ist. Dabei dominiert und determiniert die Zeit die Reise insofern, als sie – qua Weltzeit[3] – unentrinnbar fortbesteht, und zwar auch dann, wenn das räumliche Ziel der Reise verfehlt oder aufgegeben wird. Der Wert der reisenden Personen, ihr Telos (Ziele und Zwecke), Raum, Zeit und Sinn wirken zusammen, gehen ineinander über. Wer auf seiner Reise seine Ziele erreichen und seine Zwecke erfüllen will, muss auf seine Fährte achten, darf nicht abirren, nicht die falsche Richtung einschlagen. All dies macht zumindest einen Teil des Sinns jeder Reise aus.
Wir sind unterwegs auf der Lebensreise und glauben, durchaus schon zu wissen, was sinnvoll und richtig ist. Hat also Markus Gabriel, der „neue Realist“, Recht, wenn er konstatiert, dass der Sinn als solcher immer schon vorhanden ist – gemäß seiner Definition von Sinn als „die Art, wie ein Gegenstand erscheint“?[4] So dass Sinn tatsächlich immer schon gegeben oder zumindest erkennbar wäre. Stimmt das? Ja und nein!
1. Ja, weil wir tatsächlich stets auf Grund früherer, vorgängiger Sinnfindung und Sinngebung urteilen und handeln. Wir verinnerlichen das, was wir für sinnvoll halten und als solches erprobt haben, speichern es im Gedächtnis. Ohne Sinn können wir nicht denken, nicht urteilen, nicht leben.
2. Nein, a) weil Sinn und Existenz nicht per se identisch sind. In seiner Definition von Sinn erklärt M. Gabriel jeglichen „Gegenstand“ für sinnvoll. Bekanntlich erscheint aber ohnehin jeder Gegenstand in irgendeiner Art und Weise, so dass sich Gabriels Definition auf jede Art von Existenz überhaupt bezieht. Demnach gäbe es in der Welt überhaupt nur Sinn, nur Sinnvolles! – Was aber schon deshalb unsinnig ist, weil wir es in der Welt immer wieder auch mit Unsinn, Non-Sens, Blödsinn, Schwachsinn, Absurditäten zu tun haben.
b) Nein, weil Gabriel Erscheinungen nicht wie Kant vornehmlich als Sinnes-Phänomene auffasst, sondern – eher wie Hegel – mit der Wirklichkeit überhaupt gleichsetzt. Demzufolge existiert die Welt (einschließlich des „Dings an sich“) nur als Erscheinung und hätte (nur) als solche einen Sinn im Ganzen, was unlogisch und unsinnig ist (s.o.). Und zwar doppelt unsinnig, weil Gabriel die Welt für nicht-existent (!) hält.[5]
Außerdem ist Gabriels Definition von Sinn auch deshalb unzulänglich und unzureichend, weil in ihr die essentiellen Zusammenhänge von Wert, Telos, Zeit, Raum (Raumzeit, Weltzeit) und Sinn nicht berücksichtigt werden. – Dass Sinn bereits „vorhanden“ ist und trotzdem auch immer wieder neu entsteht, scheint zunächst paradox und unverständlich, entspricht aber den Tatsachen.
c) Nein, weil es Sinn für Gabriel nur in einem „Sinnfeld“ gibt (s.o., Fußnote 4). Voraussetzung hierfür ist die Gleichsetzung: „Existenz = das Vorkommen in einem Sinnfeld“.[6] Sinnfelder nimmt Gabriel zudem in unendlicher Vielzahl an, er definiert ‚Sinnfelder‘ als „Orte, an denen überhaupt etwas erscheint“.[7] – Was sind das für „Orte“? Da jegliche Existenz und jeglicher Sinn angeblich in einem Sinnfeld – und nur dort! – erscheint, sind diese Orte anscheinend überall und nirgends anzutreffen. Überall, weil an und in ihnen ja die gesamte Existenz „erscheint“ – nirgendwo, weil es Sinn laut Gabriel nur als Örtlichkeit in Sinnfeldern und daher nur in räumlicher Form gibt, obwohl Sinn bekanntlich schon in den Sinnen[8] an die Zeit gebunden ist. Das „Sinnfeld“-Konzept ist daher ebenso hinfällig wie Gabriels Definition von Sinn.
d) Nein, weil Gabriel die Begriffe Sinn und Sinnfeld in eine „Sinnfeldontologie“ einbettet, die er folgendermaßen definiert: „SINNFELDONTOLOGIE: Die Behauptung, dass es nur dann etwas und nicht nichts gibt, wenn es ein Sinnfeld gibt, in dem es erscheint. Existenz = Erscheinung in einem Sinnfeld“.[9] –Evidentermaßen wird mit Gabriels Sinn- und Sinnfeld-Konzepten auch die mit ihnen verbundene Ontologie hinfällig (s.o.).
Der Sinn-Problematik gerecht zu werden vermag dagegen eine – kosmologisch fundierte – Ontologie des Noch-Nicht, wie sie Ernst Bloch erarbeitet hat.[10] Wir haben Sinn und müssen trotzdem immer wieder neuen Sinn suchen und finden. Außerdem ist der letzte Sinn, das Endziel des Ganzen, (noch) nicht angebbar, zumal wir das Ganze nicht mehr (bzw. noch nicht) überschauen. Die Verknüpfung von Wert, Telos, Zeit und Sinn lässt dennoch erreichbare Nah- und Fernziele erkennen, darunter das Reich der Freiheit[11], wie es Ernst Bloch als Sinn der Geschichte eruiert hat.
Ist ‚Sinn‘ folglich definierbar?
Nicht, wenn Definition eine „endgültige“, definitive Grenzbestimmung bedeutet. Unter dem Vorzeichen der Blochschen Ontologie des Noch-Nicht erscheint jeder Versuch einer Definition von Sinn vorläufig, d.h. fallibel angesichts der Möglichkeiten und Unwägbarkeiten der Zukunft. Auch im Hinblick auf konkurrierende Versuche (M. Gabriel, N. Bolz u.a.) halte ich aber inzwischen die folgende Formulierung für angebracht: Sinn ist im Wesentlichen wahrscheinlich der ‚logos‘, insofern er nicht nur Sprache, Denken, Rede, Vernunft und Verstand, sondern auch STRUKTUR bedeutet und daher auf sämtliche Erfahrungs- und Wissensgebiete (incl. Mathematik, Psychoanalyse, Künstliche Intelligenz) anwendbar zu sein scheint, und zwar erst recht dann, wenn Sach-, Sprach- und Denklogik operationalisiert werden. Daraus lässt sich folgern bzw. präzisieren: Sinn ergibt sich durch Kombinationen angewandter Sach-, Sprach- und Denk-Logik, durchweg auf Grund von Werten, Zielen und Zwecken. Speziell:
a) Sprachlicher Sinn: die „Kombination aller Zeichenrelationen“ + „Evokation“ (E. Coseriu)[12].
b) Sach-(Objekt-) Sinn: erreichbar u.a. durch Einsicht in die „Art, wie ein Gegenstand erscheint“ (M. Gabriel, s.o.).
c) Denk- Sinn: erreichbar in dialektischen Subjekt-Objekt-Beziehungen, ermittelt insbesondere durch den Logos in Synthesen von a), b) und c).
Die Gefahr des „Logozentrismus“ (bzw. der Kopflastigkeit) besteht wohl nur dann, wenn man die Sinn-Fragen über- oder unterschätzt. Sinn ist nicht alles, aber ohne Sinn ist vor allem der Non-Sens.
Im Übrigen mag wohl gelten:
Sinn des Ganzen: unbekannt.
Sinn der Welt: u.a. der – teils noch nicht erschienene – Logos.
Sinn von Werten: u.a.: Sinn erzeugen
„ des Seins: Freiheit (?).
„ der Geschichte: Reich der Freiheit (?)
„ von Philosophie: Liebe zur Theorie und zur Weisheit, zum (göttlichen) Logos.
Sinn von Religion: u.a. der Glaube an einen göttlichen Logos.
Sinn des Lebens: in und aus dem Leben selbst, z.B. leben aus dem ursprünglichen, der Vollendung harrenden Logos. Sinn des Nicht-Seins (des Todes): Freiheit (in) der Unfreiheit. Sinn des Leidens: u.a. die Möglichkeit der Besinnung auf Sinn.
Sinn des Handelns: Sinn-(Telos-)Erfüllung, Reich der Freiheit (?). Sinn des Nicht-Handelns: Raum und Zeit für Besinnung. Sinn der Faulheit: u.a. Widerlegung des Pragmatismus. Sinn der Arbeit: Sinn- und Lebensunterhalt; Raum und Zeit schaffen für Besinnung, Nicht-Entfremdung. Sinn der Kunst: Sinn schaffen (u.a.). Sinn von Unsinn: Relativierung des Sinn-Problems. Usw. ad infinitum: Es gibt „Sinnfelder“ in unendlicher Vielzahl und Vielfalt.
Was mit der Tatsache zusammenhängt, dass „Sinnfelder“ sich u.a. in Wortfeldern wiederfinden, d.h. in „Feldern“ mit intensionalen und extensionalen Bedeutungen. Der „Wortsinn“, der Sinn eines Wortes, ist weitgehend identisch mit seiner aktualisierten, kontextuellen Bedeutung. (Dies wohl auch in der neckischen Floskel: „im wahrsten Sinne des Wortes“!) Allerdings enthält nicht jeder Wortsinn objektiven, wahrheitsfähigen Sinn; Wörter, zumal in Ausdrücken (Syntagmen), Sätzen und Texten, können bekanntlich auch Unsinn transportieren.
Außerdem gibt es auch Bedeutungen nicht-sprachlicher Art. Diese beziehen sich z.B. auf nicht-sprachliche Wahrnehmungen und Vorstellungen, ikonische Zeichen, Bilder, Denken in Bildern, Ereignisse, Happenings, Kunstwerke, kurzum: non-verbale innere und äußere Objekte, mentale Objekte und Gegenstände der Außenwelt – häufig mit stark subjektivem Einschlag und emotionaler Färbung und daher schwer eingrenzbar, kaum zu klassifizieren, auch und gerade nicht in „Sinnfeldern“ (s.o.). Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass Außersprachliches durchweg auch in Sprache, in „mentalen Objekten als verbalsprachlichen Signifikaten“[13] repräsentiert werden kann; wobei aus nicht-sprachlichen Vorstellungen Sprachinhalte in Form verallgemeinerter Vorstellungen werden.
Fazit: Sinn manifestiert sich in kontextuellen, aktualisierten Bedeutungen sprachlicher und / oder nicht-sprachlicher Art. Dabei können Bedeutungen Sinn als LOGOS hervorbringen („machen“, produzieren), bewusst machen, für den Ausdruck vorbereiten, zum Ausdruck bringen, endophorisch und exophorisch, nach innen und nach außen führend-geführt. Fast wie beim Schachspiel: „berührt, geführt“! Sprachspiel als Schachspiel? – Jedenfalls avanciert damit Sinnfindung (-gebung, -stiftung) zu einer Instanz der Problemlösung par excellence und vielleicht sogar zu einem weiteren „Motor der Geschichte“, neben Arbeit, Ökonomie, Geist, Sprache, Wissen (incl. der Künstlichen Intelligenz), Wertung, Politik, Wille zur Macht, Klassenkampf u.a.m.
Literatur
Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt a.M. 1977 (a)
ders.: Tübinger Einleitung in die Philosophie, Frankfurt a.M. 1977 (b)
Bolz, Norbert: Die Sinngesellschaft, Düsseldorf 1997
Coseriu, Eugenio: Textlinguistik. Eine Einführung, herausgegeben und bearbeitet von Jörn Albrecht, Tübingen 1981
Frege, Gottlob: Über Sinn und Bedeutung, in: ‚Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik‘, NF 100, 1892, S. 25-50
Gabriel, Markus: Warum es die Welt nicht gibt, Berlin 2013
ders.: Sinn und Existenz. Eine realistische Ontologie, Berlin 2016
Mounier, Emmanuel: Refaire la Renaissance, Paris 1961/2000
Raters, Marie Luise / Willaschek, Marcus (Hrsg.): Hilary Putnam und die Tradition des Pragmatismus, Frankfurt a.M. 2002
Robra, Klaus: Mentale Objekte als verbalsprachliche Signifikate – Zur Neubegründung von Bedeutungstheorien, in: Kodikas / Code – Ars Semeiotica, vol. 15 (1992), No. 1/2, S. 21-29.
ders.: Und weil der Mensch Person ist ..., Essen 2003
ders.: Wege zum Sinn, Hamburg 2015
Siebers, Johan: Noch-Nicht, in: Dietschy, Beat / Zeilinger, Doris / Zimmermann, Rainer E. (Hrsg.): Bloch-Wörterbuch. Leitbegriffe der Philosophie Ernst Blochs, Berlin 2012
---
Dr. Klaus U. Robra M.A., Düsseldorf, im Oktober 2016
[...]
[1] Mounier 1961/2000, S. 85; s. auch Robra 2003, S. 110 ff.
[2] Vgl. Raters / Willaschek 2002, S. 263-324. Die ‘Freiheiten wozu?’ im Einzelnen darzustellen, ist mir hier nicht möglich. Durch die Freiheit der Person als Wert und Norm lassen sich aber anscheinend sämtliche Grundfreiheiten begründen, die z.B. in Verfassungstexten garantiert werden. Aus der Zweckformel des Kat. Imp. lässt sich sogar die Möglichkeit einer Revolution zur Herstellung von Freiheit und Menschenwürde ableiten (s.o. „Freiheit wovon“); was aber rechtliche, ethische und politische Fragen aufwirft, die ich hier ebenfalls nicht behandeln kann.
[3] Vgl. meine „Hypothese zur ursprünglichen Weltzeit“, in: Robra 2015, S. 479-481
[4] Gabriel 2013, S. 267, 221 f. Gabriel verallgemeinert damit offenbar ein linguistisches Sinn- und Bedeutungskonzept von Gottlob Frege, der festgestellt hat, dass „der Unterschied des Zeichens einem Unterschiede in der Art des Gegebenseins des Bezeichneten entspricht“ (Frege 1892, S. 26). Ähnliches gilt für den Begriff „Sinnfeld“, den Gabriel offensichtlich in Analogie zu dem linguistischen Begriff „Wortfeld“ gebildet hat (a.O. S. 267 et passim).
[5] Vgl. die „Deduktion“ dieser Behauptung in ‚Sinn und Existenz‘ (Gabriel 2016, S. 224).
[6] Gabriel 2013, S. 87
[7] Gabriel 2013, S. 267
[8] Sinn (‚sensus‘) gehört sowohl zur Sinnen- als auch zur Verstandes- und Vernunft-Welt.
[9] Gabriel 2013 ebd.
[10] Bloch 1977 a), S. 123 ff., ders. 1977 b), S. 212 ff.; dazu auch: Siebers 2012, S. 403-412
[11] Bloch 1977 b), S. 144; s. auch Robra 2015, S. 435. Unterhalb dieser Maßgabe bleibt nicht nur M. Gabriel (s.o.), sondern auch der Bloch-Kritiker Norbert Bolz (1997); Letzterer bei seinem Versuch, die „Sinngesellschaft“ zu beschreiben, zumal er den „Kapitalismus und die liberale Demokratie“ für „alternativlos“ hält und Sinnsuche als „Flucht aus der Komplexität“ und Bitte um „Erlösung von der Wissenschaft“ missversteht (a.O. S. 10, 14, 55).
[12] Coseriu 1981, S. 102
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Inhalt"?
Der Text "Inhalt" befasst sich mit der Frage nach Sinn und Freiheit. Er untersucht, wozu und wovon Freiheit notwendig ist, ob die Freiheit der Person ein Wert oder eine Norm darstellt und wie Sinn und Wert zusammenhängen. Der Text diskutiert verschiedene philosophische Ansätze, insbesondere die von Kant und Heidegger, und hinterfragt Definitionen von Sinn, insbesondere die von Markus Gabriel. Es wird nach dem Sinn des Seins, des Lebens, der Geschichte und anderer Bereiche gefragt und abschließend eine Definition von Sinn vorgeschlagen.
Was bedeutet "Freiheit wozu und wovon?" im Kontext dieses Textes?
Dieser Abschnitt erörtert die Notwendigkeit der Freiheit von Unfreiheit, die durch Not, Elend, Ausbeutung, Unterdrückung, Entfremdung und Verdinglichung gekennzeichnet ist. Es wird argumentiert, dass alle Verhältnisse, die solche Unfreiheiten beinhalten, umgestürzt werden müssen, möglicherweise durch Reformen oder sogar Revolutionen. Zudem wird die Gedankenfreiheit als essenziell betrachtet, wobei jedoch die Würde und Freiheit der Mitmenschen stets respektiert werden müssen.
Wie wird die "Freiheit der Person" im Verhältnis zu Wert und Norm betrachtet?
Der Text stellt die Frage, ob die Freiheit der Person ein Wert oder eine Norm ist und bezieht sich dabei auf Kants Philosophie. Die Person wird als absoluter, unbedingter Wert angesehen, wobei die Freiheit durch die Freiheit der Anderen begrenzt wird. Kant ordnet im Kategorischen Imperativ (Kat. Imp.) den Wert der Person über alles andere, einschließlich der Normativität, ein.
Wie werden "Sinn und Wert" in dem Text zueinander in Beziehung gesetzt?
Der Text erörtert, dass Sinn und Wert keine Gegenstände der materiellen Welt sind, obwohl ihnen Materielles zugrunde liegen könnte. Sinnvolle Erfahrungen wie Essen, Trinken, oder Kunstgenuss werden als wertvoll betrachtet. Der Text stellt die Frage, ob man vom Sinn zum Wert gelangt oder umgekehrt, und geht auf Heideggers Ablehnung ein, vom Wert her einen Zugang zur Analyse des Seins zu suchen.
Was ist das "Reich der Freiheit" und welche Rolle spielt es im Text?
Das "Reich der Freiheit" wird als mögliches Ziel und Sinn der Geschichte betrachtet, wie es von Ernst Bloch eruiert wurde. Es wird als ein Fernziel angesehen, das durch die Verknüpfung von Wert, Telos, Zeit und Sinn erreichbar ist.
Wie wird die Definition von "Sinn" im Text diskutiert?
Der Text erörtert verschiedene Definitionen von Sinn, insbesondere die von Markus Gabriel. Er kritisiert Gabriels Definition als zu allgemein und unzulänglich, da sie essentielle Zusammenhänge von Wert, Telos, Zeit, Raum und Sinn nicht berücksichtigt. Der Text schlägt eine eigene, vorläufige Definition vor, die Sinn als den 'Logos' betrachtet, insofern er Struktur bedeutet und auf verschiedene Erfahrungs- und Wissensgebiete anwendbar ist.
Welche Autoren werden in dem Text zitiert oder diskutiert?
Der Text zitiert und diskutiert unter anderem die Werke von Kant, Heidegger, Emmanuel Mounier, Hilary Putnam, Jürgen Habermas, Markus Gabriel, Ernst Bloch, Norbert Bolz, Eugenio Coseriu, Gottlob Frege, und Klaus Robra.
Was ist die Quintessenz der Überlegungen zu Sinn, Freiheit und Wert?
Die Quintessenz ist die andauernde Suche nach Sinn in einer Welt, die durch Unfreiheit und Ungerechtigkeit geprägt ist. Freiheit, insbesondere die Gedankenfreiheit, wird als essentiell betrachtet. Sinn entsteht aus der Verknüpfung von Logos, Werten, Zielen und Zwecken. Die Suche nach Sinn ist ein fortwährender Prozess angesichts einer ungewissen Zukunft. Der Beitrag von Klaus Robra zum Werk "Wege zum Sinn" wird als ein vielschichtiger Versuch erörtert, diese komplizierten philosophischen Gebiete zu beleuchten.
- Citar trabajo
- Dr. Klaus Robra (Autor), 2016, Hypothesen zum Sinn. Wert, Norm, Freiheit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341793