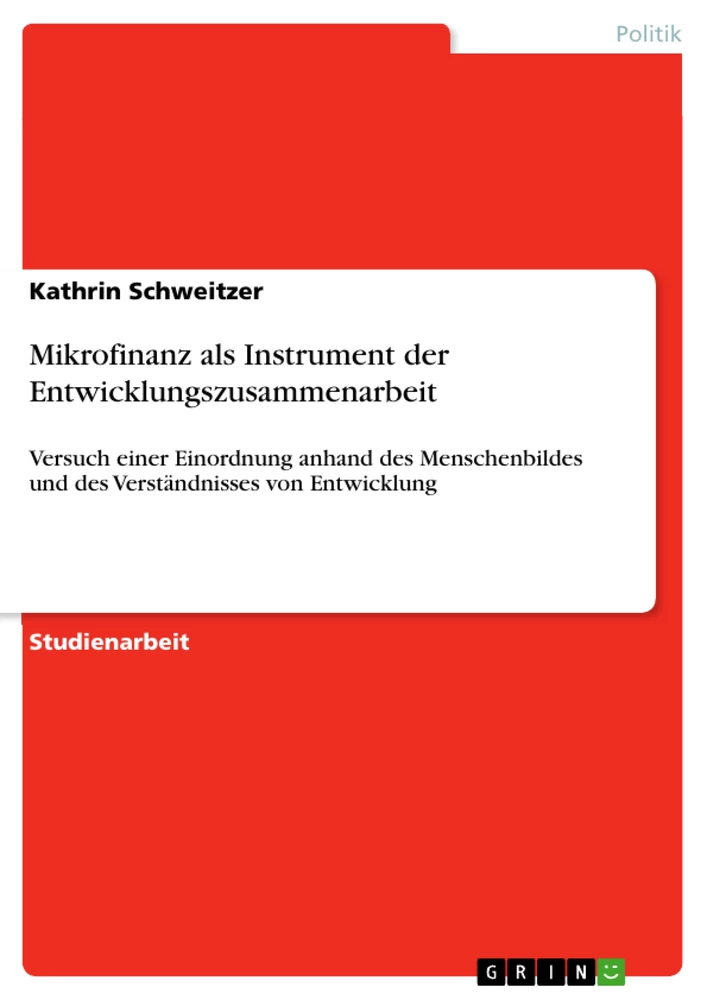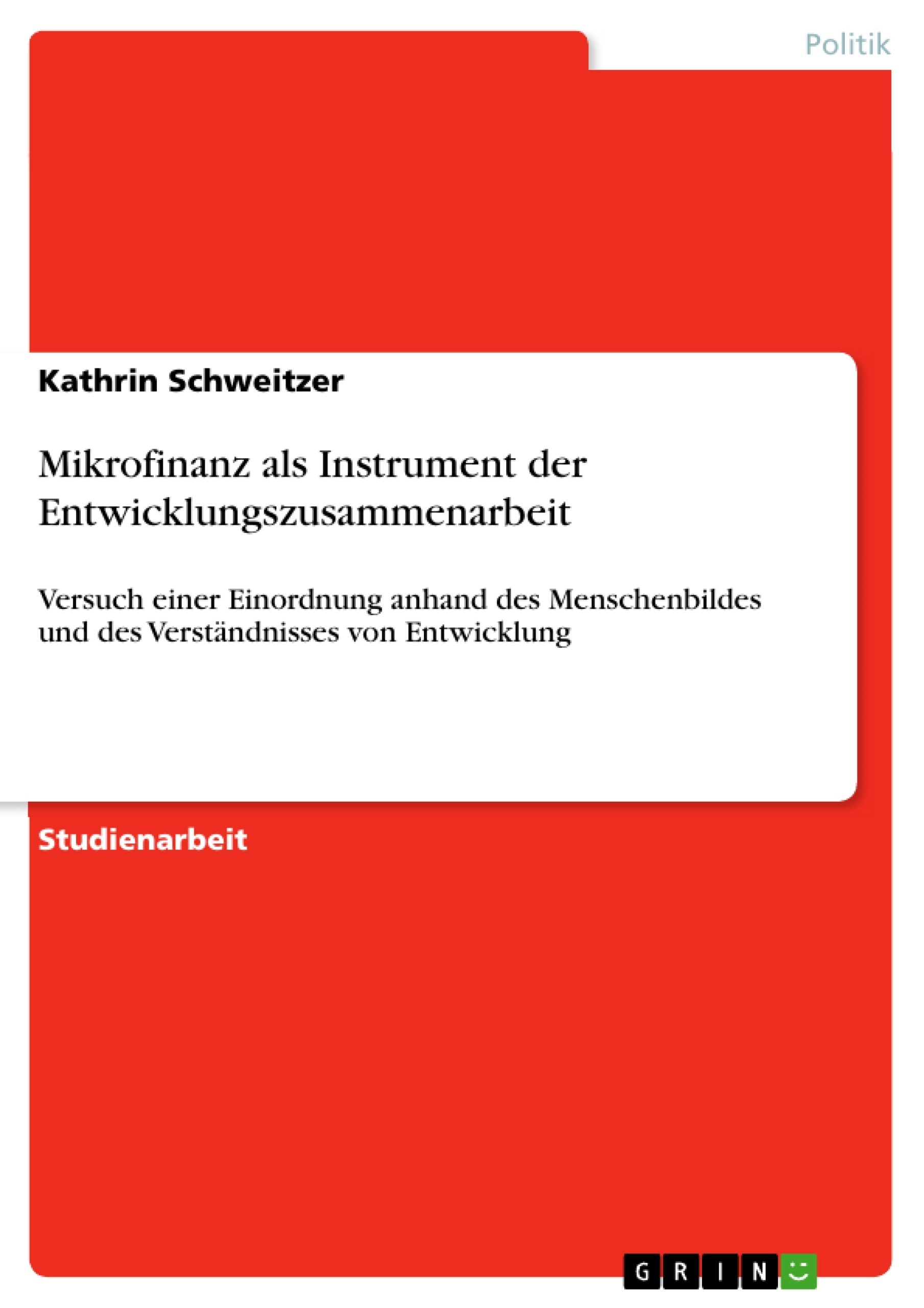Auf die Jahrtausendwende hin hatte die internationale Entwicklungszusammenarbeit sehr an Glaubwürdigkeit und Legitimation verloren und stand unter heftiger wissenschaftlicher und medialer Kritik. Vorangegangen waren Dekaden, in denen die industrialisierten Länder mit viel Geld und wechselnden Paradigmen und Konzepten versucht hatten, die Armut und Ungleichheit in der Welt zu besiegen, jedoch mussten sie nun eingestehen, dass dieses Ziel nicht erreicht worden war.
Die Idee der Spar- und Kreditgruppen, die seit den 1980ern von Muhammad Yunus, einem Wirtschaftsprofessor an der Universität in Dhaka, Bangladesh, vorangetrieben wurde, kam da zum rechten Zeitpunkt. Arme waren bislang, wenn sie in Not waren, Geldverleihern mit Wucherzinsen ausgeliefert, weil sie auf Grund fehlender Sicherheiten keinen Zugang zum regulären Bankenwesen hatten. Seine Vision, diesen Menschen auf andere Weise die Möglichkeit zu Finanzprodukten wie Sparen und Kredit zu geben, und ihnen damit einen Ausweg aus Armut und Hunger zu ermöglichen, wurde von vielen Organisationen weltweit freudig aufgenommen und schien die optimale Problemlösungsstrategie für unterschiedlichste Ziele.
Trotz vieler positiver Erfahrungen wurde in den letzten zehn Jahren zunehmend Kritik aus Industrieländern und Entwicklungsländern gleichermaßen laut. Der indische Ökonom Farooque Chowdhury prangert an, dass das System der Mikrofinanz vom Mainstream propagiert und völlig unreflektiert übernommen worden sei. Reiche Länder und große Banken hätten die Möglichkeit, in einen neuen Markt zu investieren, ergriffen, um auszuprobieren, ob und wie viel Rendite ihr Kapital erzielen kann. Und solch erschreckende Nachrichten wie die aus Andhra Pradesh, als sich im Jahr 2009 überschuldete Bauern in ihrer Ausweglosigkeit das Leben nahmen, bringen weltweit nicht nur in der EZ tätige Menschen dazu, über Sinn und Nutzen der Mikrofinanz nachzudenken.
Wie konnte die Mikrofinanz einerseits in so kurzer Zeit so viel Begeisterung auslösen und zu einem wichtigen Instrument der EZ werden und andererseits so großes Unglück über Menschen bringen? Was kann die Mikrofinanz tatsächlich leisten? Die These dieser Hausarbeit lautet: die Mikrofinanz in ihren Anfängen zeigt ein neues, starkes, positives und eigenverantwortliches Menschenbild in der Entwicklungszusammenarbeit auf und stellt damit die Legitimation vieler vorangegangener Entwicklungsparadigma in Frage.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die postkoloniale Zeit: Entwicklungshilfe - Entwicklungszusammenarbeit
- Die Pionierphase der Entwicklungshilfe
- Die Dekaden der Entwicklungspolitik und ihre Paradigmen
- Die Millennium Development Goals (MDG)
- Die Wahrnehmung der Entwicklungszusammenarbeit und die Kritik an ihr
- Ein neues Instrument: Microcredit - Microfinance - Financial Inclusion
- Das Modell Grameen Bank als Vorbild
- Der ganzheitliche Ansatz der Mikrofinanz
- Financial Inclusion als Schritt auf den globalen Finanzmarkt
- Die kritische Wahrnehmung des Mikrofinanzansatzes
- Entwicklung - Menschenbild - Menschenrecht
- Was ist Entwicklung und wer ist dafür zuständig?
- Menschenbilder: Selbstbilder und Zuschreibungen
- Die Idee der Menschenrechte
- Ein alternativer Ansatz? Der Capabilities-Approach von Martha C. Nussbaum
- Bestandsaufnahme:
- Welche Erwartungen kann die Mikrofinanz erfüllen?
- Welche Bedeutung hat die Mikrofinanz für den entwicklungspolitischen Diskurs?
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Mikrofinanz als Instrument der Entwicklungszusammenarbeit und untersucht deren Potenziale und Herausforderungen. Die Arbeit analysiert die Erwartungen, die an die Mikrofinanz gestellt werden, und beleuchtet die Kritik an diesem Ansatz. Im Zentrum der Betrachtung stehen das Menschenbild und das Verständnis von Entwicklung, um die Ursachen für die Polarisierung der Mikrofinanz zu erforschen.
- Die historische Entwicklung der Entwicklungszusammenarbeit und die Entstehung der Mikrofinanz
- Die Funktionsweise und die verschiedenen Ansätze der Mikrofinanz
- Die Kritik an der Mikrofinanz und deren Auswirkungen
- Das Menschenbild in der Entwicklungszusammenarbeit und die Frage der Selbstbestimmung
- Die Bedeutung der Mikrofinanz für den entwicklungspolitischen Diskurs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Mikrofinanz ein und stellt die zentralen Fragen der Arbeit dar. Kapitel II beleuchtet die historische Entwicklung der Entwicklungszusammenarbeit und die Entstehung der Mikrofinanz als alternatives Instrument. Kapitel III analysiert das Modell der Grameen Bank und die verschiedenen Ansätze der Mikrofinanz. Kapitel IV untersucht das Menschenbild in der Entwicklungszusammenarbeit und die Frage der Selbstbestimmung. Kapitel V befasst sich mit der Bestandsaufnahme der Mikrofinanz und deren Bedeutung für den entwicklungspolitischen Diskurs. Der Ausblick fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Mikrofinanz, Entwicklungszusammenarbeit, Menschenbild, Entwicklung, Financial Inclusion, Grameen Bank, Kritik, Empowerment, Armut, Ungleichheit, Selbstbestimmung, Capabilities-Approach.
- Quote paper
- Kathrin Schweitzer (Author), 2015, Mikrofinanz als Instrument der Entwicklungszusammenarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341734