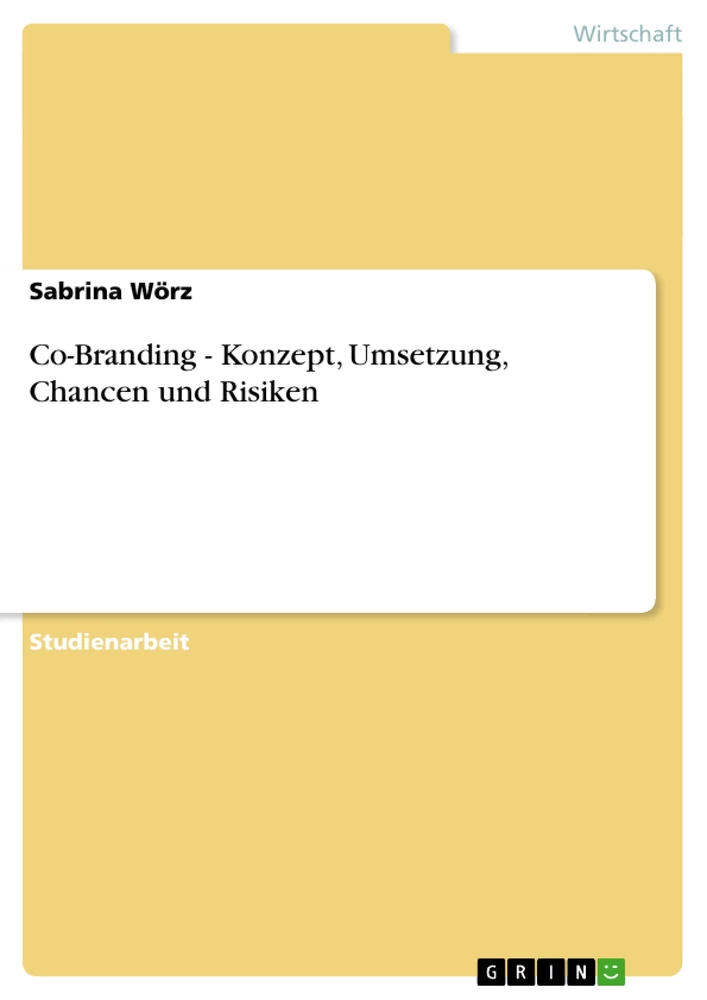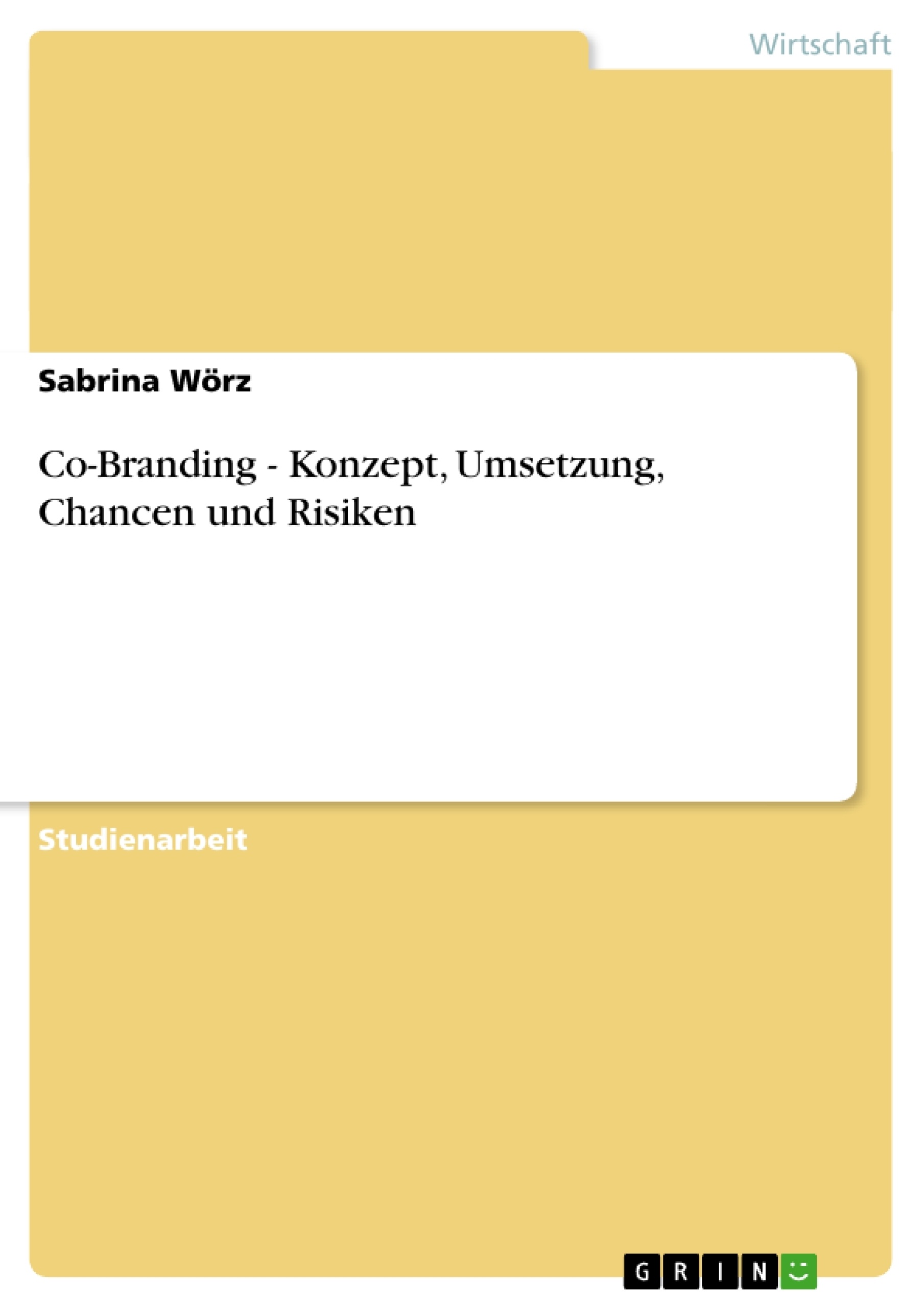Es gibt kaum eine Situation, in der Menschen nicht mit Marken konfrontiert werden. Neben dem Preis schauen sehr viele Personen beim Einkaufen auch auf die Marke eines Produktes, ob bei Lebensmitteln, bei Kleidung oder bei Pflegeartikeln – niemand kann sich vollkommen davon freisprechen, in irgendeinem bestimmten Bereich nicht ein Markenprodukt einem sogenannten No-Name-Produkt vorzuziehen. Der Wert starker Marken lässt sich fast nirgendwo mehr verbergen. Anhand von Marken unterscheiden Konsumenten ein Produkt von einem anderen. Sie werden mit einem bestimmten Image konfrontiert und verbinden mit dem Markenprodukt eine ganz bestimmte Qualität. Kauft ein Konsument einen Markenartikel, so vertraut er darauf, dass seine Erwartungen erfüllt werden.
Auch aus Unternehmenssicht erfüllt eine Marke eine Vielzahl an Funktionen: Eine Marke dient dazu, sich von der Konkurrenz zu differenzieren. Produkte starker Marken werden von Konsumenten häufig schneller und einfacher akzeptiert, als gleichartige Produkte unbekannter und schwächerer Marken. Doch Marken sind auch ein gewisses rechtliches Instrument, eine Art Eigentumsnachweis durch Namen, Logo, Design etc. Bei der Einführung neuer und innovativer Produkte, wird deshalb zunehmend auf bewährte Marken zurückgegriffen. Damit erhält ein Unternehmen die Möglichkeit in neue Märkte einzutreten. Marken werden von Unternehmen als wahre Vermögensgegenstände angesehen und auch so behandelt: Sie werden eingekauft oder verkauft wie Waren oder Dienstleistungen. In den letzten Jahren entbrannte um Marken ein heißer Kampf. 1988 bezahlte Nestlé 5 Milliarden US-Dollar für Rowntree, um den Besitz an berühmten Marken wie Smarties und Kit-Kat zu erlangen.
Hinter einer Marke verbirgt sich folglich ein bestimmter Nutzen für ein Unternehmen, daher sollte die Markenpolitik im Vordergrund der Unternehmenspolitik stehen. Ziel dieser Arbeit ist es, eine bestimmte markenpolitische Alternative, nämlich die Markenerweiterungsstrategie Co-Branding, vorzustellen und diese genau zu durchleuchten. Dazu ist es notwendig, zuerst das Konzept von Co-Branding in die Markenpolitik eines Unternehmens einzuordnen. Nach der genauen Definition und Erklärung von Co-Branding soll eine Abgrenzung dieser Kooperationsstrategie zu anderen Arten der Unternehmenskooperation erfolgen. Um Co-Branding als markenpolitische Entscheidungsalternative beurteilen zu können, werden Chancen und Risiken von Co- Branding untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Konzept von Co-Branding
- 2.1. Einordnung von Co-Branding in die Markenpolitik
- 2.1.1. Line-Extensions
- 2.1.2. Brand Extensions
- 2.2. Was ist Co-Branding?
- 2.1. Einordnung von Co-Branding in die Markenpolitik
- 3. Ausprägungsformen von Co-Branding und Beispiele der Umsetzung
- 3.1. Reach Awareness Co-Branding
- 3.2. Values Endorsement Co-Branding
- 3.3. Ingredient Co-Branding
- 3.4. Complementary Competence Co-Branding
- 4. Andere Kooperationsformen neben Co-Branding
- 4.1. Joint Promotions
- 4.2. Sponsoring
- 4.3. Joint Ventures
- 4.4. Allianzen
- 5. Chancen und Risiken des Co-Branding
- 5.1. Chancen
- 5.2. Risiken
- 6. Co-Branding als Markenstrategie
- 6.1. Beurteilung von Co-Branding als Markenstrategie
- 6.2. Zukunftsaussichten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die markenpolitische Strategie des Co-Brandings. Die Arbeit zielt darauf ab, das Konzept des Co-Brandings zu definieren, in die Markenpolitik einzuordnen und von anderen Kooperationsformen abzugrenzen. Schließlich werden Chancen und Risiken dieser Strategie untersucht und ein Ausblick in die Zukunft gegeben.
- Definition und Einordnung von Co-Branding in die Markenpolitik
- Unterscheidung von Co-Branding zu anderen Kooperationsstrategien
- Analyse verschiedener Ausprägungsformen von Co-Branding
- Bewertung der Chancen und Risiken von Co-Branding
- Zukunftsperspektiven des Co-Brandings
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die omnipräsente Rolle von Marken im Konsumverhalten und unterstreicht deren Bedeutung für Unternehmen. Sie führt in die Thematik des Co-Brandings ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Wert starker Marken und deren strategische Bedeutung im Wettbewerb werden hervorgehoben, untermauert durch Beispiele wie den Kauf von Rowntree durch Nestlé. Die Einleitung legt den Grundstein für die folgende detaillierte Auseinandersetzung mit Co-Branding als markenpolitische Strategie.
2. Das Konzept von Co-Branding: Dieses Kapitel liefert eine fundierte Einführung in das Konzept des Co-Brandings. Es ordnet Co-Branding systematisch in die Markenpolitik ein, indem es die Unterscheidung zwischen Line-Extensions und Brand-Extensions erläutert. Anhand von Beispielen wie Milka (Line-Extension) und Joop! (Brand-Extension) werden die verschiedenen Strategien der Markenerweiterung verdeutlicht. Der Abschnitt über Brand Extensions führt schließlich zum Kernkonzept des Co-Brandings als eine Form der horizontalen, indirekten Markenerweiterung, die durch die Kombination von zwei bestehenden Marken gekennzeichnet ist.
3. Ausprägungsformen von Co-Branding und Beispiele der Umsetzung: Dieser Abschnitt befasst sich mit verschiedenen Ausprägungsformen des Co-Brandings, deren unterschiedliche Strategien und Umsetzungsmöglichkeiten im Detail analysiert werden. Durch die Präsentation von Praxisbeispielen wird die Vielfalt und Anwendbarkeit von Co-Branding in verschiedenen Branchen veranschaulicht. Es wird auf die unterschiedlichen Ziele und Ansätze der verschiedenen Co-Branding-Formen eingegangen, um ein umfassendes Verständnis des Konzepts zu ermöglichen.
4. Andere Kooperationsformen neben Co-Branding: Dieses Kapitel grenzt Co-Branding von ähnlichen Kooperationsformen ab. Joint Promotions, Sponsoring, Joint Ventures und Allianzen werden als alternative Strategien vorgestellt und im Vergleich zu Co-Branding hinsichtlich ihrer Zielsetzung, Umsetzung und Wirkung analysiert. Die Abgrenzung verdeutlicht die spezifischen Eigenschaften und den besonderen Nutzen des Co-Brandings im Vergleich zu anderen Kooperationsansätzen.
5. Chancen und Risiken des Co-Branding: Der fünfte Abschnitt beleuchtet die Chancen und Risiken, die mit dem Einsatz von Co-Branding verbunden sind. Es werden potenzielle Vorteile wie die Erhöhung der Markenbekanntheit und die Erschließung neuer Märkte diskutiert, aber auch mögliche Nachteile wie Konfliktpotenziale zwischen den Markenpartnern und Risiken für das Markenimage werden analysiert. Eine ausgewogene Betrachtung unterstützt die Beurteilung der strategischen Eignung von Co-Branding.
6. Co-Branding als Markenstrategie: In diesem Kapitel erfolgt eine umfassende Beurteilung von Co-Branding als Markenstrategie. Die vorherigen Kapitel werden zusammengefasst und die gewonnenen Erkenntnisse werden zur Bewertung des Potenzials und der Risiken dieser Strategie genutzt. Ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und Trends im Co-Branding rundet das Kapitel ab.
Schlüsselwörter
Co-Branding, Markenpolitik, Markenerweiterung, Line-Extension, Brand-Extension, Kooperationsstrategien, Markenimage, Chancen, Risiken, Markenbekanntheit, Wettbewerbsvorteil.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Co-Branding als Markenstrategie
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die markenpolitische Strategie des Co-Brandings. Sie definiert das Konzept, ordnet es in die Markenpolitik ein, grenzt es von anderen Kooperationsformen ab und untersucht schließlich Chancen und Risiken dieser Strategie mit einem Ausblick in die Zukunft.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Einordnung von Co-Branding in die Markenpolitik, Unterscheidung von Co-Branding zu anderen Kooperationsstrategien (wie Joint Promotions, Sponsoring, Joint Ventures und Allianzen), Analyse verschiedener Ausprägungsformen von Co-Branding (z.B. Reach Awareness, Values Endorsement, Ingredient und Complementary Competence Co-Branding), Bewertung der Chancen und Risiken von Co-Branding und Zukunftsperspektiven des Co-Brandings.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Das Konzept von Co-Branding (inkl. Line- und Brand-Extensions), Ausprägungsformen von Co-Branding und Beispiele, Andere Kooperationsformen neben Co-Branding, Chancen und Risiken des Co-Brandings und Co-Branding als Markenstrategie (inkl. Beurteilung und Zukunftsaussichten). Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was sind Line-Extensions und Brand-Extensions im Kontext von Co-Branding?
Die Arbeit erklärt den Unterschied zwischen Line-Extensions (Markenerweiterung innerhalb einer bestehenden Produktlinie, z.B. Milka) und Brand-Extensions (Markenerweiterung auf neue Produktkategorien, z.B. Joop!), um Co-Branding als eine Form der horizontalen, indirekten Markenerweiterung einzuordnen, bei der zwei bestehende Marken kombiniert werden.
Welche verschiedenen Ausprägungsformen von Co-Branding werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt und analysiert verschiedene Ausprägungsformen von Co-Branding, darunter Reach Awareness Co-Branding, Values Endorsement Co-Branding, Ingredient Co-Branding und Complementary Competence Co-Branding, jeweils mit Praxisbeispielen.
Wie grenzt sich Co-Branding von anderen Kooperationsformen ab?
Die Arbeit vergleicht Co-Branding mit Joint Promotions, Sponsoring, Joint Ventures und Allianzen, um die spezifischen Eigenschaften und den besonderen Nutzen von Co-Branding im Vergleich zu anderen Kooperationsansätzen hervorzuheben.
Welche Chancen und Risiken birgt Co-Branding?
Die Arbeit beleuchtet sowohl die potenziellen Vorteile von Co-Branding (z.B. erhöhte Markenbekanntheit, Erschließung neuer Märkte) als auch die möglichen Nachteile (z.B. Konfliktpotenziale zwischen Partnern, Risiken für das Markenimage).
Wie wird Co-Branding als Markenstrategie bewertet?
Das letzte Kapitel bewertet Co-Branding umfassend als Markenstrategie, fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und Trends.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Co-Branding, Markenpolitik, Markenerweiterung, Line-Extension, Brand-Extension, Kooperationsstrategien, Markenimage, Chancen, Risiken, Markenbekanntheit, Wettbewerbsvorteil.
- Quote paper
- Sabrina Wörz (Author), 2003, Co-Branding - Konzept, Umsetzung, Chancen und Risiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34169