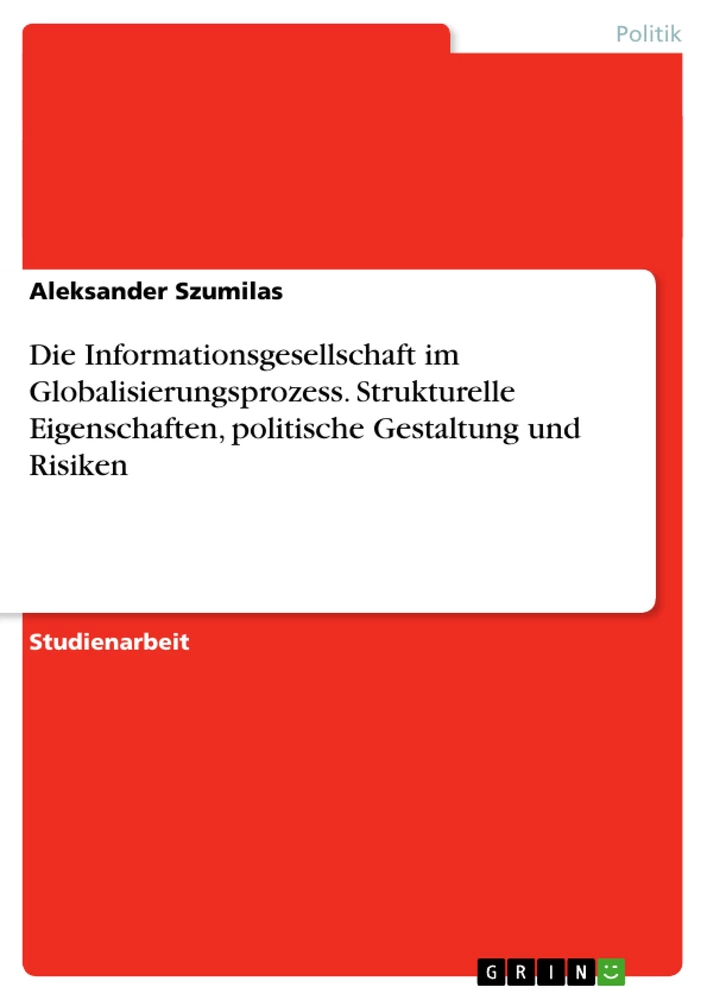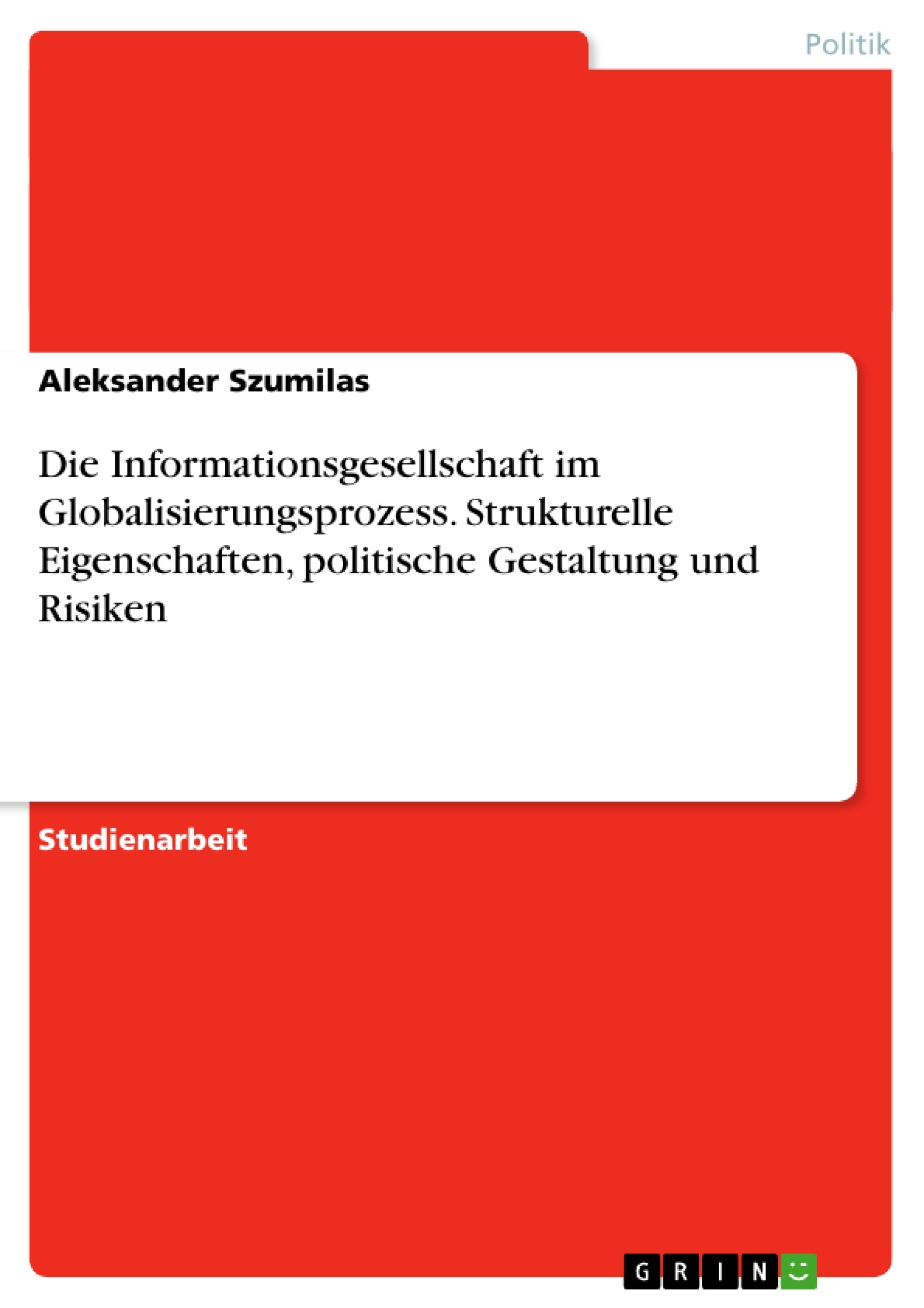Globalisierung, das Schlagwort in Politik, Ökonomie und Soziologie, bezeichnet mehr als nur transnationale Verflechtungen und zunehmende Interdependenz zwischen einzelnen Volkswirtschaften bzw. Märkten. Dass es eine Epoche bezeichnet, in der Kapitalströme so ungehindert wie noch nie zuvor zwischen Finanzmärken fließen und Börsenmakler die Anlagemöglichkeiten weltweit innerhalb kürzester Zeiten vergleichen können, ist lediglich eine der vielen Facetten der Globalisierung. Auch die Produktionsverlagerung einzelner Unternehmen in Niedriglohnländer, mit dem Ziel, die Kosten-Nutzen Relation im Bereich der Produktion ergiebig auszuschöpfen und sich auf dem Weltmarkt zu behaupten, ist nur ein weiterer – zwar nicht zu unrecht – aber dennoch lediglich zu sehr auf die ökonomische Seite ausgerichteter Blick. Viele Autoren beschränken sich auf die Analyse der Bestimmungszwänge durch den „Weltmarkt“ bzw. durch transnationale Konzerne, so auch Narr und Schubert, die von der „ Weltökonomie als Definitionsmacht“ ausgehen und durch eine etwas pessimistisch angehauchte Herangehensweise auffallen. Dies stellt der Leser spätestens dann fest, wenn die These einer übergeordneten und erfolgreichen Weltregierung zerschlagen wird und der „ Weltstaat gewaltförmigen Konflikten eher zuarbeite als diese eindämme.“ Doch auch komplexere und weiter ausgelegte Analysen liegen vor. Treffend differenziert beispielsweise Michael Zürn den Prozess der Globalisierung detaillierter aus. Hierbei versteht er die „Ausweitung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Handlungszusammenhänge über die politischen Grenzen des Nationalstaates hinaus.“ Somit bewegt sich die Betrachtungsweise neben der ökonomisch-politischen Dimension auch auf die soziologische Ebene. Darunter stoßen Fragen nach gesellschaftlichen Wandlungsprozessen ebenso auf wie eine Skepsis gegenüber traditionellen nationalstaatlichen Aufgaben und Handlungsweisen. Folglich sind nicht nur ökonomische Faktoren entscheidend, auch innergesellschaftlicher Wertewandel und ökologische Risiken sind relevant, so auch Zürn: „die Zerstörung der stratosphärischen Ozonschicht, die Klimaerwärmung, die Abnahme der Artenvielfalt, die zunehmende Wüstenbildung sind heute Ausdruck einer Weltrisikogesellschaft.“
Inhaltsverzeichnis
- DIE INFORMATIONSGESELLSCHAFT IM GLOBALISIERUNGSPROZESS
- STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN DER INFORMATIONSGESELLSCHAFT
- Neue Produktivkräfte
- Neue Informations- und Kommunikationstechnologien
- Wandel der Arbeit
- Zunehmende inner- und außergesellschaftliche Interdependenz
- POLITISCHER KONTEXT: PROZESSE AUF DER EBENE DER EUROPÄISCHEN UNION
- Vorgeschichte der Europäischen Telekommunikationspolitik
- Leitbild der „europäischen“ Informationsgesellschaft: einheitlicher Binnenmarkt im Telekommunikationssektor
- Liberalisierungsmaßnahmen und (erhoffte) Entwicklungen bzw. Potentiale der Informationsgesellschaft auf europäischer Ebene
- DIE INFORMATIONSGESELLSCHAFT UND DEREN ENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND
- Sozialpolitische Programme der Bundesregierung und deren Ministerien
- Wirtschaftsprogrammatische Maßnahmen und Zielsetzungen
- Umbau von Bürokratie. Ziel: effizientere staatliche Dienstleistungen und stei-gende Partizipationschancen der Bürger
- RISIKEN DER INFORMATIONSGESELLSCHAFT
- Problem der Sicherheit
- Neue soziale Risiken für das Individuum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen Informationsgesellschaft und Globalisierungsprozess. Sie untersucht die strukturellen Eigenschaften der Informationsgesellschaft, die politische Gestaltung auf EU- und Bundesebene und die damit verbundenen Risiken.
- Strukturelle Eigenschaften der Informationsgesellschaft
- Politische Gestaltung der Informationsgesellschaft in der EU
- Politische Gestaltung der Informationsgesellschaft in Deutschland
- Risiken der Informationsgesellschaft
- Zusammenhang von Informationsgesellschaft und Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Begriff der Informationsgesellschaft im Kontext der Globalisierung. Es wird deutlich, dass die Informationsgesellschaft nicht nur vom Globalisierungsprozess beeinflusst wird, sondern ihn auch gleichzeitig prägt.
Kapitel zwei befasst sich mit den strukturellen Eigenschaften der Informationsgesellschaft. Hierbei werden neue Produktivkräfte, Informations- und Kommunikationstechnologien, Wandel der Arbeit und die zunehmende Interdependenz innerhalb und außerhalb von Gesellschaften beleuchtet.
Kapitel drei untersucht den politischen Kontext der Informationsgesellschaft auf EU-Ebene. Es werden die Vorgeschichte der Europäischen Telekommunikationspolitik, das Leitbild der „europäischen“ Informationsgesellschaft und die Liberalisierungsmaßnahmen mit ihren erhofften Entwicklungen und Potentialen betrachtet.
Kapitel vier beschäftigt sich mit der Entwicklung der Informationsgesellschaft in Deutschland. Es werden sozialpolitische Programme der Bundesregierung, wirtschaftsprogrammatische Maßnahmen und Zielsetzungen sowie der Umbau der Bürokratie mit dem Ziel effizienterer staatlicher Dienstleistungen und steigender Partizipationschancen der Bürger vorgestellt.
Kapitel fünf analysiert mögliche Risiken der Informationsgesellschaft. Es werden das Problem der Sicherheit und neue soziale Risiken für das Individuum beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind Informationsgesellschaft, Globalisierung, Strukturwandel, politische Gestaltung, EU, Deutschland, Risiken. Es werden die neuen Produktivkräfte, Informations- und Kommunikationstechnologien und der Wandel der Arbeit im Kontext der Informationsgesellschaft untersucht.
- Quote paper
- Aleksander Szumilas (Author), 2004, Die Informationsgesellschaft im Globalisierungsprozess. Strukturelle Eigenschaften, politische Gestaltung und Risiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34165