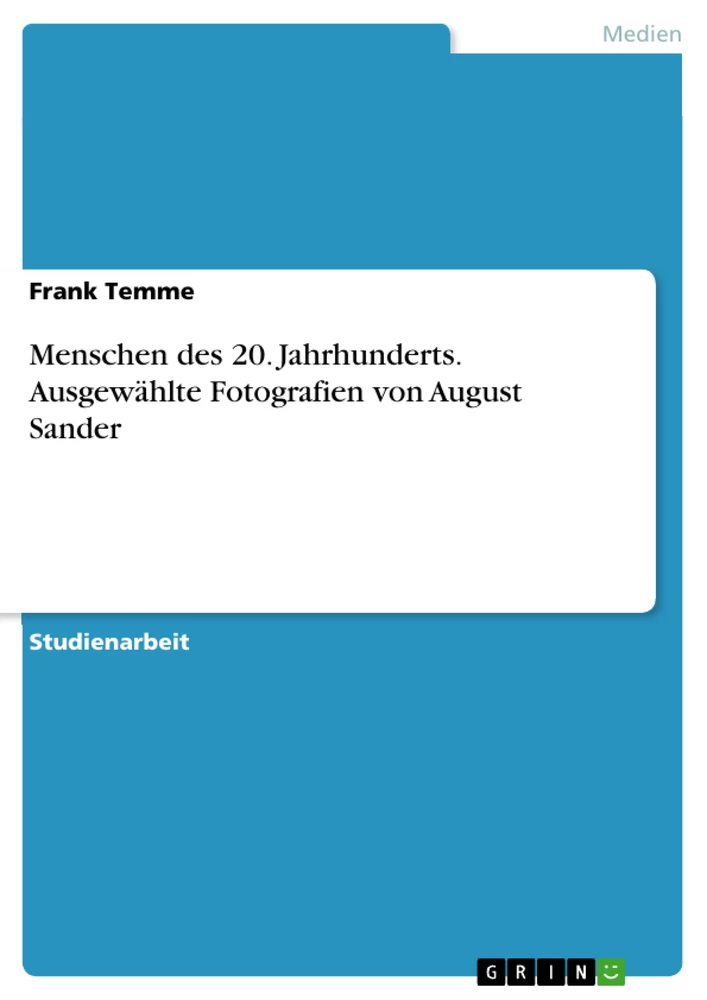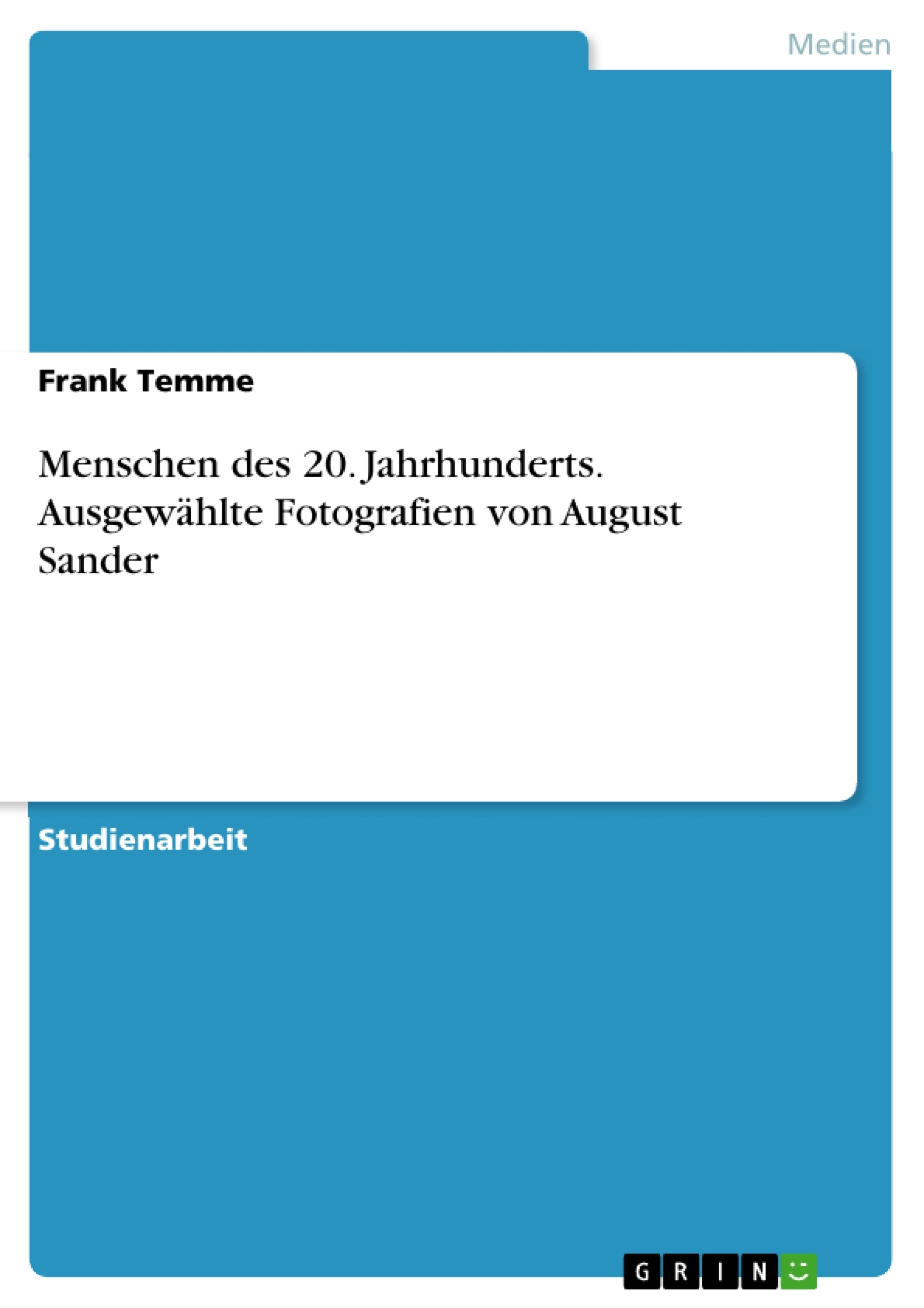Vieles wurde über den Bildband Menschen des 20. Jahrhunderts des deutschen Fotografen August Sander geschrieben. Laut dem Kunstkritiker John Berger habe „[k]ein anderer Photograph, der Porträtaufnahmen seiner eigenen Landsleute machte, […] je auf so klare Weise dokumentarisch gearbeitet“ (Berger 1981, 27). Ziel dieser Dokumentation sei es gewesen, „archetypische Repräsentanten für jeden möglichen Typus, jede soziale Klasse, jede Unterklasse, jede Beschäftigung, jede Berufung und jedes Privileg zu finden“ (Berger 1981, 27). Auch Sanders Freund Alfred Döblin schrieb, über Sanders Fotografie „die Bilder sind im ganzen ein blendendes Material für die Kultur-, Klassen- und Wirtschaftsgeschichte“ (Sander 1990, 14), sogar „ eine Art Kulturgeschichte, besser Soziologie“ (ebd. 13) der damaligen Zeit. Die Bilder stellen eine Typologie der Weimarer Gesellschaft dar (Baker 1996, 76). Sander selbst glaubte an die Objektivität seiner Bilder (ebd. 80). Demnach erheben sie einen Anspruch auf Repräsentation der damaligen Gesellschaft. Doch wie kann man eine ganze Gesellschaft in nur einer Arbeit repräsentieren?
Um dieser Frage nachzugehen, werden in einem ersten Schritt Theorien der Fotografie erläutert. Diese dienen als Anleitung zur Bildanalyse. Grundlegend für die Bildanalyse sind das Essay Die helle Kammer des französischen Semiotikers Roland Barthes, sowie einige Gedanken des britischen Kunstkritikers John Berger, der sich sowohl mit der Theorie Roland Barthes' als auch mit Fotografien von August Sander auseinandersetzte.
Nachdem mit Barthes und Berger ein theoretischer Rahmen zur Analyse gegeben ist, werden im zweiten Schritt dieser Arbeit Sanders Grundannahmen, Intentionen und Theorien erörtert und kontextualisiert. Drittens werden ausgewählte Fotografien von Sander mithilfe oben genannter Theorien analysiert. Die Auswahl der Fotografien wird durch die Anziehungskraft der Fotos auf den Autoren dieser Arbeit getroffen. Wie Barthes möchte er „die Anziehungskraft, die bestimmte Photos auf [ihn] [ausüben], zum Leitfaden [der] Untersuchung […] machen“ (Barthes 1989, 26). Viertens und letztens wird, diese Arbeit abschließend, eine kritische Betrachtung der drei anderen Kapitel erfolgen, in der der Autor die eingangs genannte Frage wieder aufgreift und zu beantworten versucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorien der Fotografie
- Roland Barthes - Die helle Kammer
- studium
- punctum
- Detail
- Zeit
- John Berger: Erscheinungen
- Roland Barthes - Die helle Kammer
- August Sander
- Menschen des 20. Jahrhunderts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht August Sanders Fotoband "Menschen des 20. Jahrhunderts" und hinterfragt dessen Anspruch auf Repräsentation der damaligen Gesellschaft. Die Analyse stützt sich auf Theorien der Fotografie, insbesondere die Arbeiten von Roland Barthes und John Berger. Der Fokus liegt auf der Interpretation ausgewählter Fotografien und deren Aussagekraft im Kontext der Weimarer Republik.
- Die Repräsentation der Gesellschaft in fotografischen Werken.
- Anwendung von Theorien der Fotografie (Barthes, Berger) auf die Bildanalyse.
- Die Objektivität und Subjektivität in der fotografischen Darstellung.
- Die soziale und kulturelle Bedeutung von Sanders Fotografien.
- Die Wirkung der Fotografien auf den Betrachter.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Repräsentationsfähigkeit von Sanders Fotoband in Bezug auf die gesamte Gesellschaft. Sie umreißt die Methodik der Arbeit, die auf der Anwendung von Fotografie-Theorien (Barthes, Berger) und der Analyse ausgewählter Bilder basiert. Die Auswahl der Bilder erfolgt nach der subjektiven Anziehungskraft auf den Autor, ähnlich Barthes' Ansatz.
Theorien der Fotografie: Dieses Kapitel definiert Fotografie als Abstraktum und Konkretum und wählt für die Analyse den konkreten Ansatz. Es stellt den Essay "Die helle Kammer" von Roland Barthes und die Gedanken von John Berger vor, die als theoretischer Rahmen für die anschließende Bildanalyse dienen. Barthes' Konzept des "punctum" und die Idee der Fotografie als "reine Hinweis-Sprache" werden hier erläutert und ihre Bedeutung für die Interpretation hervorgehoben. Die verschiedenen Perspektiven des Betrachters, des Betrachteten und des Fotografen werden diskutiert und der Tod als "eigentümliches Wesen" der Fotografie nach Barthes herausgestellt. Die "Anziehungskraft" eines Fotos wird als "Abenteuer" bezeichnet, das den Betrachter affektiert.
August Sander: Dieses Kapitel beleuchtet die Grundannahmen, Intentionen und Theorien von August Sander selbst, um seine Fotografien im Kontext zu verstehen. Es stellt Sander's Zielsetzung vor, archetypische Repräsentanten der Weimarer Gesellschaft abzubilden, und diskutiert die Frage nach der Objektivität seiner Arbeit. Es wird die Rezeption von Sanders Werk durch Kritiker wie John Berger und Alfred Döblin einbezogen, die dessen Bedeutung für die Kultur-, Klassen- und Wirtschaftsgeschichte hervorheben.
Schlüsselwörter
August Sander, Menschen des 20. Jahrhunderts, Fotografie, Bildanalyse, Roland Barthes, John Berger, Repräsentation, Objektivität, Subjektivität, Weimarer Republik, Soziologie, Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von August Sanders "Menschen des 20. Jahrhunderts"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert August Sanders Fotoband "Menschen des 20. Jahrhunderts" und untersucht dessen Anspruch auf Repräsentation der Gesellschaft der Weimarer Republik. Die Analyse basiert auf den Theorien von Roland Barthes und John Berger.
Welche Theorien der Fotografie werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Roland Barthes' "Die helle Kammer", insbesondere sein Konzept des "punctum", und die Arbeiten von John Berger. Es wird die Fotografie sowohl als Abstraktum als auch Konkretum betrachtet, wobei der Fokus auf dem konkreten Ansatz liegt. Die Perspektiven des Betrachters, des Betrachteten und des Fotografen werden diskutiert.
Wie wird die Bildanalyse durchgeführt?
Die Bildanalyse basiert auf der Anwendung der Fotografie-Theorien von Barthes und Berger auf ausgewählte Fotografien aus Sanders Werk. Die Auswahl der Bilder erfolgte nach der subjektiven Anziehungskraft auf den Autor, ähnlich Barthes' Ansatz. Die Arbeit untersucht die Objektivität und Subjektivität in der fotografischen Darstellung.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Repräsentation der Gesellschaft in fotografischen Werken, die Anwendung von Fotografie-Theorien auf die Bildanalyse, die Objektivität und Subjektivität in der fotografischen Darstellung, die soziale und kulturelle Bedeutung von Sanders Fotografien und deren Wirkung auf den Betrachter.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu den Theorien der Fotografie (Barthes und Berger), ein Kapitel zu August Sander und seinen Fotografien, und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Methodik vor. Das Kapitel zu den Theorien dient als theoretischer Rahmen für die Bildanalyse. Das Kapitel zu Sander beleuchtet seine Intentionen und die Rezeption seines Werks.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
August Sander, Menschen des 20. Jahrhunderts, Fotografie, Bildanalyse, Roland Barthes, John Berger, Repräsentation, Objektivität, Subjektivität, Weimarer Republik, Soziologie, Kulturgeschichte.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, inwieweit Sanders Fotoband "Menschen des 20. Jahrhunderts" tatsächlich die gesamte Gesellschaft der Weimarer Republik repräsentiert.
Wie wird die "Anziehungskraft" eines Fotos im Kontext von Barthes beschrieben?
Die "Anziehungskraft" eines Fotos wird von Barthes als "Abenteuer" bezeichnet, das den Betrachter affektiert.
Welche Bedeutung hat der "punctum" nach Barthes?
Der "punctum" bei Barthes beschreibt einen unerwarteten, detaillierten Aspekt im Bild, der den Betrachter zusätzlich anspricht und die Bedeutung des Bildes erweitert (z.B. ein Detail oder ein Moment).
- Quote paper
- Frank Temme (Author), 2014, Menschen des 20. Jahrhunderts. Ausgewählte Fotografien von August Sander, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341208