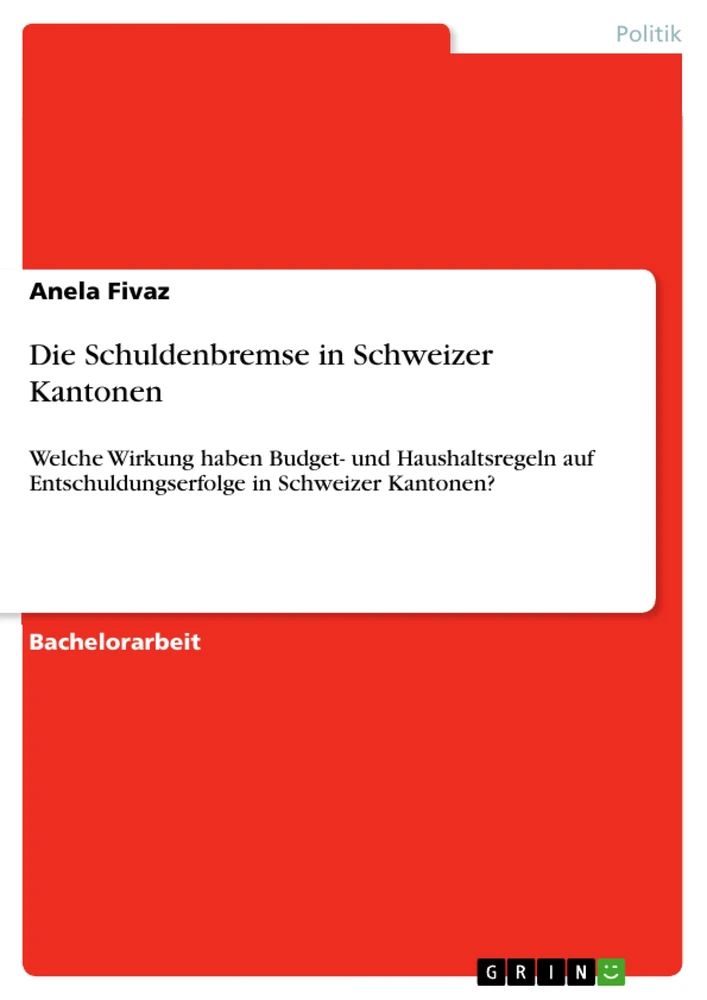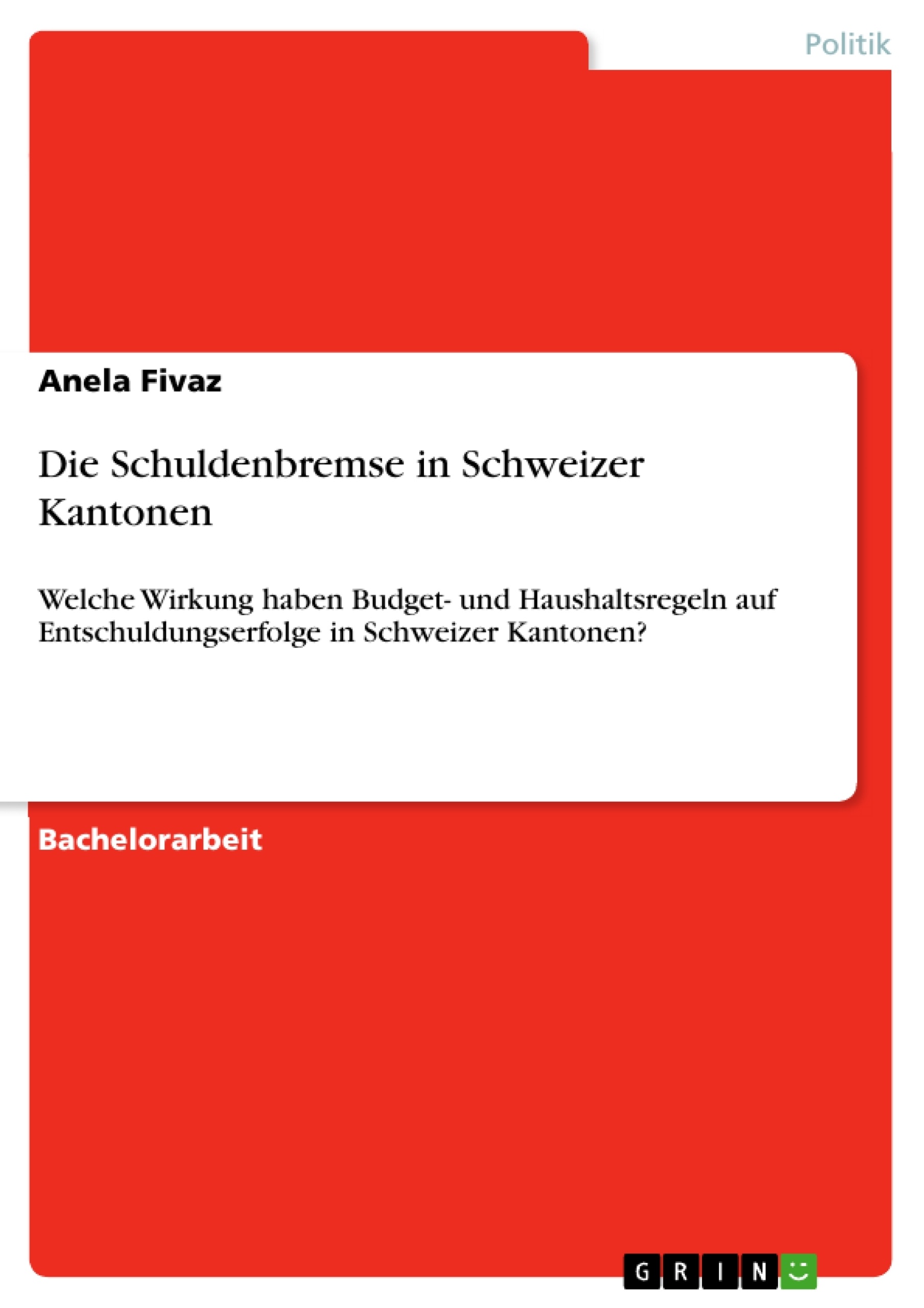In der Arbeit wird die Frage beantwortet, welchen Einfluss die Ausgestaltung von institutionellen und prozeduralen Regeln auf die Finanzsituation eines Kantons oder eines Bundeslandes hat. Verbessert sich die finanzielle Situation mit Zunahme der Regeldichte und Strenge? Oder ist es genau umgekehrt und die Kantone können besser wirtschaften, wenn sie frei und flexibel entscheiden können und keinen allzu strengen Vorgaben zu Budgetierung und Haushalt unterliegen?
Konkret ergibt sich für diese Arbeit folgende Frage: Gibt es auf der Ebene der Schweizer Kantone einen messbaren Zusammenhang zwischen Restriktivität der Haushaltsregeln und Entschuldungserfolg? Darüber hinaus soll auch geklärt werden, ob und wie solche Erkenntnisse auf die deutschen Bundesländer übertragen werden könnten.
Die Schweizer Schuldenbremse wird in den Medien immer wieder als Exportschlager und Erfolgsmodel gefeiert. Dies kommt nicht von ungefähr, denn die Schweiz kann hier sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene Erfolge vorweisen. Im internationalen Schuldenvergleich hat die Schweiz zwischen 2007 und 2015 beispielsweise sieben Prozentpunkte der Schuldenquote abgebaut; nur Norwegen kann noch einen ähnlichen Erfolg vorweisen. Alle anderen Länder im Europaraum sehen sich in demselben Zeitraum mit einer teilweise drastisch gestiegenen Schuldenquote konfrontiert.
Im direkten Vergleich der Staatsschulden Deutschlands und der Schweiz wird deutlich, dass sehr unterschiedliche Entwicklungen stattgefunden haben. Die Bruttoschuldenquote der Schweiz stieg in den 1990er Jahren an und erreichte 2003 mit 26,1% ihren Höchststand. Zwischen 2005 und 2012 konnte ein stetiger Schuldenrückbau verzeichnet werden. 2014 betrug die Bruttoschuldenquote nur noch 16,8%. Im Vergleich zu 2013 hat sie im Jahr 2014 um 0,8 Prozentpunkte abgenommen. Absolut gemessen hat die Bruttoschuld von 2013 zu 2014 weitere 2,8 Milliarden abgenommen und betrug 2014 rund 108 Milliarden Franken. In Deutschland ist ein anderer Trend zu konstatieren: Die Schuldenquote steigt seit Anfang der 1970er Jahre stetig an. Vorher lag sie konstant unter 20 %.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Rahmenbedingungen in der Schweiz und in Deutschland
- 2.1 Schweiz: Föderalismus
- 2.2 Schweizer Kantone und kantonale Verwaltung
- 2.3 Schweiz: Finanz- und Haushaltsgesetze / Schuldenbremse
- 2.4 Deutschland: Die Bundesländer in Deutschland
- 2.5 Deutschland: Föderalismusreformen und Schuldenbremse
- 2.6 Fragestellung und Thesen
- 3. Begriffsdefinitionen/Grundlagen
- 3.1 Schulden und Schuldenquote
- 3.2 Schuldenbremse
- 3.3 Budget- und Haushaltsregeln
- 4. Methodenwahl und Forschungsdesign
- 4.1 Aktueller Forschungsstand
- 4.2 Theoretische Grundlage – Rational-Choice-Institutionalismus
- 4.3 Ursachen der Verschuldung
- 4.3.1 Politische Konjunkturzyklen
- 4.3.2 Strategische Staatsverschuldung
- 4.3.3 „Allmende-Problematik“
- 4.3.4 Institutionelle Budgetregeln
- 4.4 Forschungsdesign – Korrelationsanalyse
- 4.4.1 Entwicklung der Schulden je Einwohner im Kanton - Variable 1
- 4.4.2 Grad der Reglementierung von Budget- und Haushaltsregeln – Variable 2
- 5. Analyse
- 5.1 Durchführung der Korrelationsanalyse
- 5.2 Bewertung
- 5.2.1 Ergebnis
- 5.2.2 Grenzen der Arbeit und weitere Einflüsse
- 5.3 Übertragbarkeit auf die Bundesländer in Deutschland
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Einfluss von Budget- und Haushaltsregeln auf die Entschuldungserfolge in Schweizer Kantonen. Die Arbeit analysiert, inwieweit die sogenannte „Schuldenbremse“ und ähnliche Regelungen zu einer Reduktion der Staatsverschuldung beitragen. Im Fokus steht der Vergleich zwischen verschiedenen Kantonen und deren unterschiedlichen Regelungsansätzen.
- Wirkung von Budget- und Haushaltsregeln auf die kantonale Verschuldung in der Schweiz
- Vergleich der Schweizer Kantone hinsichtlich ihrer Finanzdisziplin und Entschuldungsstrategien
- Analyse des Einflusses des Föderalismus auf die Haushaltspolitik der Kantone
- Untersuchung der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Bundesländer in Deutschland
- Anwendung des Rational-Choice-Institutionalismus als theoretisches Framework
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Diese Einleitung führt in das Thema der Schuldenbremse in Schweizer Kantonen ein und beschreibt den Forschungsgegenstand sowie die Forschungsfrage der Arbeit. Es werden die Relevanz des Themas und der Forschungsansatz erläutert, um den Leser auf die folgenden Kapitel vorzubereiten. Die Arbeit stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Wirkung von Budget- und Haushaltsregeln auf die Entschuldungserfolge in den Schweizer Kantonen. Sie dient als Grundlage für die detailliertere Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen, Begriffen und Methoden in den nachfolgenden Kapiteln.
2. Rahmenbedingungen in der Schweiz und in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die relevanten Rahmenbedingungen in der Schweiz und in Deutschland. Es vergleicht den Föderalismus beider Länder und analysiert die Strukturen der kantonalen Verwaltung in der Schweiz sowie die Finanz- und Haushaltsgesetze, inklusive der Schuldenbremse. Der Vergleich mit den deutschen Bundesländern und deren Föderalismusreformen dient der Einordnung und Kontextualisierung der Schweizer Situation. Die Kapitel beschreibt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden föderalen Systeme und ihrer jeweiligen Ansätze zur Haushaltskontrolle.
3. Begriffsdefinitionen/Grundlagen: Hier werden zentrale Begriffe wie „Schulden“, „Schuldenquote“, „Schuldenbremse“ und „Budget- und Haushaltsregeln“ präzise definiert. Dieses Kapitel legt die Grundlage für ein gemeinsames Verständnis der zentralen Konzepte und vermeidet Missverständnisse. Die klare Definition der Begriffe ist essentiell für die methodische Fundiertheit und die Transparenz der Analyse im weiteren Verlauf der Arbeit.
4. Methodenwahl und Forschungsdesign: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit, beginnend mit einer Darstellung des aktuellen Forschungsstandes. Es wird die theoretische Grundlage, der Rational-Choice-Institutionalismus, eingeführt und erläutert, wie dieser die Analyse der Ursachen der Verschuldung und den Einfluss von institutionellen Regelungen auf das Verhalten der Akteure beeinflusst. Das Forschungsdesign, eine Korrelationsanalyse, wird detailliert vorgestellt, inklusive der Definition der verwendeten Variablen. Die verschiedenen Ursachen für die Verschuldung werden im Detail beleuchtet und mit dem gewählten Forschungsdesign in Verbindung gesetzt.
5. Analyse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Korrelationsanalyse. Es beschreibt die Methodik der Analyse, die Auswertung der Daten und die Interpretation der Ergebnisse. Die Bewertung der Ergebnisse beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen der Arbeit und der Berücksichtigung weiterer potenzieller Einflussfaktoren, die über die ausgewählten Variablen hinausgehen könnten. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Bundesländer in Deutschland wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Schuldenbremse, Schweizer Kantone, Budgetregeln, Haushaltspolitik, Föderalismus, Staatsverschuldung, Rational-Choice-Institutionalismus, Korrelationsanalyse, Finanzdisziplin, Entschuldung, Deutschland, Bundesländer.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Einfluss von Budget- und Haushaltsregeln auf die Entschuldungserfolge in Schweizer Kantonen
Was ist das Thema dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Budget- und Haushaltsregeln, insbesondere der „Schuldenbremse“, auf die Entschuldungserfolge in Schweizer Kantonen. Sie vergleicht verschiedene Kantone und deren Regelungsansätze und analysiert die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die deutschen Bundesländer.
Welche Forschungsfrage wird untersucht?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wirken sich Budget- und Haushaltsregeln auf die Entschuldungserfolge in den Schweizer Kantonen aus?
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine Korrelationsanalyse, um den Zusammenhang zwischen dem Grad der Reglementierung von Budget- und Haushaltsregeln und der Schuldenentwicklung pro Einwohner in den Kantonen zu untersuchen. Die theoretische Grundlage bildet der Rational-Choice-Institutionalismus.
Welche Variablen werden analysiert?
Die wichtigsten Variablen sind die Entwicklung der Schulden je Einwohner im Kanton und der Grad der Reglementierung von Budget- und Haushaltsregeln.
Welche Länder werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Schweizer Kantone untereinander und setzt die Ergebnisse in Bezug zu den deutschen Bundesländern, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede im föderalen System und den Ansätzen zur Haushaltskontrolle aufzuzeigen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Rahmenbedingungen in der Schweiz und Deutschland, Begriffsdefinitionen/Grundlagen, Methodenwahl und Forschungsdesign, Analyse, Fazit und Ausblick.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Schuldenbremse, Schweizer Kantone, Budgetregeln, Haushaltspolitik, Föderalismus, Staatsverschuldung, Rational-Choice-Institutionalismus, Korrelationsanalyse, Finanzdisziplin, Entschuldung, Deutschland und Bundesländer.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit?
Die konkreten Ergebnisse der Korrelationsanalyse werden im Kapitel „Analyse“ präsentiert. Die Bewertung der Ergebnisse beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen der Arbeit und der Berücksichtigung weiterer potenzieller Einflussfaktoren.
Welche theoretische Grundlage wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem Rational-Choice-Institutionalismus, um das Verhalten der Akteure und den Einfluss von institutionellen Regelungen auf die Verschuldung zu analysieren.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen und der Ausblick werden im letzten Kapitel der Arbeit dargelegt. Es wird diskutiert, inwieweit die Ergebnisse auf andere föderale Systeme übertragbar sind.
- Quote paper
- Anela Fivaz (Author), 2016, Die Schuldenbremse in Schweizer Kantonen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341177