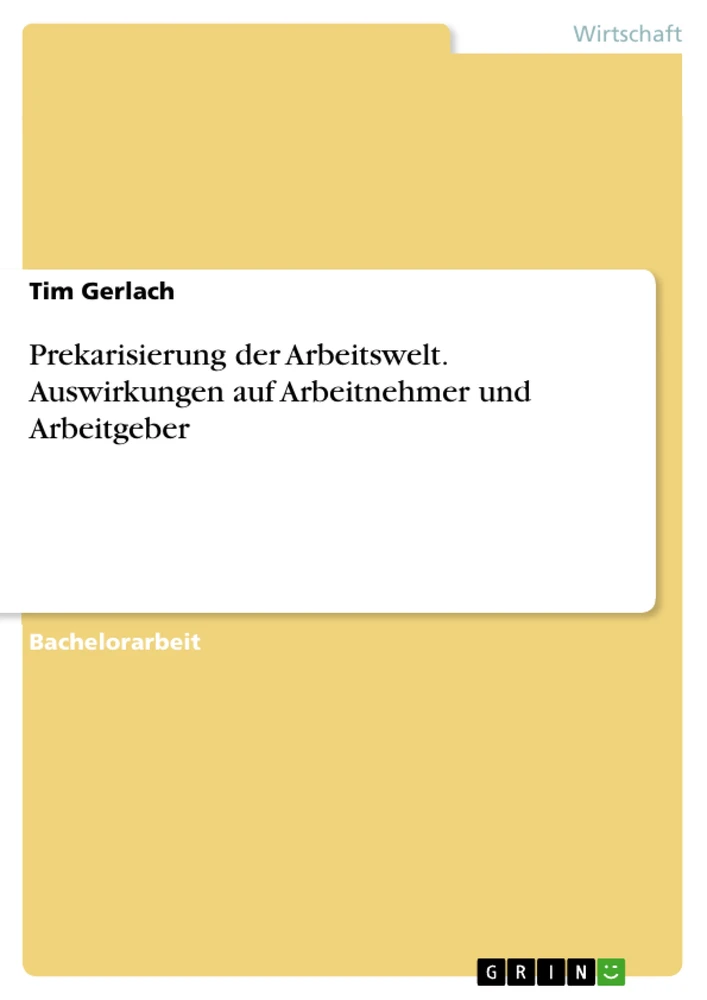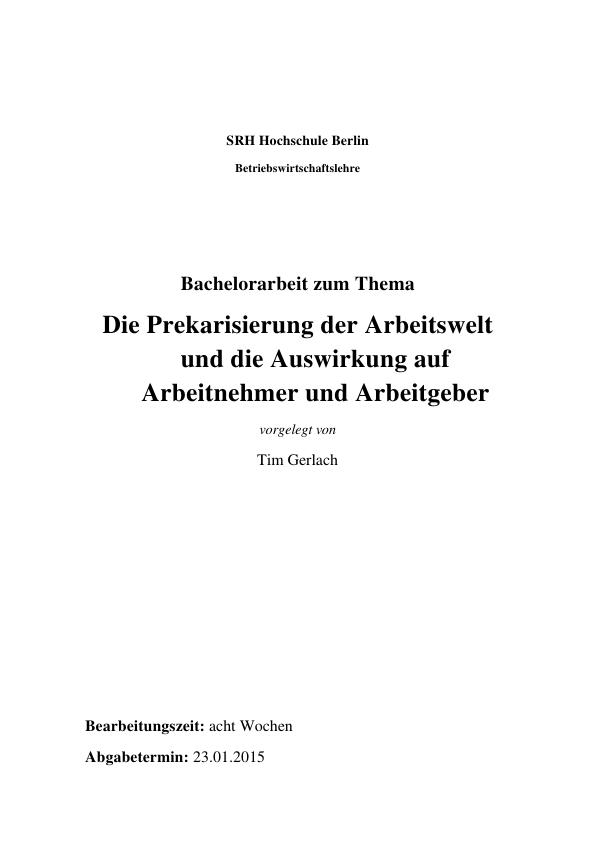Ziel dieser Arbeit ist es den Einfluss prekärer Beschäftigungsverhältnisse im Dienstleistungssektor, sowohl auf den Arbeitnehmer als auch auf den Arbeitgeber, zu untersuchen.
Die zunehmende Verwendung atypischer Beschäftigungsmodelle von Unternehmen zeigt eine Veränderung innerhalb der Beschäftigungsverhältnisse abseits des Normalarbeitsverhältnisses auf. Daraus resultieren zukünftige Änderungen in der Bedeutung von Humankapital für Unternehmen in einer modernen Arbeitswelt. Um als Unternehmen im zukünftigen internationalen Wettbewerb einer globalisierten Welt bestehen zu können, dienen atypische Beschäftigungsverhältnisse als kostengünstige Ausweichmöglichkeit abseits von traditionellen Beschäftigungsverhältnissen. Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren durch Schwankungen im Bedarf an Erwerbstätigen und Strukturverschiebungen dargestellt.
Ausgehend vom historischen Kontext der Prekarisierung und dessen Entstehungsgeschichte wird der verwendete Kontext des Begriffes der Prekarisierung verdeutlicht. Im Weiteren folgt eine Betrachtung der bestehenden sowie für die Arbeit relevanten Beschäftigungsverhältnisse. Im theoretischen Kontext werden einzelne Beschäftigungsformen hinführend zur ihrer Bedeutung innerhalb der Prekaritätsdebatte untersucht. Die Existenz prekärer Beschäftigungsverhältnisse im deutschen Arbeitsmarkt und Dienstleistungssektors werden dargestellt. Anhand der Ergebnisse einer Betrachtung des deutschen Arbeitsmarktes und Dienstleistungssektors werden ausschlaggebende Faktoren und Sektoren sowie besonders von Prekarität betroffene Beschäftigungsverhältnisse aufgezeigt. Darauf aufbauend werden die Bedeutungen, sowie Auswirkungen prekärer Beschäftigungsverhältnisse auf den Arbeitgeber und Arbeitnehmer dargestellt. Nach der Betrachtung von einem spezifischen Fallbeispiel innerhalb des Dienstleistungssektors, erfolgt die Ableitung möglicher Handlungsfelder und Handlungsoptionen unter arbeitsmarktpolitischen und unternehmerischen Gesichtspunkten. Daraus folgt das Fazit und es wird ein Ausblick für eine genauere Betrachtung des Themenfeldes vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Hintergrund der Arbeit
- 1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
- 2. Historischer Kontext der Prekarisierung
- 3. Theoretischer Rahmen der Beschäftigungsformen
- 3.1 Das Normalarbeitsverhältnis
- 3.2 Atypische Beschäftigung
- 3.3 Prekäre Beschäftigung
- 4. Gesamtübersicht über die Beschäftigungsstruktur am Arbeitsmarkt und Dienstleistungssektor in Deutschland
- 4.1 Situation des deutschen Arbeitsmarktes und Dienstleistungssektors
- 4.2 Niedriglohnsektor
- 4.3 Kategorische Betrachtung des Dienstleistungssektors bei Leiharbeitsverhältnissen
- 5. Einfluss und Auswirkungen prekärer Beschäftigungsverhältnisse auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber
- 5.1 Einfluss auf den Arbeitgeber
- 5.2 Einfluss auf den Arbeitnehmer
- 6. Handlungsfelder und Handlungsmöglichkeiten
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss prekärer Beschäftigungsverhältnisse im deutschen Dienstleistungssektor auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Studie beleuchtet den historischen Kontext der Prekarisierung, analysiert verschiedene Beschäftigungsformen und deren Bedeutung im Kontext von Prekarität, und beschreibt die Beschäftigungsstruktur des deutschen Arbeitsmarktes und Dienstleistungssektors mit einem Fokus auf den Niedriglohnsektor. Schließlich werden die Auswirkungen prekärer Beschäftigung auf beide Seiten des Arbeitsverhältnisses untersucht und mögliche Handlungsfelder aufgezeigt.
- Historische Entwicklung der Prekarisierung und deren begriffliche Einordnung
- Analyse verschiedener Beschäftigungsformen (Normalarbeitsverhältnis, atypische und prekäre Beschäftigung)
- Beschäftigungsstruktur im deutschen Arbeitsmarkt und Dienstleistungssektor, insbesondere im Niedriglohnsektor
- Auswirkungen prekärer Beschäftigung auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber
- Mögliche Handlungsfelder und -optionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel der deutschen Arbeitslandschaft im 21. Jahrhundert, geprägt von Globalisierung, Digitalisierung und Wertewandel. Sie hebt die zunehmende Bedeutung prekärer Beschäftigungsverhältnisse hervor und benennt das Ziel der Arbeit: die Untersuchung des Einflusses dieser Verhältnisse auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Dienstleistungssektor. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert, der von einem historischen Kontext über theoretische Rahmenbedingungen zu einer empirischen Analyse und schließlich zu Handlungsempfehlungen führt.
2. Historischer Kontext der Prekarisierung: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Prekarisierung im Kontext der Arbeitswelt. Es differenziert zwischen den Begriffen "prekär" und "Prekarität" und beschreibt den Wandel von der traditionellen Arbeitsgesellschaft der Nachkriegszeit mit Vollbeschäftigung und Normalarbeitsverhältnissen hin zu einer zunehmend unsicheren Beschäftigungslandschaft. Die Entstehung und Entwicklung atypischer Beschäftigungsformen werden im Zusammenhang mit der Globalisierung und den Veränderungen im Wohlfahrtsstaat analysiert.
3. Theoretischer Rahmen der Beschäftigungsformen: Dieses Kapitel stellt verschiedene Beschäftigungsformen vor, um den Begriff der Prekarität zu verdeutlichen. Es analysiert das Normalarbeitsverhältnis als traditionellen Gegenpol zu atypischen und prekären Beschäftigungsformen. Die Charakteristika verschiedener Beschäftigungsmodelle werden detailliert beschrieben und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile im Hinblick auf Sicherheit, Einkommen und Arbeitsbedingungen abgewogen. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und der Abgrenzung der einzelnen Beschäftigungsformen und ihrer Relevanz für die Prekaritätsdebatte.
4. Gesamtübersicht über die Beschäftigungsstruktur am Arbeitsmarkt und Dienstleistungssektor in Deutschland: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Beschäftigungsstruktur in Deutschland, insbesondere im Dienstleistungssektor. Es analysiert die Situation des deutschen Arbeitsmarktes, den Niedriglohnsektor und die Bedeutung von Leiharbeit. Hier werden wichtige Kennzahlen und statistische Daten präsentiert, die den Anteil und die Verbreitung prekärer Beschäftigungsverhältnisse im Dienstleistungssektor aufzeigen, sowie die damit verbundenen sozioökonomischen Folgen beleuchten.
5. Einfluss und Auswirkungen prekärer Beschäftigungsverhältnisse auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber: Dieses Kapitel untersucht die Folgen prekärer Beschäftigungsverhältnisse für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Es beleuchtet die Auswirkungen auf die Arbeitnehmerseite (z.B. Einkommenssicherheit, soziale Absicherung, Arbeitsbedingungen) und die Arbeitgeberseite (z.B. Kosten, Flexibilität, Personalmanagement). Die Analyse konzentriert sich darauf, wie prekäre Beschäftigung die jeweiligen Interessenlagen beeinflusst und welche Herausforderungen sich daraus ergeben.
Schlüsselwörter
Prekarisierung, atypische Beschäftigung, Normalarbeitsverhältnis, Dienstleistungssektor, Niedriglohnsektor, Arbeitsmarkt, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Flexibilität, Einkommenssicherheit, soziale Absicherung, Handlungsfelder, Arbeitsmarktpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss prekärer Beschäftigungsverhältnisse im deutschen Dienstleistungssektor
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss prekärer Beschäftigungsverhältnisse im deutschen Dienstleistungssektor auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Sie beleuchtet den historischen Kontext der Prekarisierung, analysiert verschiedene Beschäftigungsformen und deren Bedeutung im Kontext von Prekarität, und beschreibt die Beschäftigungsstruktur des deutschen Arbeitsmarktes und Dienstleistungssektors mit einem Fokus auf den Niedriglohnsektor. Schließlich werden die Auswirkungen prekärer Beschäftigung auf beide Seiten des Arbeitsverhältnisses untersucht und mögliche Handlungsfelder aufgezeigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: die historische Entwicklung der Prekarisierung und deren begriffliche Einordnung; die Analyse verschiedener Beschäftigungsformen (Normalarbeitsverhältnis, atypische und prekäre Beschäftigung); die Beschäftigungsstruktur im deutschen Arbeitsmarkt und Dienstleistungssektor, insbesondere im Niedriglohnsektor; die Auswirkungen prekärer Beschäftigung auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber; und mögliche Handlungsfelder und -optionen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) beschreibt den Kontext und die Zielsetzung. Kapitel 2 (Historischer Kontext) beleuchtet die Entwicklung der Prekarisierung. Kapitel 3 (Theoretischer Rahmen) analysiert verschiedene Beschäftigungsformen. Kapitel 4 (Beschäftigungsstruktur) gibt einen Überblick über den deutschen Arbeitsmarkt und Dienstleistungssektor. Kapitel 5 (Einfluss und Auswirkungen) untersucht die Folgen prekärer Beschäftigung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Kapitel 6 (Handlungsfelder) zeigt Handlungsmöglichkeiten auf. Kapitel 7 (Fazit und Ausblick) rundet die Arbeit ab.
Wie wird der Begriff "Prekarität" in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit differenziert zwischen den Begriffen "prekär" und "Prekarität" und analysiert verschiedene Beschäftigungsformen (Normalarbeitsverhältnis, atypische und prekäre Beschäftigung), um den Begriff der Prekarität zu verdeutlichen und die Charakteristika der einzelnen Modelle im Hinblick auf Sicherheit, Einkommen und Arbeitsbedingungen abzuwägen.
Welche Rolle spielt der Dienstleistungssektor und der Niedriglohnsektor in der Analyse?
Der Dienstleistungssektor steht im Mittelpunkt der Analyse, da hier ein hoher Anteil prekärer Beschäftigungsverhältnisse vermutet wird. Der Niedriglohnsektor wird als wichtiger Teilbereich des Dienstleistungssektors betrachtet und seine Bedeutung für die Prekaritätsdebatte hervorgehoben. Die Arbeit präsentiert wichtige Kennzahlen und statistische Daten zum Anteil und zur Verbreitung prekärer Beschäftigungsverhältnisse in diesen Sektoren und deren sozioökonomischen Folgen.
Welche Auswirkungen prekärer Beschäftigungsverhältnisse werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen prekärer Beschäftigungsverhältnisse sowohl auf Arbeitnehmer (Einkommenssicherheit, soziale Absicherung, Arbeitsbedingungen) als auch auf Arbeitgeber (Kosten, Flexibilität, Personalmanagement). Der Fokus liegt darauf, wie prekäre Beschäftigung die jeweiligen Interessenlagen beeinflusst und welche Herausforderungen sich daraus ergeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Prekarisierung, atypische Beschäftigung, Normalarbeitsverhältnis, Dienstleistungssektor, Niedriglohnsektor, Arbeitsmarkt, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Flexibilität, Einkommenssicherheit, soziale Absicherung, Handlungsfelder, Arbeitsmarktpolitik.
- Quote paper
- Tim Gerlach (Author), 2015, Prekarisierung der Arbeitswelt. Auswirkungen auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341075