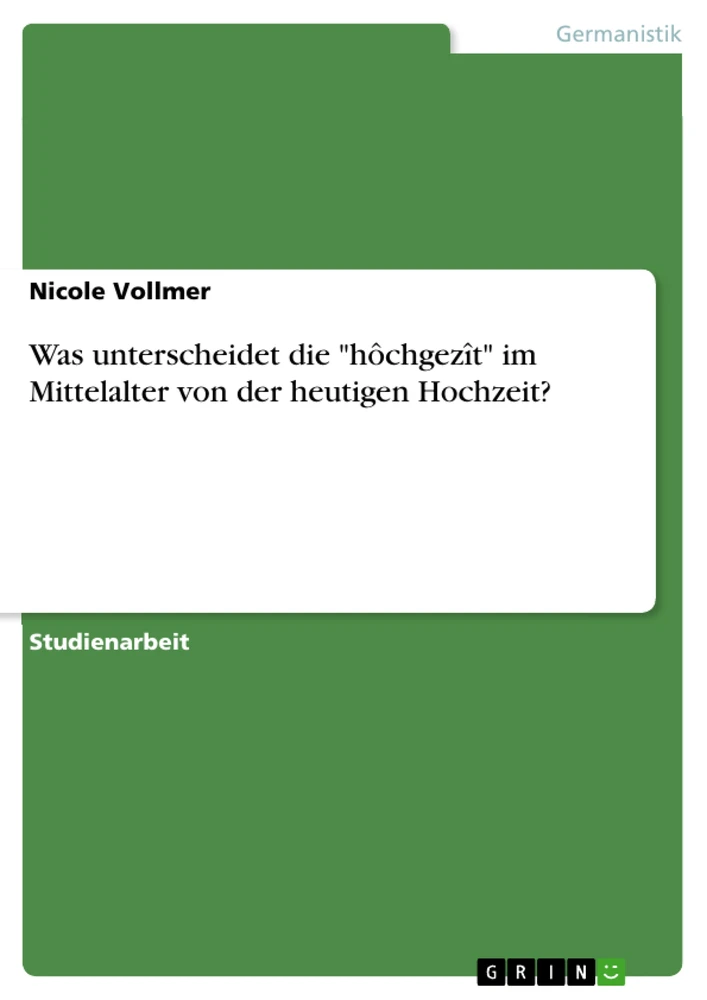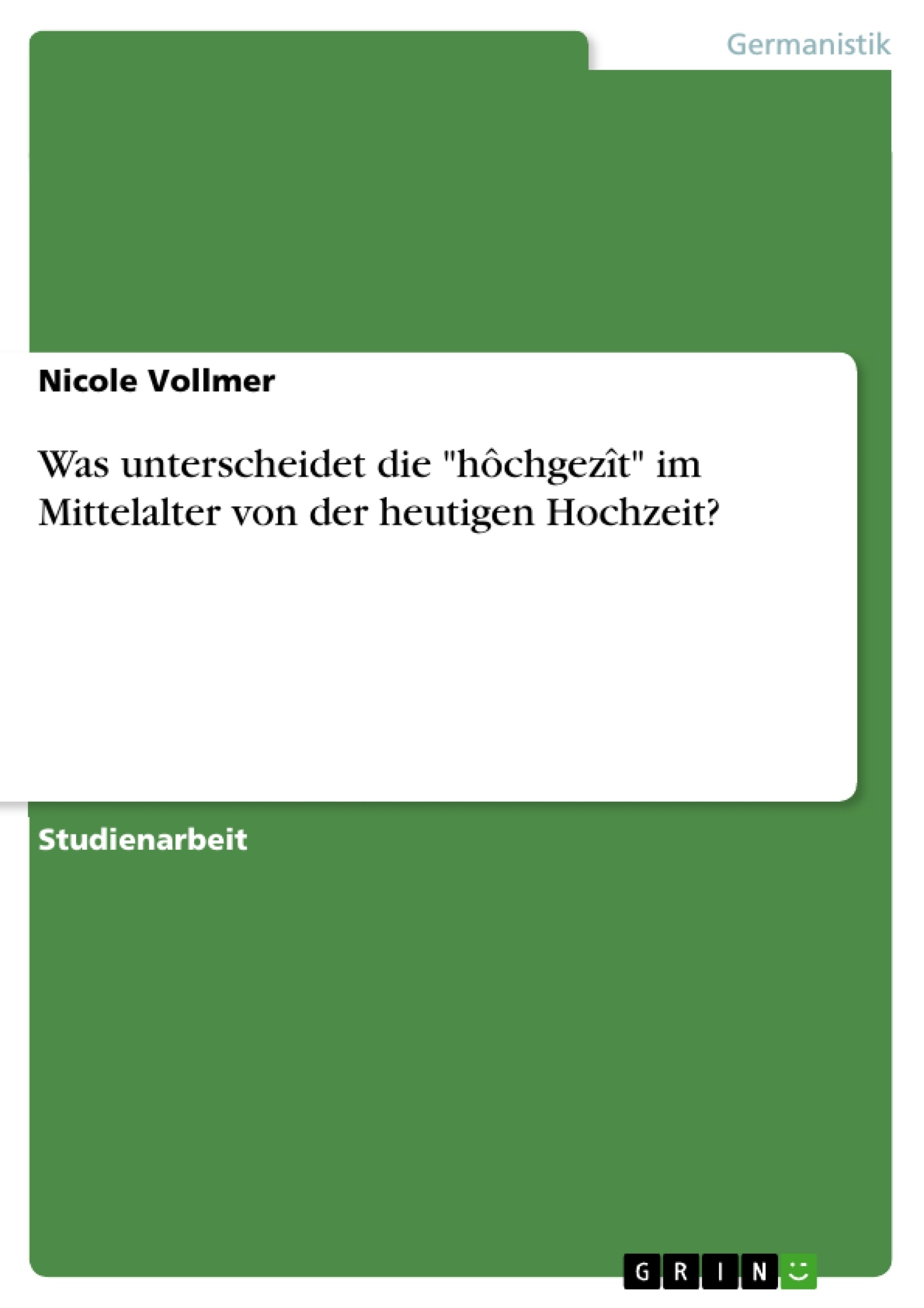Der allgemeine Begriff für das Hoffest im Mittelalter war „hôchgezît“ oder „hôchzît“, was soviel wie „dem Alltag enthobene Zeit“ heißt. Häufige Anlässe für Feste waren unter anderem Hochzeiten. Hierbei handelte es sich aber keineswegs um die uns heute so vertraute kleine oder größere Feier im Familien- und Freundeskreis an einem Frühlingssamstag, wo sich zwei Verliebte das Ja-Wort geben, um ihre Beziehung zu manifestieren. Mittelalterliche Hochzeiten waren komplizierte Ereignisse, die aus bestimmten Beweggründen und Interessen vollzogen wurden. Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf diese Hintergründe, da diese die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale gegenüber unserer heutigen Einstellung zum Heiraten darstellen.
Feste dienten stets der Pflege von politischen Beziehungen und der Demonstration der höfischen Pracht und Macht. Mit einem meist mehrere Tage oder sogar Wochen dauernden großzügigen Fest konnte ein Herr seine Beliebtheit erheblich steigern. Häufige Anlässe für Feste waren neben Hochzeiten auch Krönungen, Friedensschlüsse, kirchliche Feiern und Schwertleiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das (Hochzeits-) Fest
- Schwertleite
- Die Einladung zum Fest
- Der Empfang der Gäste
- Die Unterbringung und Versorgung der Gäste
- Die Unterhaltung
- Beschenkung
- Ehehindernisse
- Heiratsalter
- Inzest
- Religionsverschiedenheit
- Ebenburt
- Blutrache
- Politische Ziele einer Hochzeit
- Friedenssicherung mithilfe der Frauen
- Friedenssicherung mithilfe der Kinder
- Militärische Absicherung
- Beratung durch die Vasallen
- Wirtschaftliche und soziale Interessen einer Heirat
- Verwandtenehe
- Wirtschaftlicher und sozialer Abstieg eines Ehepartners
- Das Interesse an Nachkommen
- Rechtliche Bedeutung einer Heirat
- Die Ehearten Munt- und Friedelehe
- Die Meinung der Kirche in Bezug auf die Eheschließung
- Das Beilager
- Pflichten und Rechte der Ehegatten
- Ehebruch
- Aufgaben der Frau
- Ausnahmen
- Emotionale Bedeutung einer Heirat
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die Hintergründe mittelalterlicher Hochzeiten zu beleuchten und diese mit den heutigen Gepflogenheiten zu kontrastieren. Sie fokussiert sich auf die Faktoren, die mittelalterliche Eheschließungen von modernen Trauungen abgrenzen und den Kontext dieser gesellschaftlichen Praxis in ihrer Zeit verdeutlichen.
- Das (Hochzeits-)Fest im Mittelalter
- Ehehindernisse und ihre Bedeutung
- Politische und wirtschaftliche Interessen hinter Hochzeiten
- Rechtliche Aspekte der Eheschließung
- Emotionale Dimensionen der Heirat im Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontrast zwischen dem mittelalterlichen und dem modernen Leben sowie den Stellenwert von Festen in dieser Zeit dar. Sie führt den Begriff des „hôchgezît“ ein und verdeutlicht den Unterschied zwischen mittelalterlichen Hochzeiten und heutigen Trauungen.
Das erste Kapitel beleuchtet das „(Hochzeits-)Fest“ im Mittelalter. Es behandelt die verschiedenen Bezeichnungen und Anlässe für Feste, wie z.B. das berühmte Mainzer Hoffest und die Schwertleite. Es geht auf die Bedeutung von Festen für die Pflege politischer Beziehungen und die Demonstration von Macht ein.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den „Ehehindernissen“ im Mittelalter, darunter das Heiratsalter, Inzest, Religionsverschiedenheit, Ebenburt und Blutrache. Es wird erläutert, wie diese Hindernisse die Auswahl eines Ehepartners beeinflussten.
Das dritte Kapitel untersucht die „Politischen Ziele einer Hochzeit“, wobei Themen wie Friedenssicherung mithilfe der Frauen und Kinder, militärische Absicherung und die Beratung durch die Vasallen behandelt werden. Es wird deutlich, wie strategische Interessen die Wahl des Ehepartners beeinflussen konnten.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den „Wirtschaftlichen und sozialen Interessen einer Heirat“, wobei Themen wie Verwandtenehe, wirtschaftlicher und sozialer Abstieg eines Ehepartners und das Interesse an Nachkommen behandelt werden. Es wird deutlich, wie wirtschaftliche und soziale Faktoren die Wahl eines Ehepartners beeinflussen konnten.
Das fünfte Kapitel beleuchtet die „Rechtliche Bedeutung einer Heirat“ und geht auf die Ehearten Munt- und Friedelehe, die Meinung der Kirche, das Beilager, Pflichten und Rechte der Ehegatten, Ehebruch, Aufgaben der Frau und Ausnahmen ein. Es stellt den rechtlichen Rahmen für mittelalterliche Hochzeiten dar.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Heirat im Mittelalter und behandelt wichtige Themen wie das „hôchgezît“, Ehehindernisse, politische und wirtschaftliche Interessen, rechtliche Aspekte der Eheschließung und die emotionale Bedeutung der Heirat. Es werden verschiedene Quellen wie literarische Werke (z.B. Hartmanns „Erec“), historische Dokumente und wissenschaftliche Studien herangezogen, um die Komplexität dieser gesellschaftlichen Praxis zu beleuchten.
- Quote paper
- Nicole Vollmer (Author), 2000, Was unterscheidet die "hôchgezît" im Mittelalter von der heutigen Hochzeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340799