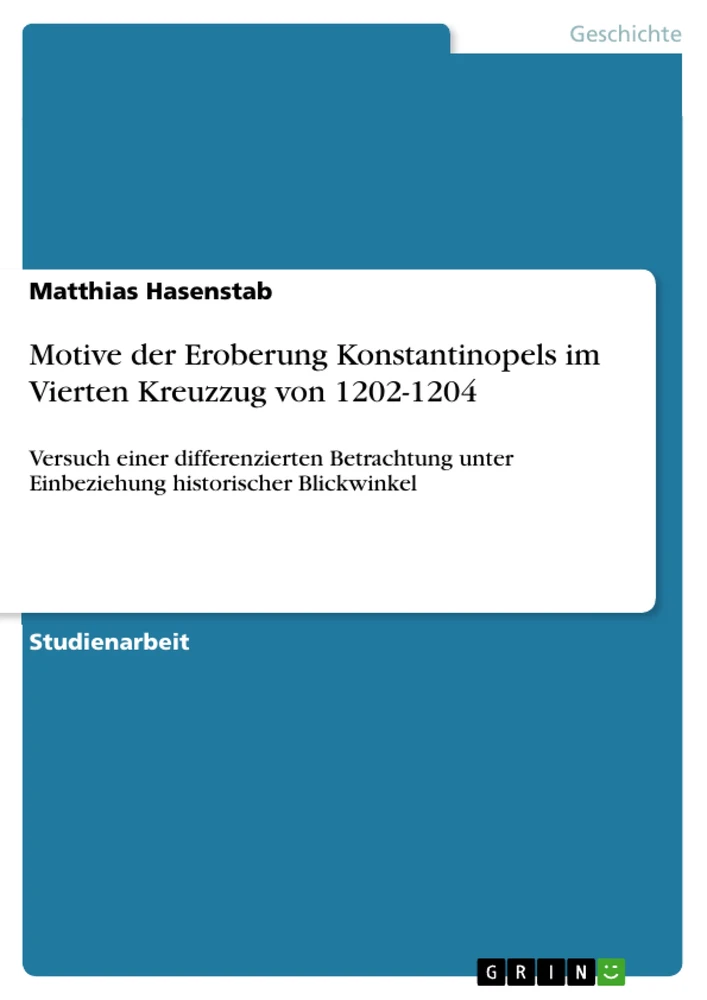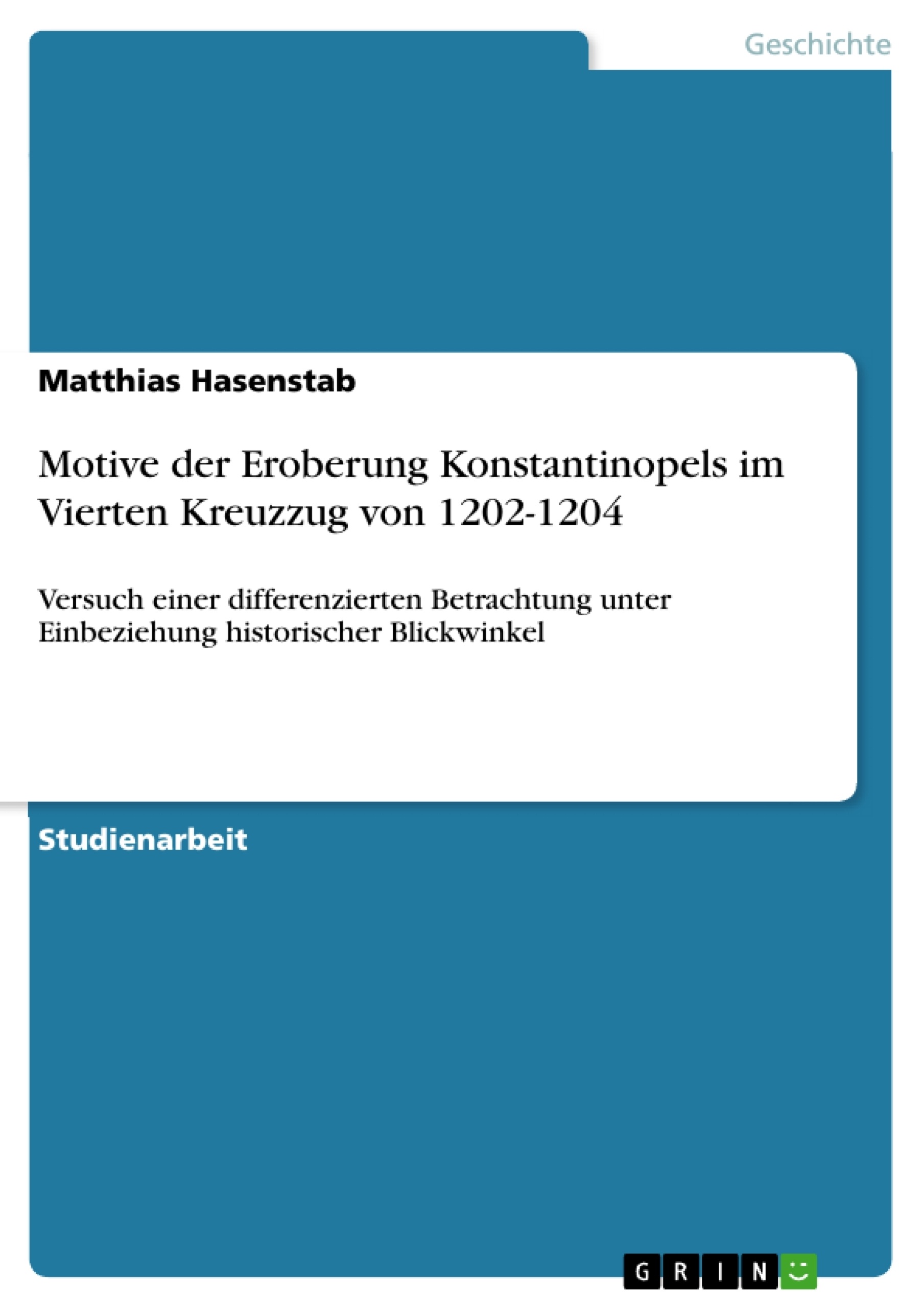Die unvorhergesehenen Ereignisse des Vierten Kreuzzuges erregten schon die Gemüter der Zeitgenossen in einem Maße, das angesichts der angestrebten Einigkeit der Christenheit gegen die muslimische Bedrohung für das Heilige Land zu der Frage führt, inwiefern der Kreuzzugsgedanke an sich durch regionale und persönliche Machtinteressen korrumpiert werden konnte.
Die vorliegende Arbeit richtet ihr Augenmerk folgerichtig auf den Versuch einer groben Abbildung der Sachverhalte, die für die unvorhergesehene Entwicklung des Kreuzzuges am maßgeblichsten waren. Genannt seien hier – unter Rücksichtnahme auf den historischen Kontext – zuvorderst das ambivalente Verhältnis Konstantinopels zum Okzident im Allgemeinen und zur Republik Venedig als dem ausschlaggebenden Faktor im Vierten Kreuzzug im Speziellen sowie die unterschiedlichen Interessen und Sichtweisen der beteiligten Parteien.
Zwecks einer umfassenden Behandlung der Thematik und einem besseren Verständnis der Ereignisse soll in dieser Arbeit die Darstellung der unterschiedlichen Sichtweisen und Handlungen außerdem durch Verweis auf die Aussagen einiger zeitgenössischer Quellen ergänzt werden, jedoch ohne sich dabei in den engen Grenzen eines Quellenkommentars zu bewegen. Zu nennen sind hier in erster Linie die Darstellungen des venezianischen Chronisten Martin da Canal in seinen „Les Estoires de Venise“ aus dem 13. Jahrhundert, der Augenzeugenbericht „Conquête de Constantinople“ des französischen Adligen Geoffroy de Villehardouin, weiterhin der Schriftverkehr des Papstes Innozenz III.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Historischer Kontext
- II.a. Der Kreuzzugsgedanke
- II.b. Ziele der Beteiligten des Vierten Kreuzzuges
- II.c. Das Verhältnis zwischen Konstantinopel und Venedig
- III. Die Umleitung des Kreuzzuges
- IV. Folgen
- V. Fazit
- VI. Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beleuchtet die Ereignisse des Vierten Kreuzzuges, wobei sie sich auf die unterschiedlichen Blickwinkel der Beteiligten konzentriert. Sie untersucht die Korruption des Kreuzzugsgedankens durch regionale und persönliche Machtinteressen und analysiert die Faktoren, die zur unvorhergesehenen Entwicklung des Kreuzzuges führten. Dabei betrachtet sie insbesondere das ambivalente Verhältnis zwischen Konstantinopel und dem Okzident, besonders die Rolle Venedigs.
- Der Kreuzzugsgedanke als Rechtfertigung für die Eroberung Konstantinopels
- Die Rolle von Venedig und Enrico Dandolo im Vierten Kreuzzug
- Die unterschiedlichen Ziele der beteiligten Parteien
- Die Auswirkungen der Umleitung des Kreuzzuges
- Der Wandel des Kreuzzugsgedankens im Laufe des 12. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Relevanz der unvorhergesehenen Ereignisse des Vierten Kreuzzuges im Kontext des Kreuzzugsgedankens. Das zweite Kapitel analysiert den historischen Kontext, wobei es den Kreuzzugsgedanken, die Ziele der Beteiligten sowie das Verhältnis zwischen Konstantinopel und Venedig im Detail betrachtet.
Schlüsselwörter
Vierte Kreuzzug, Kreuzzugsgedanke, Konstantinopel, Venedig, Enrico Dandolo, Byzanz, Okzident, Machtpolitik, Religion, Geschichte, Mittelalter, Quellenkritik, Quellenanalyse.
- Quote paper
- Matthias Hasenstab (Author), 2016, Motive der Eroberung Konstantinopels im Vierten Kreuzzug von 1202-1204, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340783