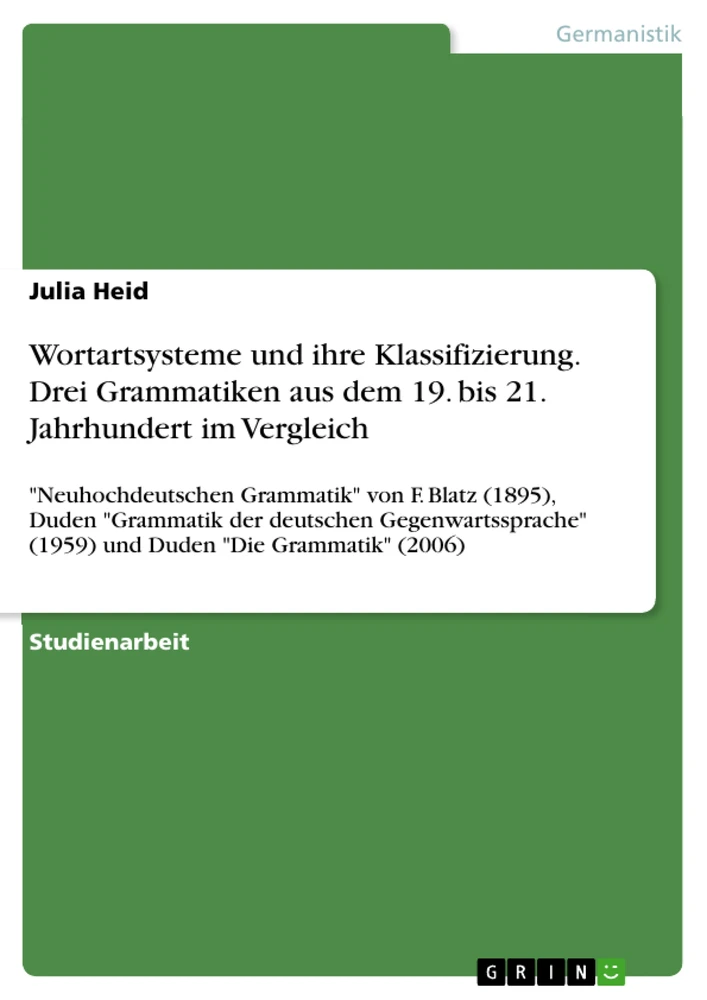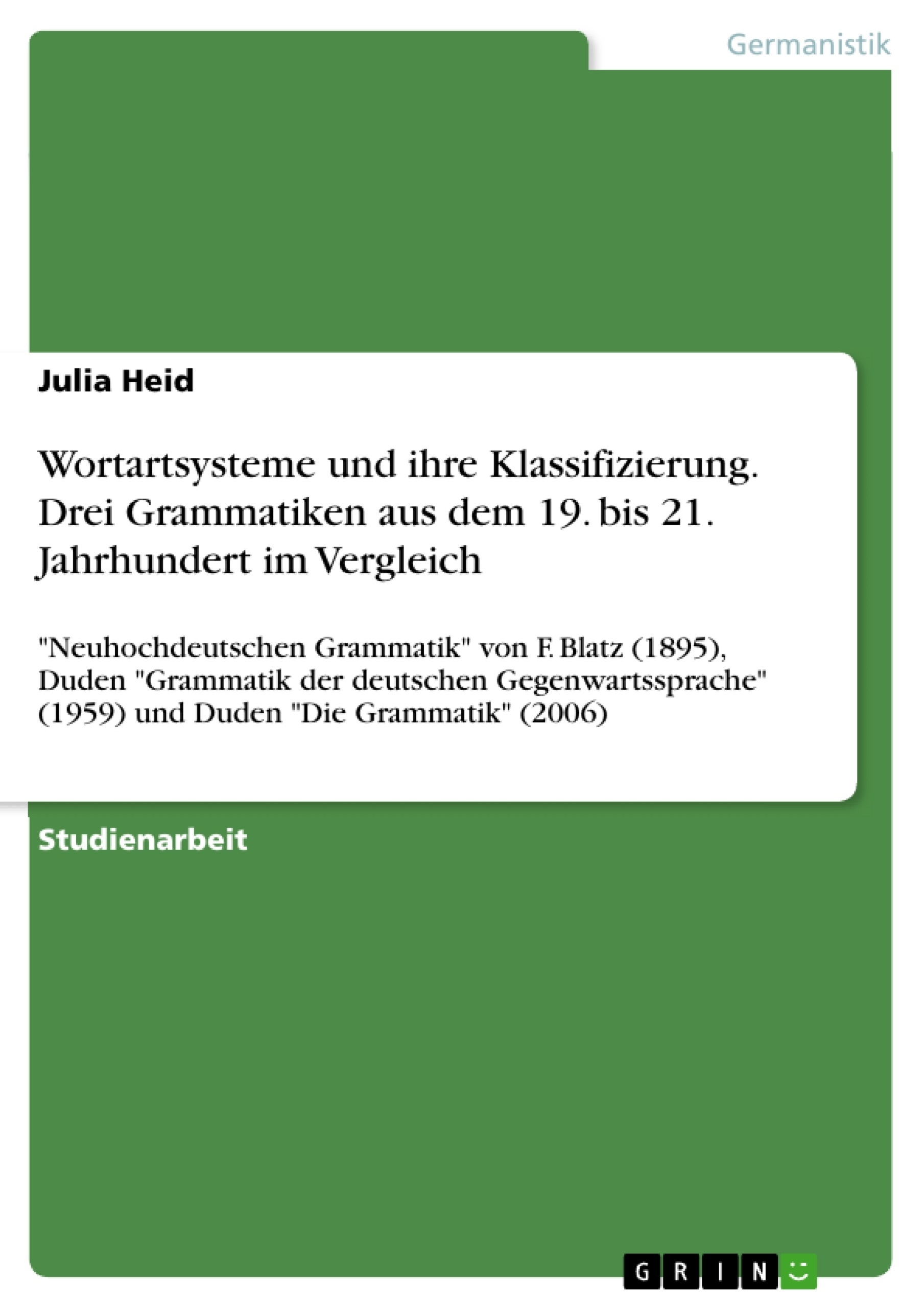In der Arbeit sollen drei verschiedene Grammatiken aus unterschiedlichen Jahrhunderten hinsichtlich ihrer Klassifikation der Wortarten beziehungsweise ihrer Wortartensysteme gegenübergestellt werden. Die Kriterienzuordnung orientiert sich an einem Artikel „Kriterien für die Definition von Wortarten“ von Knobloch und Schaeder.
Anhand der „Neuhochdeutschen Grammatik“ von Friedrich Blatz von 1895 als Stellvertreter des neunzehnten Jahrhunderts, der Duden „Grammatik der deutschen Gegenwartssprache“ von 1959 als Vertreter des zwanzigsten Jahrhunderts und der Duden „Die Grammatik“ von 2006 als Vertreter des einundzwanzigsten Jahrhunderts wird ein Vergleich angestellt, der die Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausstellt und einzelne Probleme der Wortartenklassifizierung hervorbringt.
Zunächst wird die Grammatik von Friedrich Blatz beschrieben und kommentiert. Im zweiten Schritt sollen dann die Blatz Grammatik und die Duden Grammatik von 1959 miteinander verglichen werden. Als letztes schließlich wird die Entwicklung von dem in der Blatz Grammatik beschriebenen Wortartsystem zur Sichtweise der deutschen Einheitsgrammatik von 2006 gezeigt. In einem Schluss können schließlich nochmals die wichtigsten Unterscheidungen nachgelesen werden und es wird ein allgemeines Fazit des Vergleichs der drei Grammatiken untereinander gezogen.
So wie in vielen anderen Sprachen, wie zum Beispiel im Französischen, Englischen oder Spanischen, wird auch im Deutschen schon seit Jahrhunderten von Linguisten und ihren „forschenden Vorgängern“, beispielsweise Platon, Aristoteles und vielen mehr, versucht, ein angemessenes Wortartsystem zu finden. Dieses Wortartsystem soll die Sprache entweder schulgrammatisch beschreiben, sie für das Erlernen der deutschen Sprache als Fremdsprache gliedern, Grundlage einer linguistischen Theorie bilden, oder einen von vielen weiteren Zwecken erfüllen. Jedoch sind in den als universell anerkannten Grammatiken einer Generation auch die unterschiedlichen Wortartsysteme genauso unterschiedlich wie die aufgelisteten Zwecke einer Wortartklassifizierung. Jedes Jahrhundert unterscheidet sich in mindestens einem Punkt seiner Universalgrammatik des Deutschen von seinem Vorgänger. Dieser Umstand zeigt, dass Sprache nicht festgelegt ist sondern in sich beweglich. Es findet eine Entwicklung statt, die sich durch ständige Reflektion bestehender Theorien auszeichnet und sich auch darin begründet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. HAUPTTEIL
- 2.1 NEUHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK (F. BLATZ)
- 2.1.1 Einordnung des Wortartsystems und Zweck der Klassifizierung
- 2.1.2 Allgemeiner Aufbau und Klassifizierungskriterien
- 2.2 VERGLEICH NEUHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK (F. BLATZ) UND DUDEN (1959)
- 2.2.1 Einordnung des Wortartensystems und Zweck der Klassifizierung
- 2.2.2 Allgemeiner Aufbau und Klassifizierungskriterien
- 2.3 VERGLEICH DER NEUHOCHDEUTSCHEN GRAMMATIK (F. BLATZ) ZU DUDENGRAMMATIK 2006
- 2.3.1 Einordnung des Wortartsystems und Zweck der Klassifizierung
- 2.3.2 Allgemeiner Aufbau und Klassifizierungskriterien
- 2.1 NEUHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK (F. BLATZ)
- 3. SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit vergleicht drei verschiedene deutsche Grammatiken aus unterschiedlichen Jahrhunderten – die „Neuhochdeutsche Grammatik“ von Friedrich Blatz (1895), den Duden „Grammatik der deutschen Gegenwartssprache“ (1959) und den Duden „Die Grammatik“ (2006) – hinsichtlich ihrer Wortartensysteme und Klassifizierungskriterien. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und die Entwicklung der Wortartenklassifizierung im Laufe der Zeit zu beleuchten.
- Entwicklung der Wortartensysteme im Deutschen
- Vergleichende Analyse der Klassifizierungskriterien (semantisch vs. syntaktisch)
- Untersuchung der Zwecke und Zielgruppen der jeweiligen Grammatiken
- Herausarbeitung von Problemen und Unstimmigkeiten in der Wortartenklassifizierung
- Historische Entwicklung der grammatischen Beschreibung des Deutschen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den langjährigen Versuch, ein angemessenes Wortartsystem für die deutsche Sprache zu entwickeln, und beleuchtet die unterschiedlichen Zwecke einer solchen Klassifizierung (schulgrammatisch, für den Fremdsprachenunterricht, für linguistische Theorien etc.). Sie kündigt den Vergleich dreier Grammatiken aus verschiedenen Jahrhunderten an, wobei die Kriterienzuordnung an den Artikel „Kriterien für die Definition von Wortarten“ von Knobloch und Schaeder angelehnt ist. Die Arbeit fokussiert auf die Grammatiken von Friedrich Blatz (1895), den Duden (1959) und den Duden (2006), um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Wortartensystemen herauszuarbeiten.
2.1 Neuhochdeutsche Grammatik (F. Blatz): Dieses Kapitel analysiert die Wortartenlehre in Blatz' „Neuhochdeutscher Grammatik“ (1895). Blatz präsentiert ein System mit zehn Wortarten, wobei er selbst die mangelnde logische Stringenz seiner Einteilung kritisiert. Die Analyse untersucht die Klassifizierungskriterien (semantisch und syntaktisch) für jede Wortart und beleuchtet die didaktischen und wissenschaftlichen Zielsetzungen der Grammatik. Die detaillierte Auseinandersetzung mit Blatz' Anmerkungen verdeutlicht die Komplexität der Wortartenklassifizierung und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben.
2.2 Vergleich Neuhochdeutsche Grammatik (F. Blatz) und Duden (1959): Dieses Kapitel vergleicht Blatz' Grammatik mit dem Duden von 1959. Im Fokus steht der Vergleich der Wortartensysteme und ihrer jeweiligen Zwecke und Zielgruppen. Während Blatz eine eher wissenschaftliche Herangehensweise verfolgt, zeichnet sich der Duden von 1959 durch eine praxisorientierte, benutzerfreundliche „Volksgrammatik“ aus. Die Analyse beleuchtet die Unterschiede in der Anzahl der Wortarten und der verwendeten Terminologie (lateinisch vs. deutsch) und diskutiert die möglichen Gründe dafür.
Schlüsselwörter
Wortarten, Wortartensystem, Grammatik, Neuhochdeutsch, Friedrich Blatz, Duden, Klassifizierungskriterien, semantische Kriterien, syntaktische Kriterien, Sprachentwicklung, Sprachgeschichte, Vergleichende Grammatik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse deutscher Grammatiken
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit vergleicht drei deutsche Grammatiken: Friedrich Blatz' „Neuhochdeutsche Grammatik“ (1895), den Duden „Grammatik der deutschen Gegenwartssprache“ (1959) und den Duden „Die Grammatik“ (2006). Der Fokus liegt auf den Wortartensystemen und den zugrundeliegenden Klassifizierungskriterien. Ziel ist es, die Entwicklung der Wortartenklassifizierung im Laufe der Zeit zu untersuchen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen.
Welche Grammatiken werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die „Neuhochdeutsche Grammatik“ von Friedrich Blatz (1895), den Duden „Grammatik der deutschen Gegenwartssprache“ (1959) und den Duden „Die Grammatik“ (2006).
Welche Aspekte der Grammatiken werden verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf die Wortartensysteme, die Klassifizierungskriterien (semantische und syntaktische Aspekte), die Zwecke und Zielgruppen der jeweiligen Grammatiken, sowie die historische Entwicklung der grammatischen Beschreibung des Deutschen.
Welche Klassifizierungskriterien werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert sowohl semantische als auch syntaktische Kriterien, die bei der Klassifizierung von Wortarten in den drei Grammatiken verwendet werden.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte die Entwicklung der Wortartenklassifizierung im Deutschen über einen längeren Zeitraum hinweg nachzeichnen und die Unterschiede in den Herangehensweisen der drei Grammatiken beleuchten. Sie untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Wortartensystemen und den zugrundeliegenden Prinzipien.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit ist gegliedert in eine Einleitung, einen Hauptteil (mit Unterkapiteln zu den einzelnen Grammatiken und ihren Vergleichen) und einen Schluss. Der Hauptteil analysiert die Wortartenlehre in jeder Grammatik im Detail und vergleicht diese dann miteinander.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wortarten, Wortartensystem, Grammatik, Neuhochdeutsch, Friedrich Blatz, Duden, Klassifizierungskriterien, semantische Kriterien, syntaktische Kriterien, Sprachentwicklung, Sprachgeschichte, Vergleichende Grammatik.
Wer ist Friedrich Blatz?
Friedrich Blatz ist der Autor der „Neuhochdeutschen Grammatik“ (1895), einer der im Vergleich untersuchten Grammatiken. Seine Grammatik wird hinsichtlich ihrer Wortartenklassifizierung und der zugrundeliegenden Prinzipien analysiert.
Wie wird der Duden in dieser Arbeit betrachtet?
Der Duden wird in zwei Ausgaben betrachtet: die „Grammatik der deutschen Gegenwartssprache“ (1959) und „Die Grammatik“ (2006). Die Arbeit vergleicht die Wortartensysteme und Klassifizierungskriterien dieser beiden Ausgaben miteinander sowie mit Blatz' Grammatik.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, indem sie die drei Grammatiken systematisch hinsichtlich ihrer Wortartensysteme und Klassifizierungskriterien analysiert und die Ergebnisse gegenüberstellt.
- Quote paper
- Julia Heid (Author), 2014, Wortartsysteme und ihre Klassifizierung. Drei Grammatiken aus dem 19. bis 21. Jahrhundert im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340743