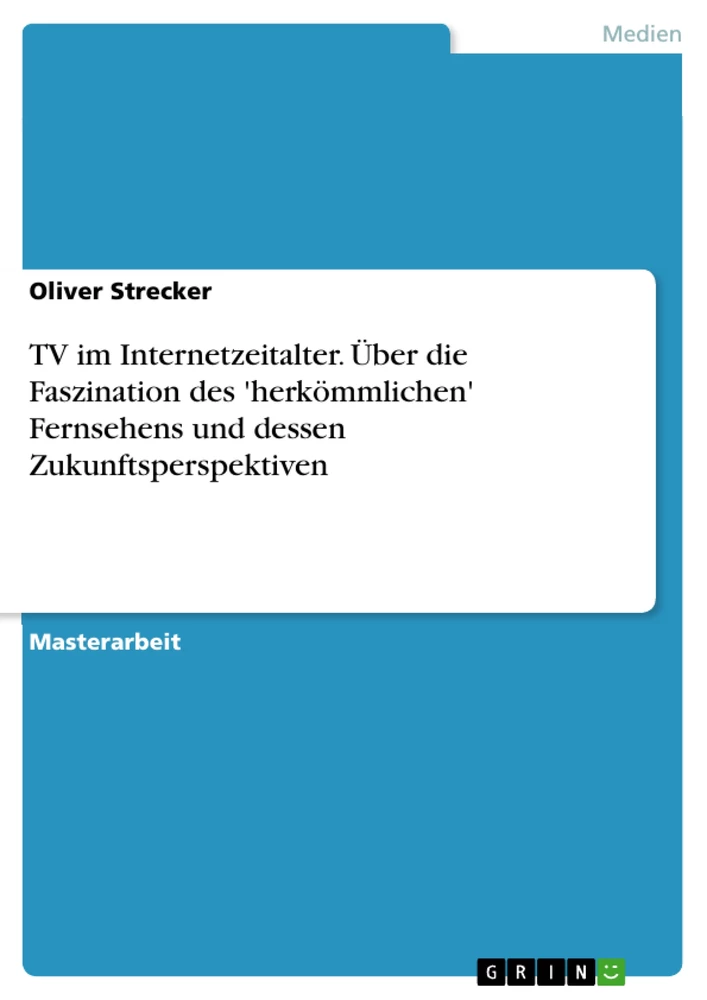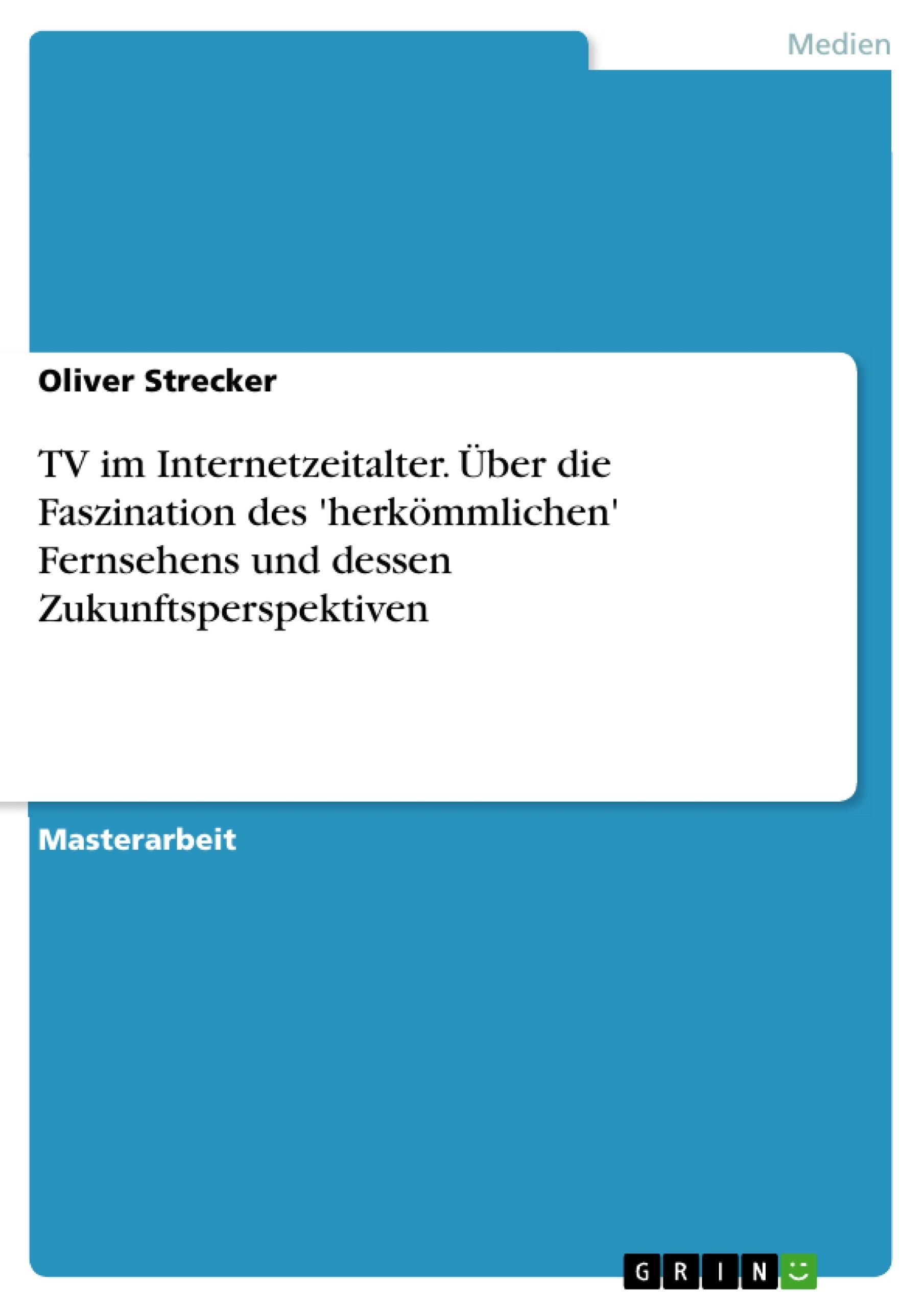Das Fernsehen war in Deutschland das bestimmende Medium des späten 20. Jahrhunderts. Nach dem zweiten Weltkrieg entwickelte es sich zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil deutscher Haushalte. Bei diesem Siegeszug war zunächst kein Ende abzusehen. Doch mit dem Durchbruch des Internets zum Jahrtausendwechsel und der rasanten Vermehrung von Online-Videoinhalten begann eine Kontroverse darüber, ob das Fernsehen – in der herkömmlichen Form – seine Popularität beibehalten oder von diesen Inhalten verdrängt werde. Dabei lautet die vorherrschende Meinung unter Fachautoren und Praktikern , das Fernsehen „habe seinen Zenit überschritten“.
Das Verfolgen eines festgelegten Programmes zu festgelegten Zeiten erscheine demnach als nicht mehr zeitgemäß. Reed Hastings, Chef einer der größten Onlinevideo-Anbieter weltweit (Netflix), vergleicht das ‚herkömmliche‘ Fernsehen mit einem Festnetz-Telefon. Er verweist darauf, dass diese Geräte zwar noch überall vorhanden seien, sie in Zeiten von Smartphones aber nicht mehr benutzt würden. Hastings geht daher davon aus, das herkömmliche Fernsehen werde bald von Streamingdiensten abgelöst. In dieser Arbeit soll die Frage beantwortet werden, ob das herkömmliche Fernsehen und dessen lineare und synchrone Übertragungsweise tatsächlich als Relikt einer Zeit betrachtet werden kann, in der es keine anderen technischen Möglichkeiten gab, oder ob und inwiefern die Popularität des Mediums gerade durch diese Organisationsform bedingt ist. Es wird unterstellt, dass sich mit dieser Frage auch die Zukunft des Mediums entscheidet.
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sollen zunächst die thematisch relevanten Begriffe geklärt werden. Es wird ausgeführt, wie der Begriff ‚Fernsehen‘ im Allgemeinen und als Massenmedium in der Literatur definiert ist. Anschließend wird beschrieben, welche Definition des herkömmlichen Fernsehens dieser Arbeit zugrunde liegt. Um eine fundierte Aussage über die Zukunft des Fernsehens treffen zu können, ist ein Verständnis von dessen Vergangenheit und Entwicklung unerlässlich. Aus diesem Grund schließt sich eine Zusammenfassung zur Geschichte des deutschen Fernsehens an. Da das heutige Fernsehen hauptsächlich aus den Entwicklungen in Westdeutschland resultiert, fokussiert sich der historische Teil auf die dortigen Entwicklungen. Daraufhin werden die individuellen Formen des Videoabrufs im Internet dem herkömmlichen Fernsehen gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff „Fernsehen“
- Definitionen des Massenmediums „Fernsehen“ in der Literatur
- Bewertung der Literatur und Herausarbeitung einer eigenen Definition
- Die Geschichte des deutschen Fernsehens
- 1883-1945: Vorläufer und Pioniere
- Fünfziger Jahre: Neuanfang und Aufschwung
- Sechziger und siebziger Jahre: Etablierung als Massenmedium
- Achtziger und neunziger Jahre: Umbau und Kommerzialisierung
- Seit 2000: Digitalisierung und Ausbreitung von Online-Angeboten
- Zugangswege und Formen der Online-Videoangebote
- Smart-TV/Hybrid-TV
- IPTV
- Web-TV
- Video-Streamingdienste
- Apple iTunes
- Maxdome
- Watchever
- Amazon Prime Instant Video
- Sky Snap
- Netflix
- Videoplattformen
- Videopodcasts
- Fernsehen im Internetzeitalter: Zahlen und Fakten
- Internet-Nutzung der Gesamtbevölkerung
- Internet-Nutzung nach Altersgruppen
- TV-Nutzung der Gesamtbevölkerung
- TV-Nutzung nach Altersgruppen
- Die technischen Voraussetzungen
- Nutzungsmotive für das Fernsehen
- Faszinationsmerkmale des „herkömmlichen“ Fernsehens
- Fernsehen zur Entspannung, Ablenkung und Zerstreuung
- Passivität des Rezipienten
- Switchen, Zappen, Scannen
- Der „Flow“
- Fernsehen als soziales Erlebnis
- Fernsehkommunikation
- Second Screen / Social TV
- Live Fernsehen
- Der Sender als Marke
- Fernsehen als parasoziales Erlebnis
- Fernsehen als Informationsmedium
- Die universelle Zugänglichkeit
- Das Fernsehen als moderner Marktplatz
- Umfassende und eindringliche Information
- Die Tradition des Fernsehens als Informationsmedium
- Nutzungszahlen des Fernsehens als Nachrichtenquelle
- Fernsehen zur Entspannung, Ablenkung und Zerstreuung
- Fernsehen aus Gewohnheit
- Die Qual der Wahl?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Faszination des „herkömmlichen“ Fernsehens im Kontext des Internetzeitalters und dessen Zukunftsperspektiven. Sie hinterfragt die Behauptung, dass das lineare Fernsehen durch Online-Videoangebote abgelöst wird. Die Arbeit analysiert die weiterhin bestehende Popularität des Fernsehens und beleuchtet die Faktoren, die diese Popularität bedingen.
- Definition und Geschichte des Fernsehens
- Entwicklung und Vielfalt von Online-Videoangeboten
- Quantitative und qualitative Aspekte der Fernseh- und Internetnutzung
- Faszinationsmerkmale des traditionellen Fernsehens
- Die Rolle der Gewohnheit und der „Qual der Wahl“ im Medienkonsum
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Zukunft des herkömmlichen Fernsehens im Angesicht des Internets. Sie verweist auf gegensätzliche Meinungen in der Fachliteratur, die das lineare Fernsehen als überholt einstufen, im Gegensatz zu der weiterhin hohen Popularität des Mediums. Die Arbeit untersucht, ob die Popularität des Fernsehens durch seine lineare und synchrone Übertragungsweise bedingt ist.
Der Begriff „Fernsehen“: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Definitionen von „Fernsehen“ aus der Literatur und entwickelt darauf basierend eine eigene Definition des Massenmediums. Es legt den Fokus auf die verschiedenen Perspektiven und Herausforderungen bei der Definition, um eine umfassende und aktuelle Sichtweise zu etablieren. Die Diskussion der verschiedenen Definitionen bereitet den Boden für die weitere Analyse der Geschichte und des Einflusses des Fernsehens.
Die Geschichte des deutschen Fernsehens: Diese Kapitel zeichnet die Entwicklung des Fernsehens in Deutschland von den Vorläufern bis zur Digitalisierung nach. Es beleuchtet die verschiedenen Phasen, von den Anfängen bis zur Etablierung als Massenmedium, einschließlich der Kommerzialisierung und dem Einfluss der Digitalisierung. Der historische Kontext wird für das Verständnis der heutigen Situation des Fernsehens als essentiell erachtet.
Zugangswege und Formen der Online-Videoangebote: Dieser Abschnitt bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Zugangswege und Formen von Online-Videoangeboten, von Smart-TV über IPTV und Web-TV bis hin zu Video-Streamingdiensten und Videoplattformen. Die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Plattformen und Technologien verdeutlicht die zunehmende Vielfalt und den Wettbewerb im Bereich der Online-Videobereitstellung. Der Vergleich dieser Angebote mit dem traditionellen Fernsehen bildet einen zentralen Aspekt des Kapitels.
Fernsehen im Internetzeitalter: Zahlen und Fakten: Dieses Kapitel präsentiert statistische Daten zur Internet- und Fernsehnutzung der Bevölkerung, differenziert nach Altersgruppen. Die Analyse der Nutzungsdaten liefert wichtige Erkenntnisse über die tatsächliche Nutzung beider Medien und erlaubt einen Vergleich zwischen den unterschiedlichen Altersgruppen. Die bereitgestellten Zahlen liefern ein klares Bild der aktuellen Mediennutzungsgewohnheiten.
Faszinationsmerkmale des „herkömmlichen“ Fernsehens: Dieser Abschnitt untersucht die anhaltenden Faszinationsmerkmale des traditionellen Fernsehens, unterteilt in Entspannung, soziales Erlebnis, Second Screen/Social TV und Informationsquelle. Die detaillierte Analyse dieser Aspekte liefert wichtige Einblicke in die Gründe für die anhaltende Popularität des Fernsehens. Der Abschnitt unterstreicht die multifunktionalen Aspekte des Fernsehens, die über die reine Unterhaltung hinausgehen.
Fernsehen aus Gewohnheit: Dieses Kapitel erörtert die Bedeutung von Gewohnheit im Kontext der Fernsehnutzung und wie diese Gewohnheit die Präferenz für das traditionelle Fernsehen beeinflusst.
Die Qual der Wahl?: Dieses Kapitel diskutiert die Überfülle an Programmangeboten im digitalen Zeitalter und deren potenziellen Einfluss auf die Fernsehnutzung.
Schlüsselwörter
Fernsehen, Internet, Online-Videoangebote, Digitalisierung, Mediennutzung, Medienkonsum, Traditionelles Fernsehen, Streamingdienste, Rezeption, Gewohnheit, Faszination, Informationsquelle, soziale Interaktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Fernsehen im Internetzeitalter
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die anhaltende Faszination des „herkömmlichen“ Fernsehens im Kontext des Internetzeitalters und dessen Zukunftsperspektiven. Sie hinterfragt die These, dass lineares Fernsehen durch Online-Videoangebote abgelöst wird, und analysiert die Faktoren, die die Popularität des Fernsehens weiterhin bedingen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Geschichte des Fernsehens, die Entwicklung und Vielfalt von Online-Videoangeboten, quantitative und qualitative Aspekte der Fernseh- und Internetnutzung, Faszinationsmerkmale des traditionellen Fernsehens sowie die Rolle von Gewohnheit und „Qual der Wahl“ im Medienkonsum.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Definition des Begriffs „Fernsehen“, Geschichte des deutschen Fernsehens, Zugangswege und Formen von Online-Videoangeboten, Fernseh- und Internetnutzung (Zahlen und Fakten), Faszinationsmerkmale des traditionellen Fernsehens, sowie die Kapitel „Fernsehen aus Gewohnheit“ und „Die Qual der Wahl?“. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Definition von „Fernsehen“ wird verwendet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Definitionen von „Fernsehen“ aus der Literatur und entwickelt darauf basierend eine eigene, umfassende und aktuelle Definition des Massenmediums, die die verschiedenen Perspektiven und Herausforderungen berücksichtigt.
Wie wird die Geschichte des deutschen Fernsehens dargestellt?
Die Arbeit zeichnet die Entwicklung des Fernsehens in Deutschland von den Vorläufern bis zur Digitalisierung nach, beleuchtet die verschiedenen Phasen (Anfänge bis Etablierung als Massenmedium, Kommerzialisierung, Einfluss der Digitalisierung) und betont den historischen Kontext für das Verständnis der heutigen Situation.
Welche Online-Videoangebote werden betrachtet?
Die Arbeit bietet einen Überblick über diverse Online-Videoangebote: Smart-TV/Hybrid-TV, IPTV, Web-TV, Video-Streamingdienste (Apple iTunes, Maxdome, Watchever, Amazon Prime Instant Video, Sky Snap, Netflix), Videoplattformen und Videopodcasts. Ein Vergleich mit dem traditionellen Fernsehen ist zentral.
Welche Daten zur Mediennutzung werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert statistische Daten zur Internet- und Fernsehnutzung der Bevölkerung, differenziert nach Altersgruppen. Die Analyse dieser Daten ermöglicht einen Vergleich der Nutzung beider Medien und unterschiedlicher Altersgruppen.
Welche Faszinationsmerkmale des traditionellen Fernsehens werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die anhaltende Faszination des traditionellen Fernsehens hinsichtlich Entspannung/Ablenkung, sozialem Erlebnis (inkl. Second Screen/Social TV), und Informationsquelle. Die Analyse verdeutlicht die multifunktionalen Aspekte des Fernsehens.
Welche Rolle spielen Gewohnheit und die „Qual der Wahl“?
Die Arbeit erörtert die Bedeutung von Gewohnheit für die Fernsehnutzung und den Einfluss der Überfülle an Programmangeboten im digitalen Zeitalter auf die Mediennutzung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fernsehen, Internet, Online-Videoangebote, Digitalisierung, Mediennutzung, Medienkonsum, Traditionelles Fernsehen, Streamingdienste, Rezeption, Gewohnheit, Faszination, Informationsquelle, soziale Interaktion.
- Quote paper
- Oliver Strecker (Author), 2015, TV im Internetzeitalter. Über die Faszination des 'herkömmlichen' Fernsehens und dessen Zukunftsperspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340639