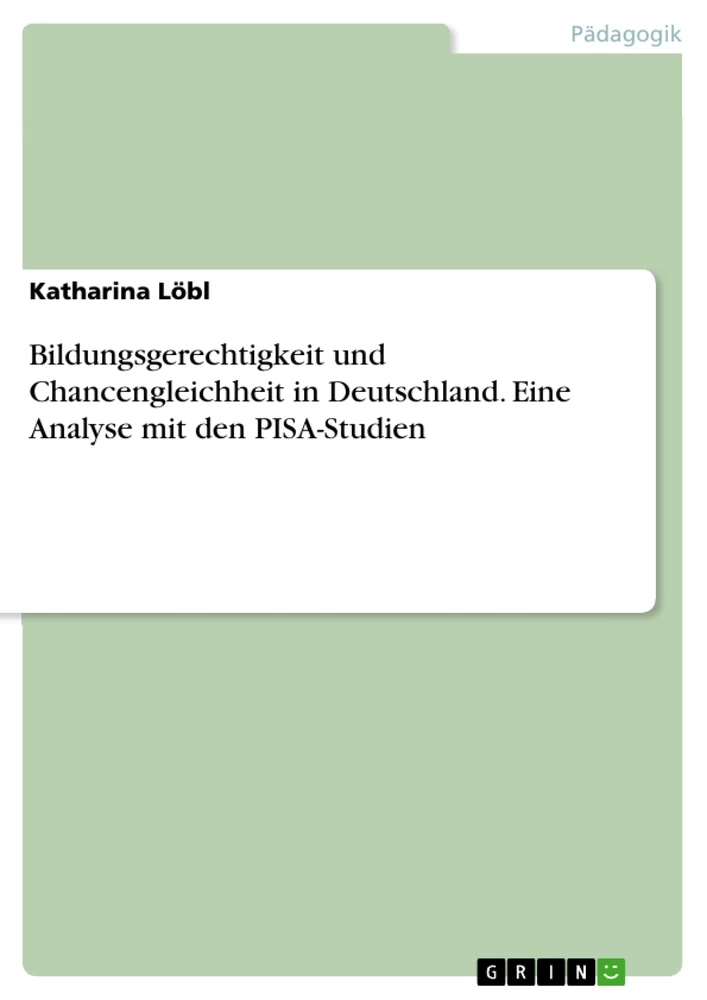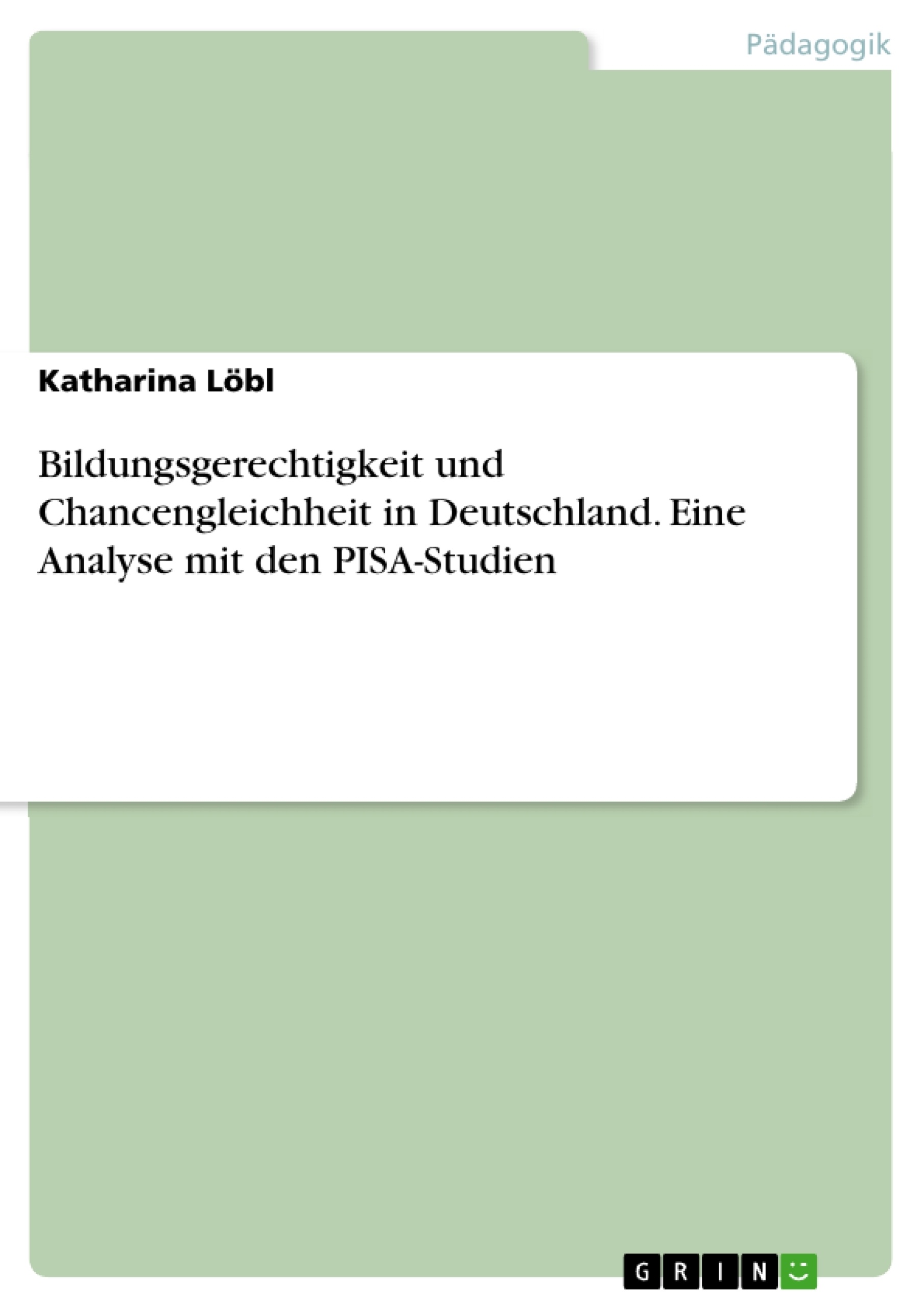Diese Ausarbeitung soll einen Einblick in die Problematik der Chancenungleichheit innerhalb des Bildungssystems der BRD ermöglichen. Anhand der PISA-Studien wurde die Chancenungleichheit in besonderer Weise verdeutlicht, erkenntlich gemacht und löste hierdurch viele Diskussionen aus. Einleitend werden die zentralen und die Thematik bestimmenden Begriffe Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit erklärt.
Im Anschluss daran werden die diesem Thema zugeordneten Inhalte der PISA-Studien und deren Ergebnisse für Deutschland kurz aufgezeigt. Abschließend werden mithilfe einer zuvor durchgeführten Ursachenanalyse Handlungsperspektiven für den Abbau sozialer Ungleichheiten vorgestellt und entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 3. PISA-Studie der OECD
- 3.1. PISA-Ergebnisse für Deutschland
- 3.2. Soziale Ungleichheit in der schulischen Bildung
- 3.2.1. Schichtspezifische Bildungsungleichheiten
- 3.2.2. Bildungsungleichheiten auf Grund von Migrationshintergrund
- 4. Handlungsperspektiven für den Abbau sozialer Bildungsungleichheit
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem anhand der PISA-Studien. Die Arbeit beleuchtet die Begriffe Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit, analysiert die PISA-Ergebnisse für Deutschland und entwickelt schließlich Handlungsperspektiven zur Reduzierung sozialer Bildungsungleichheiten.
- Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit im deutschen Kontext
- Analyse der PISA-Studien und deren Ergebnisse für Deutschland
- Schichtspezifische Bildungsungleichheiten
- Einfluss des Migrationshintergrunds auf Bildungsungleichheiten
- Handlungsperspektiven zum Abbau sozialer Bildungsungleichheiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Diese Einleitung beschreibt den Zweck der Arbeit: einen Einblick in die Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem zu geben. Die PISA-Studien werden als zentrale Grundlage genannt, die die Problematik verdeutlicht und Diskussionen ausgelöst hat. Es wird angekündigt, dass die Begriffe Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit definiert und die relevanten Inhalte und Ergebnisse der PISA-Studien für Deutschland dargestellt werden. Abschließend wird die Entwicklung von Handlungsperspektiven für den Abbau sozialer Ungleichheiten angekündigt, basierend auf einer Ursachenanalyse.
2. Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Chancengleichheit wird als die normative Forderung nach gleichen Entwicklungsmöglichkeiten für alle beschrieben, wobei die vollständige Realisierung aufgrund verschiedener Einflussfaktoren (Fähigkeiten, elterliche Möglichkeiten, Sozialisation etc.) unrealistisch ist. Eine Annäherung durch staatliche Maßnahmen wird als Ziel genannt. Bildungsgerechtigkeit wird als gegeben betrachtet, wenn Chancengleichheit herrscht, und wird weiter als das Erreichen eines Bildungsniveaus für jedes Kind definiert, das ein gutes Leben in der modernen Gesellschaft ermöglicht, unabhängig von finanziellen Möglichkeiten, Geschlecht, Hautfarbe oder Herkunft.
3. PISA-Studie der OECD: Dieses Kapitel beschreibt die PISA-Studie als ein internationales Programm zur Vergleichsmessung von Schülerleistungen, durchgeführt von der OECD. Es werden die Methoden der Studie erläutert, die alle drei Jahre repräsentative Stichproben von 15-Jährigen in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen untersucht. Neben fachlichen Kompetenzen werden auch übergreifende Kompetenzen und der Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien analysiert.
3.1. PISA-Ergebnisse für Deutschland: Dieser Abschnitt präsentiert die Ergebnisse der PISA-Studien für Deutschland. Die ersten Ergebnisse von 2000 zeigten unterdurchschnittliche Leistungen im internationalen Vergleich und einen starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Chancengleichheit. Deutschland wurde als einer der "Weltmeister" in der Benachteiligung sozial schwacher Kinder bezeichnet. Der daraus entstandene "PISA-Schock" führte zu bildungspolitischen Diskussionen und Reformen. In den Folgejahren konnten die Leistungen verbessert und die Streuung der Ergebnisse verringert werden, obwohl das deutsche Schulsystem weitgehend unverändert blieb. Trotz der Fortschritte besteht weiterhin Handlungsbedarf, um das Kompetenzniveau unabhängig von der sozialen Herkunft zu erhöhen.
3.2. Soziale Ungleichheit in der schulischen Bildung: Dieses Kapitel diskutiert den Einfluss sozialer Ungleichheit auf die schulische Bildung. Es betont die Bedeutung von Bildung als Entwicklungsprozess zur Autonomie und Verantwortungsfähigkeit. Trotz des Ziels der Bildungsgerechtigkeit beeinflussen die ökonomische Lage der Eltern, deren Bildungsstand, Herkunft und Verhalten die schulischen Leistungen stark. Bildungschancen werden als Ergebnis individueller und sozial bestimmter Entscheidungen von Eltern und institutioneller Mechanismen des Bildungssystems dargestellt.
3.2.1. Schichtspezifische Bildungsungleichheiten: Dieser Abschnitt analysiert den Zusammenhang zwischen sozialer Schicht und Bildungserfolg. Es wird festgestellt, dass das Bildungssystem das Leistungspotenzial von Kindern aus unteren Schichten nicht ausreichend ausschöpft. Der soziale Filter, der Bildungsentscheidungen von Familien und Lehrerurteile umfasst, beeinflusst die Bildungsverläufe und -ergebnisse. Der primäre Herkunftseffekt, die Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom Sozialstatus und der kulturellen Ausstattung der Familie, wird als grundlegend genannt, während der sekundäre Herkunftseffekt kurzfristige Einflüsse auf Bildungschancen beschreibt, z.B. bei Schulwechselentscheidungen.
Schlüsselwörter
Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit, PISA-Studie, soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit, Schichtspezifische Bildungsungleichheiten, Migrationshintergrund, Handlungsperspektiven.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Ausarbeitung: Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem
Was ist der Gegenstand dieser Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung untersucht die Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem, insbesondere anhand der Ergebnisse der PISA-Studien. Sie beleuchtet die Begriffe Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit, analysiert die PISA-Ergebnisse für Deutschland und entwickelt Handlungsperspektiven zur Reduzierung sozialer Bildungsungleichheiten.
Welche Themen werden in der Ausarbeitung behandelt?
Die zentralen Themen sind Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit im deutschen Kontext, die Analyse der PISA-Studien und deren Ergebnisse für Deutschland, schichtspezifische Bildungsungleichheiten, der Einfluss des Migrationshintergrunds auf Bildungsungleichheiten und Handlungsperspektiven zum Abbau sozialer Bildungsungleichheiten.
Wie ist die Ausarbeitung strukturiert?
Die Ausarbeitung enthält eine Einleitung, Kapitel zu Begriffsdefinitionen, eine detaillierte Analyse der PISA-Studie (einschließlich der Ergebnisse für Deutschland und der sozialen Ungleichheit im Bildungssystem, untergliedert nach schichtspezifischen Ungleichheiten und Ungleichheiten aufgrund von Migrationshintergrund), sowie ein Kapitel mit Handlungsperspektiven und ein Literaturverzeichnis.
Welche Ergebnisse der PISA-Studie werden dargestellt?
Die Ausarbeitung präsentiert die PISA-Ergebnisse für Deutschland, die anfänglich unterdurchschnittliche Leistungen im internationalen Vergleich und einen starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg zeigten. Es wird der "PISA-Schock" und die daraus resultierenden bildungspolitischen Diskussionen und Reformen erwähnt. Obwohl sich die Leistungen verbessert haben, besteht weiterhin Handlungsbedarf.
Wie wird soziale Ungleichheit im Bildungssystem analysiert?
Die Ausarbeitung analysiert den Einfluss sozialer Ungleichheit auf die schulische Bildung, wobei die ökonomische Lage der Eltern, deren Bildungsstand, Herkunft und Verhalten als wichtige Einflussfaktoren hervorgehoben werden. Es wird zwischen primärem und sekundärem Herkunftseffekt unterschieden und der "soziale Filter" im Bildungssystem diskutiert.
Welche Handlungsperspektiven werden vorgeschlagen?
Die Ausarbeitung entwickelt Handlungsperspektiven zur Reduzierung sozialer Bildungsungleichheiten, die jedoch im vorliegenden Auszug nicht im Detail beschrieben sind. Diese werden im entsprechenden Kapitel der vollständigen Ausarbeitung erläutert.
Wie werden die Begriffe Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit definiert?
Chancengleichheit wird als normative Forderung nach gleichen Entwicklungsmöglichkeiten für alle definiert, wobei die vollständige Realisierung als unrealistisch betrachtet wird. Bildungsgerechtigkeit wird als gegeben angesehen, wenn Chancengleichheit herrscht, und als das Erreichen eines Bildungsniveaus für jedes Kind, das ein gutes Leben in der modernen Gesellschaft ermöglicht, unabhängig von sozioökonomischen Faktoren.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die Schlüsselbegriffe sind Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit, PISA-Studie, soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit, schichtspezifische Bildungsungleichheiten, Migrationshintergrund und Handlungsperspektiven.
- Quote paper
- Katharina Löbl (Author), 2015, Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit in Deutschland. Eine Analyse mit den PISA-Studien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340636