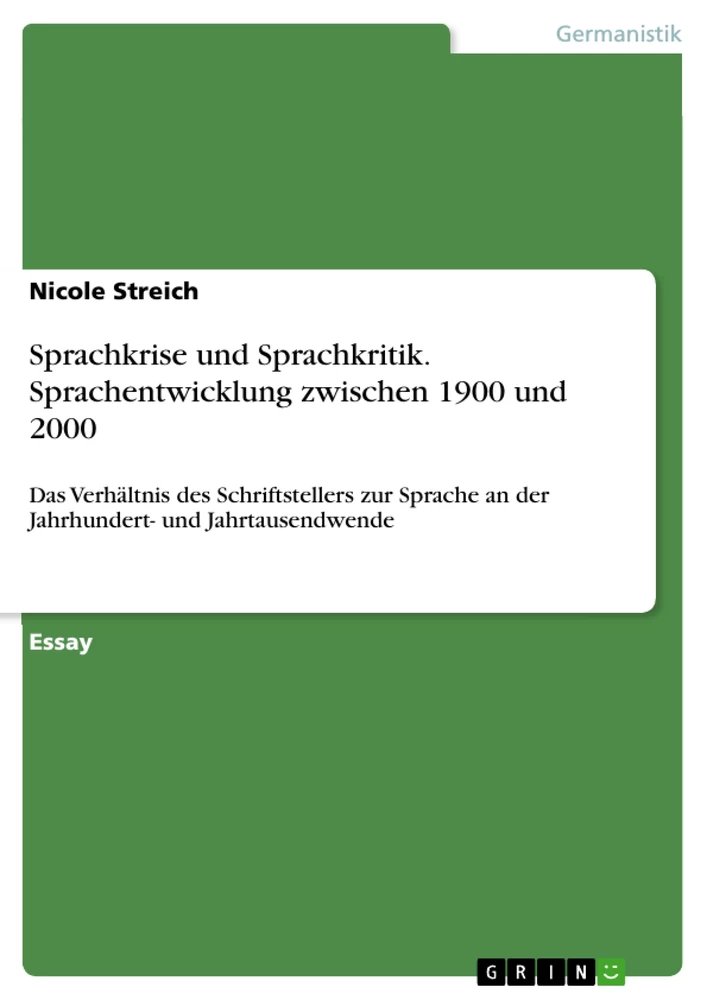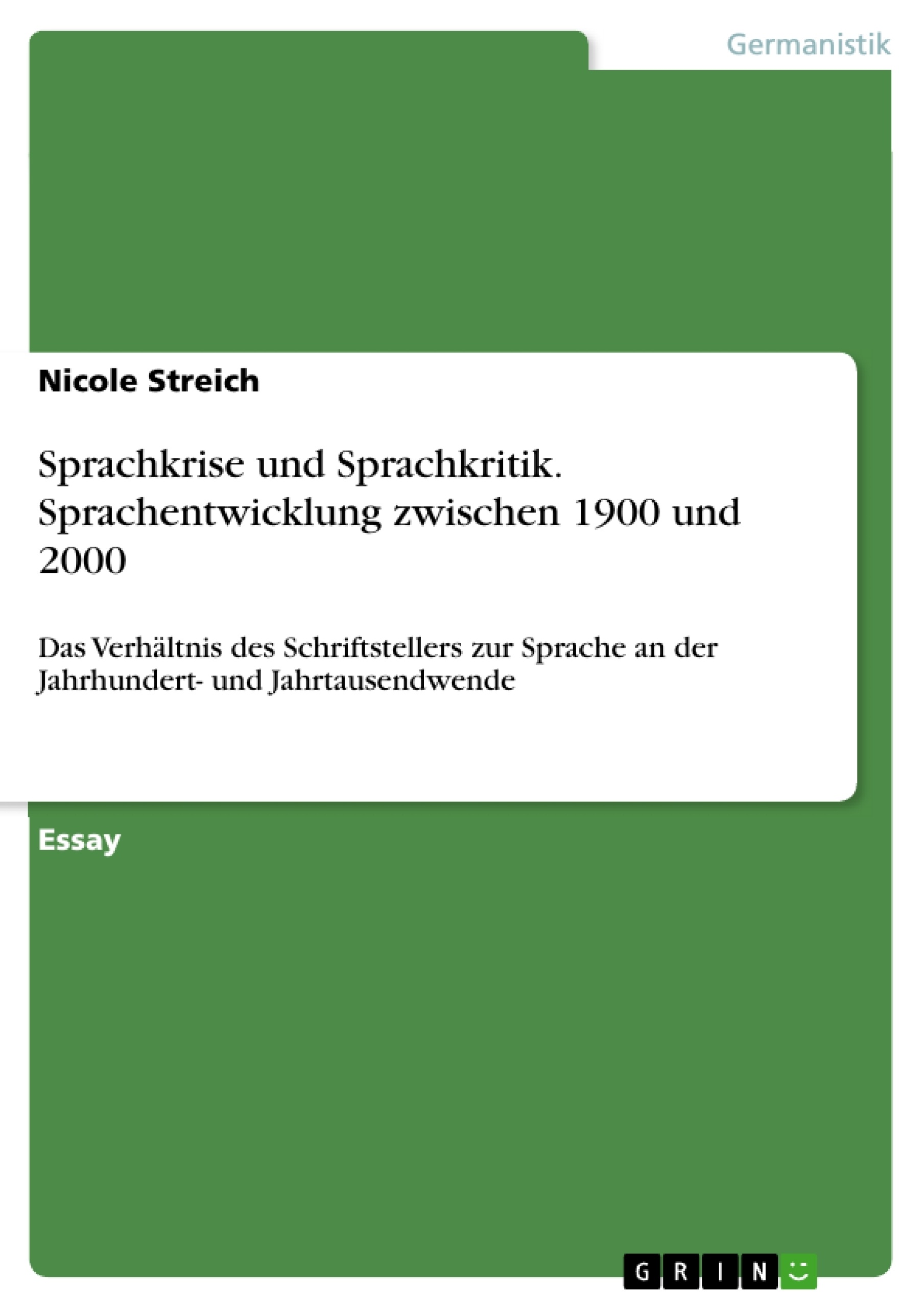„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ sagte einst Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951). Inwieweit diese Behauptung besonderes auf Schriftsteller zutrifft, wird in dieser Arbeit näher untersucht. Dabei geht es weniger um das Zutreffen des genauen Wortlautes dieser Aussage, als darum, zu veranschaulichen, wie sehr die Sprache den Schriftsteller bestimmt. Die Sprache ist ein Grundbaustein der Existenz aller Menschen und doch wissen nur wenige ihre Bedeutung wirklich zu schätzen. Autoren hingegen setzten sich meist ganz explizit mit der Sprache auseinander und so entstand bereits vor Jahrhunderten die sogenannte Sprachkritik. Interessant an diesem Thema ist vor allem, inwieweit sich diese Kritik an der Sprache zwischen 1900 und 2000 entwickelt hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schriftsteller und ihre Sprache
- 2.1 Sprachkritik
- 2.2 Die Unterscheidung von Sprachkrise und Sprachkritik
- 3. Die Sprachkrise um 1900
- 3.1 Hugo von Hofmannsthals Chandos-Brief
- 3.2 Aktuelle Reaktionen auf den Chandos-Brief
- 4. Die Sprache um 2000
- 4.1 Die allgemeine Tendenz zur Sprachkritik
- 4.2 Die Sprachkritik
- 4.3 Die Sprachkrise
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehung des Schriftstellers zur Sprache und beleuchtet die Entwicklung der Sprachkritik und der Sprachkrise im 20. Jahrhundert. Dabei werden die unterschiedlichen Perspektiven und Haltungen von Autoren im Hinblick auf die Sprache und ihre Bedeutung analysiert. Die Arbeit soll zeigen, wie die Sprache die Schriftsteller prägt und wie sich das Verhältnis zwischen Sprache und Schriftsteller im Wandel der Zeit verändert.
- Die Sprachkritik und ihre Entwicklung im Laufe des 20. Jahrhunderts
- Die Unterscheidung zwischen Sprachkrise und Sprachkritik
- Der Chandos-Brief von Hugo von Hofmannsthal als Beispiel für die Sprachkrise um 1900
- Die aktuelle Sprachkritik und ihre Unterschiede zur Sprachkrise
- Der Wandel des Verhältnisses zwischen Schriftsteller und Sprache im 20. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach der Bedeutung der Sprache für den Schriftsteller in den Vordergrund. Das Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Sprachkritik und stellt die Frage, ob die Sprachkrise um 1900 überwunden ist.
Kapitel 2 behandelt die Sprachkritik von Autoren und analysiert die Kritikpunkte an der Sprache. Im Fokus stehen die Überdeterminierung der Sprache durch die Umgangssprache und die literarische Tradition sowie die Unzulänglichkeit der Sprache, die innere und äußere Realität adäquat auszudrücken.
Kapitel 3 untersucht die Sprachkrise um 1900 anhand des Beispiels des "Chandos Briefes" von Hugo von Hofmannsthal. Das Kapitel beleuchtet die Reaktionen auf den Brief und die Bedeutung des Textes für das Verständnis der Sprachkrise um 1900.
Kapitel 4 befasst sich mit der aktuellen Sprachkritik und stellt die Unterschiede zur Sprachkrise um 1900 heraus. Das Kapitel behandelt die Veränderung des Blickwinkels auf die Sprache und die zunehmende Kritik an der Sprache in ihrer äußeren Form und Funktion.
Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und beleuchtet die Veränderungen im Verhältnis zwischen Schriftsteller und Sprache im Laufe des 20. Jahrhunderts.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Sprachkritik, der Sprachkrise, dem Verhältnis des Schriftstellers zur Sprache, dem Chandos-Brief von Hugo von Hofmannsthal, der Jahrhundert- und Jahrtausendwende, dem Wandel der Sprache, dem Einfluss der Sprache auf die Gesellschaft und die Bedeutung der Sprache für das menschliche Dasein.
- Quote paper
- Nicole Streich (Author), 2004, Sprachkrise und Sprachkritik. Sprachentwicklung zwischen 1900 und 2000, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34058