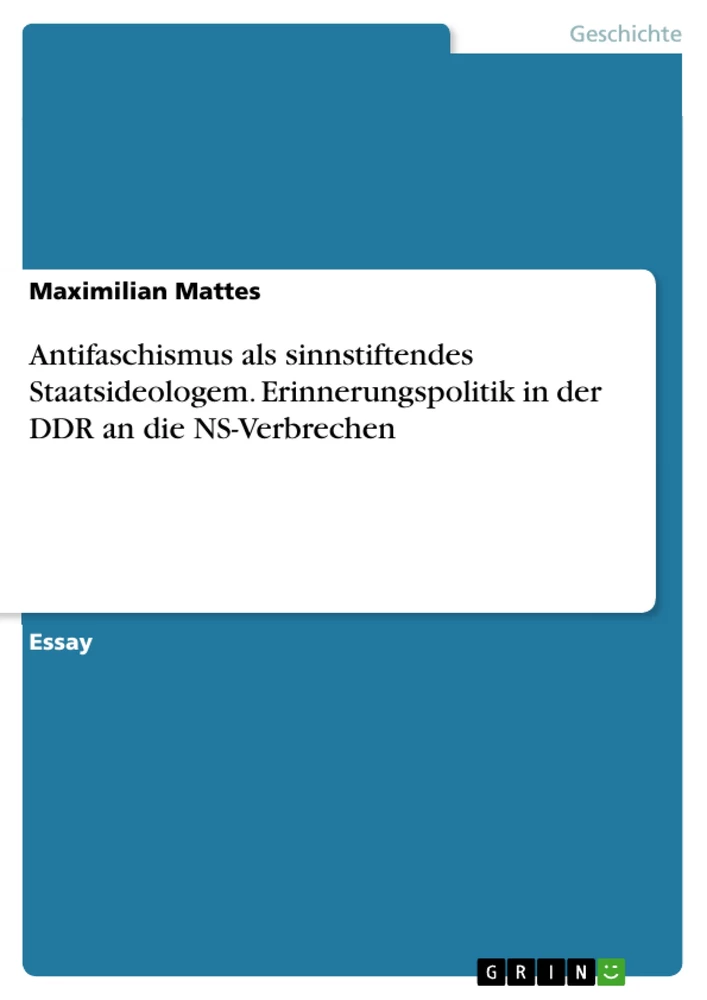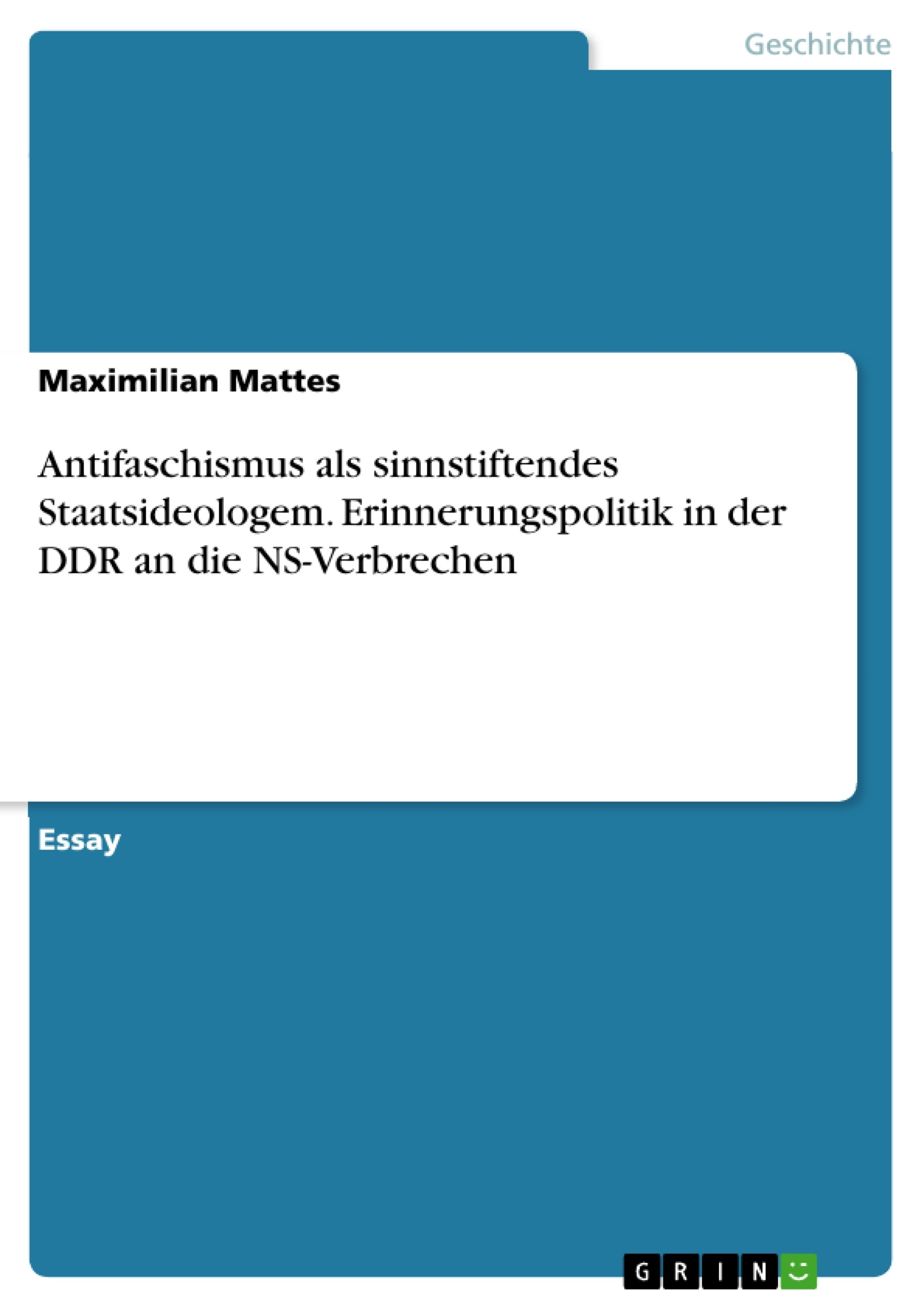Auf dem „Platz der Einheit“ in Potsdam, also auf dem Staatsgebiet der ehemaligen DDR steht das „Mahnmal für die antifaschistischen Widerstandskämpfer“, welches im Mai 1975 errichtet wurde. Es trägt den in Großbuchstaben eingemeißelten Schriftzug: „UNSER OPFER/ UNSER KAMPF /GEGEN FASCHISMUS UND KRIEG/ DEN LEBENDEN ZUR MAHNUNG UND VERPFLICHTUNG“.
Auf den ersten Blick scheint dieses Denkmal wie eines unter hunderten anderer Denkmäler in der heutigen Bundesrepublik den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet zu sein. Mangels einer noch fehlenden wichtigen geschichtlichen Hinweistafel, auf welcher die ideologische Motivation und die eigentlich beabsichtigte sozial-psychologische sowie auch sozialistisch-propagandistische Wirkung des Mahnmals auf Besucher und Bewohner der Stadt Potsdam deutlich herausgearbeitet und verschriftlicht steht, wird sich an diesem Umstand wenig ändern. Am interessantesten bleibt natürlich in erster Linie der exemplarische Schriftzug. Eine sprachliche Analyse desselben zusammen mit dem heutigen Wissen über das zu DDR-Zeiten sinnstiftende „Staatsideologem Antifaschismus“ lassen viele Beobachtungen über die Erinnerungspolitik der DDR zu NS-Verbrechen und zur NS-Zeit zu.
Der folgende Essay will als Grundlage für die spätere Diskussion über einen zukünftigen adäquateren öffentlichen Umgang mit ehemaligen DDR-Denkmälern zum Nationalsozialismus zunächst auf den in der DDR-Staatsdoktrin tief verwurzelten Antifaschismus eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Erinnerungspolitik in der DDR an die NS-Verbrechen – Der Antifaschismus als sinnstiftendes Staatsideologem
- Der Antifaschismus als zentrale Doktrin
- DDR-Erinnerungspolitik und ihre Auswirkungen
- Die Instrumentalisierung des Antifaschismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay untersucht die Erinnerungspolitik der DDR an die NS-Verbrechen und die Rolle des Antifaschismus als sinnstiftendes Staatsideologem. Es werden die ideologischen Grundlagen und die Auswirkungen der DDR-Erinnerungspolitik auf die Bevölkerung analysiert.
- Die ideologischen Grundlagen der DDR-Erinnerungspolitik
- Die Rolle des Antifaschismus als Staatsideologem
- Die Instrumentalisierung von Denkmälern und Gedenkstätten
- Die Auswirkungen auf die kollektive Erinnerung und Identitätsbildung
- Die Einseitigkeit der DDR-Erinnerungspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Essay beginnt mit einer Analyse des "Mahnmals für die antifaschistischen Widerstandskämpfer" auf dem Platz der Einheit in Potsdam, um die ideologischen Elemente der DDR-Erinnerungspolitik zu verdeutlichen.
- Es wird die Rolle des Antifaschismus als zentrale Doktrin der DDR-Staatsdoktrin untersucht, die sowohl als Rechtfertigung für die sozialistische Gesellschaft diente als auch eine kollektive Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus verhinderte.
- Der Essay beleuchtet die Auswirkungen der ideologisch ausgerichteten DDR-Erinnerungspolitik auf die Bevölkerung, insbesondere die gesellschafts-psychologischen und identitätsstiftenden Folgen von Denk- und Mahnmälern.
- Es werden Beispiele für die Instrumentalisierung von Denkmälern und Gedenkstätten, wie das Sachsenhausener Denkmal für die Opfer des Faschismus, analysiert.
- Der Essay zeigt die Einseitigkeit der DDR-Erinnerungspolitik auf, die den Fokus auf den antifaschistischen Widerstand legte und andere Opfergruppen, wie die Juden, weitgehend ausblendete.
Schlüsselwörter
Der Essay befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Antifaschismus, Erinnerungspolitik, DDR, NS-Verbrechen, Staatsideologie, kollektive Erinnerung, Identitätsbildung, Denkmäler, Gedenkstätten, Propaganda und Instrumentalisierung.
- Quote paper
- Maximilian Mattes (Author), 2012, Antifaschismus als sinnstiftendes Staatsideologem. Erinnerungspolitik in der DDR an die NS-Verbrechen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340250