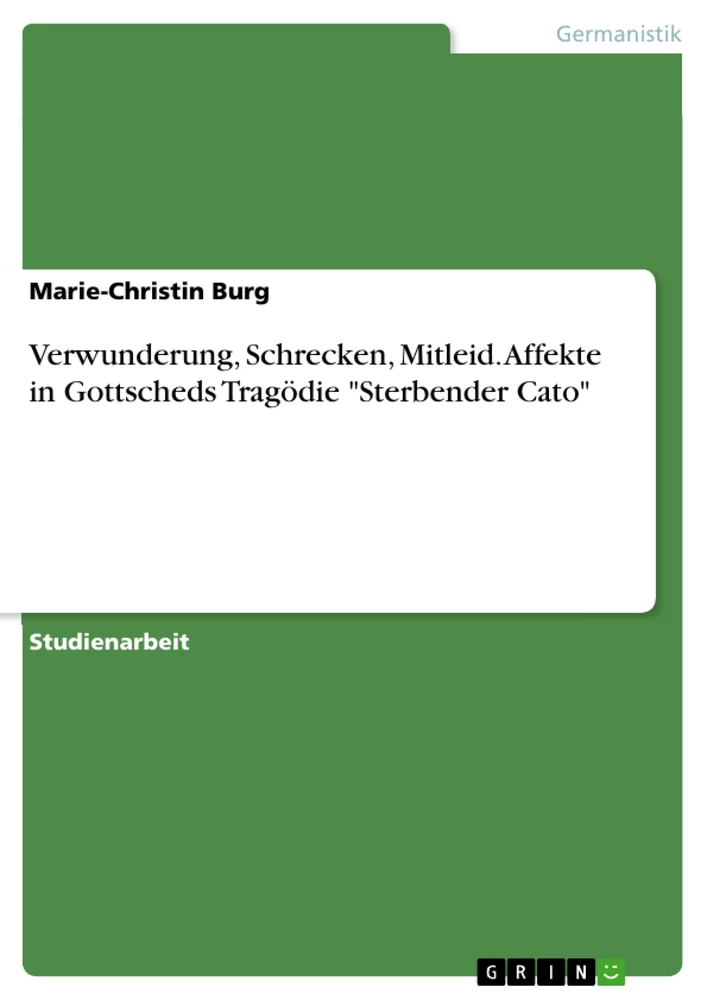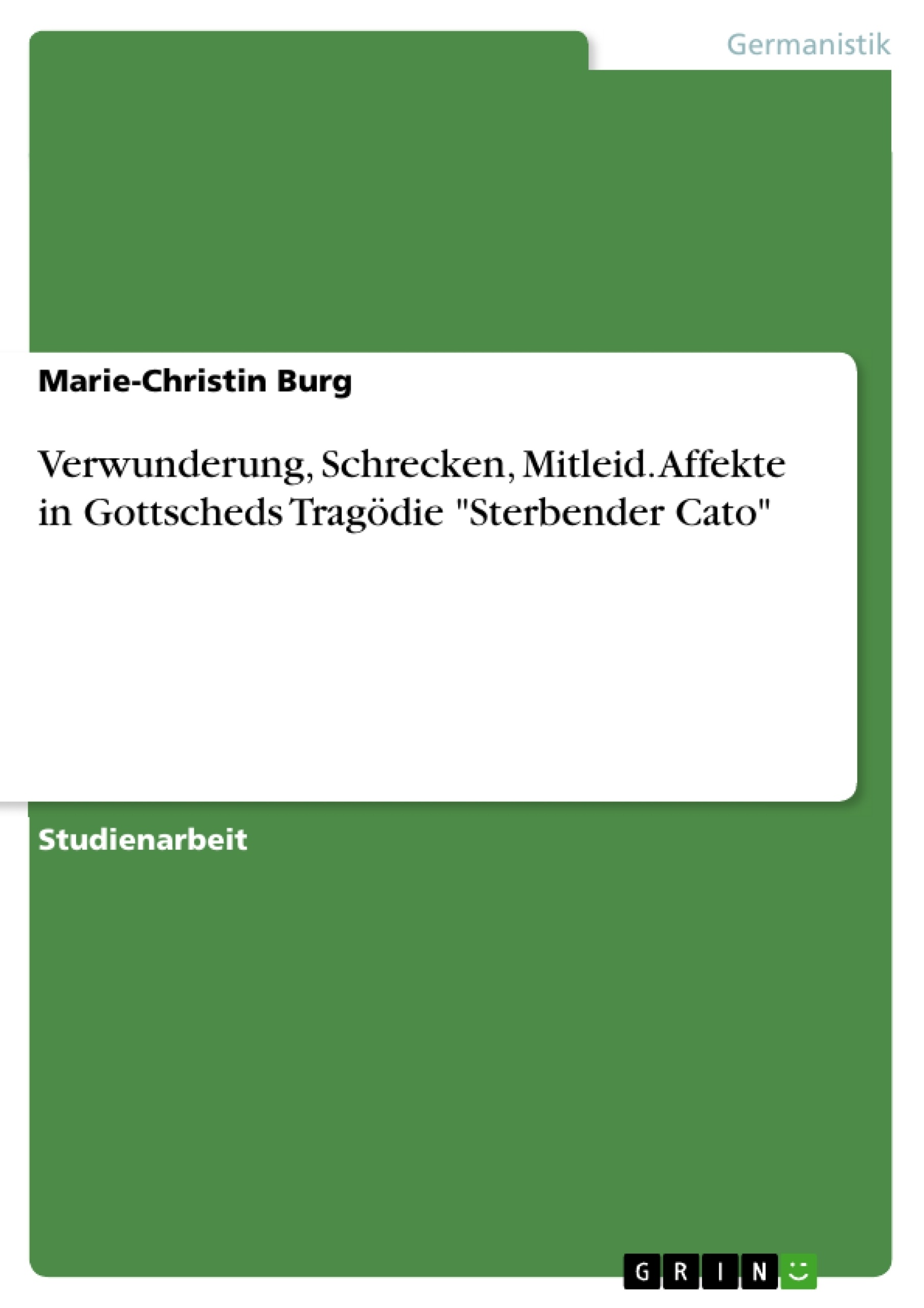Ein wesentlicher Aspekt der Tragödie ist nach Johann Christoph Gottsched die Erweckung von Affekten. Hierbei stehen die Affekte Verwunderung, Schrecken und Mitleid im Vordergrund, welche auch den Ausgang der vorliegenden Untersuchung bilden. Nach Heide Hollmer zeigt sich Gottscheds Anliegen, die theoretischen Vorgaben der „Critischen Dichtkunst“ durch Textbeispiele zu illustrieren, in seiner Tragödie des „Sterbenden Cato“ vorbildlich (vgl. Hollmer 1994).
Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit von der Annahme ausgegangen, dass die von Gottsched genannten Affekte sich auch in der im Jahre 1732 erschienen Ausgabe des „Sterbenden Cato“, anhand der dargestellten dramatischen Figuren, finden lassen müssten. Das als „Mustertragödie“ (Krause 2001) der Frühaufklärung deklarierte Trauerspiel steht nach Frank Krause sogar neben Johann Elias Schlegels „Canut“ exemplarisch für den Anstoß der deutschen Aufklärung. Dabei stellt das Drama Gottscheds jedoch eher ein Übergangsphänomen dar, indem das nach der Poetik von Aristoteles aufgebaute Werk die „barocke Dramaturgie und die aufklärerische Absicht“ miteinander zu vereinigen versucht (vgl. Krause 2001).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die Ausgangssituation
- Die Affekte
- Affektenlehre von der barocken Musiktheorie zu Wolff und Thomasius
- Gottscheds,,Affektenlehre“ und die „Gemütsforschung“
- Verwunderung/Bewunderung Cato
- Schrecken Pharnaces
- Mitleid und Traurigkeit Arsene/Porcia
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Funktion der Affekte in Johann Christoph Gottscheds Tragödie „Der Sterbende Cato“, um deren Relevanz im Kontext der deutschen Frühaufklärung zu beleuchten. Ziel ist es, die von Gottsched selbst formulierten Affekte, die er als zentral für die Wirkung der Tragödie ansieht, in der Handlung und den Figuren des Stückes zu analysieren.
- Die Rolle der Affekte in Gottscheds Tragödientheorie
- Die Entwicklung der Affektenlehre von der Barockzeit bis zur Aufklärung
- Die Darstellung von Verwunderung, Schrecken und Mitleid in den Figuren des „Sterbenden Cato“
- Der Einfluss von Gottscheds Tragödie auf die Entwicklung des deutschen Theaters
- Die Rezeption von Gottscheds „Sterbendem Cato“ in der Literaturgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Funktion der Affekte in Gottscheds „Sterbendem Cato“ vor und erläutert den theoretischen Rahmen der Untersuchung.
Der Hauptteil beschäftigt sich zunächst mit der Ausgangssituation des deutschen Theaters im 17. Jahrhundert. Anschließend wird die Affektenlehre Gottscheds im Kontext ihrer historischen Entwicklung beleuchtet, wobei die Bedeutung der Verstellungslehre und die Rolle von Wolff und Thomasius im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind Affekte, Tragödie, Frühaufklärung, Johann Christoph Gottsched, „Der Sterbende Cato“, Verstellungslehre, Wolff, Thomasius, Verwunderung, Schrecken, Mitleid, bürgerliches Trauerspiel.
- Quote paper
- Marie-Christin Burg (Author), 2016, Verwunderung, Schrecken, Mitleid. Affekte in Gottscheds Tragödie "Sterbender Cato", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340030