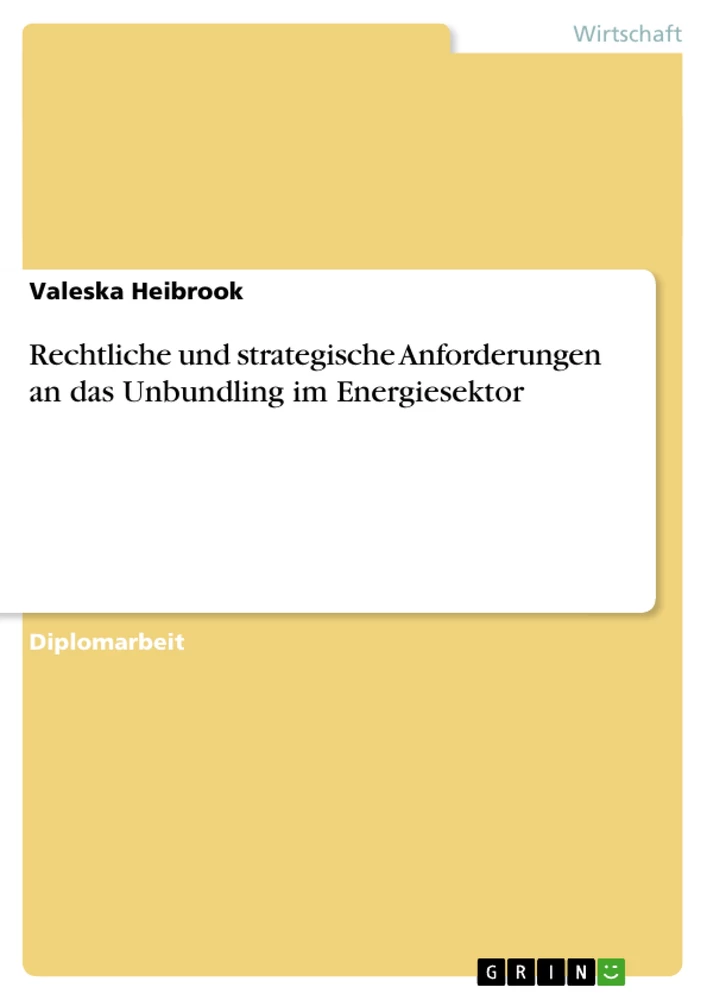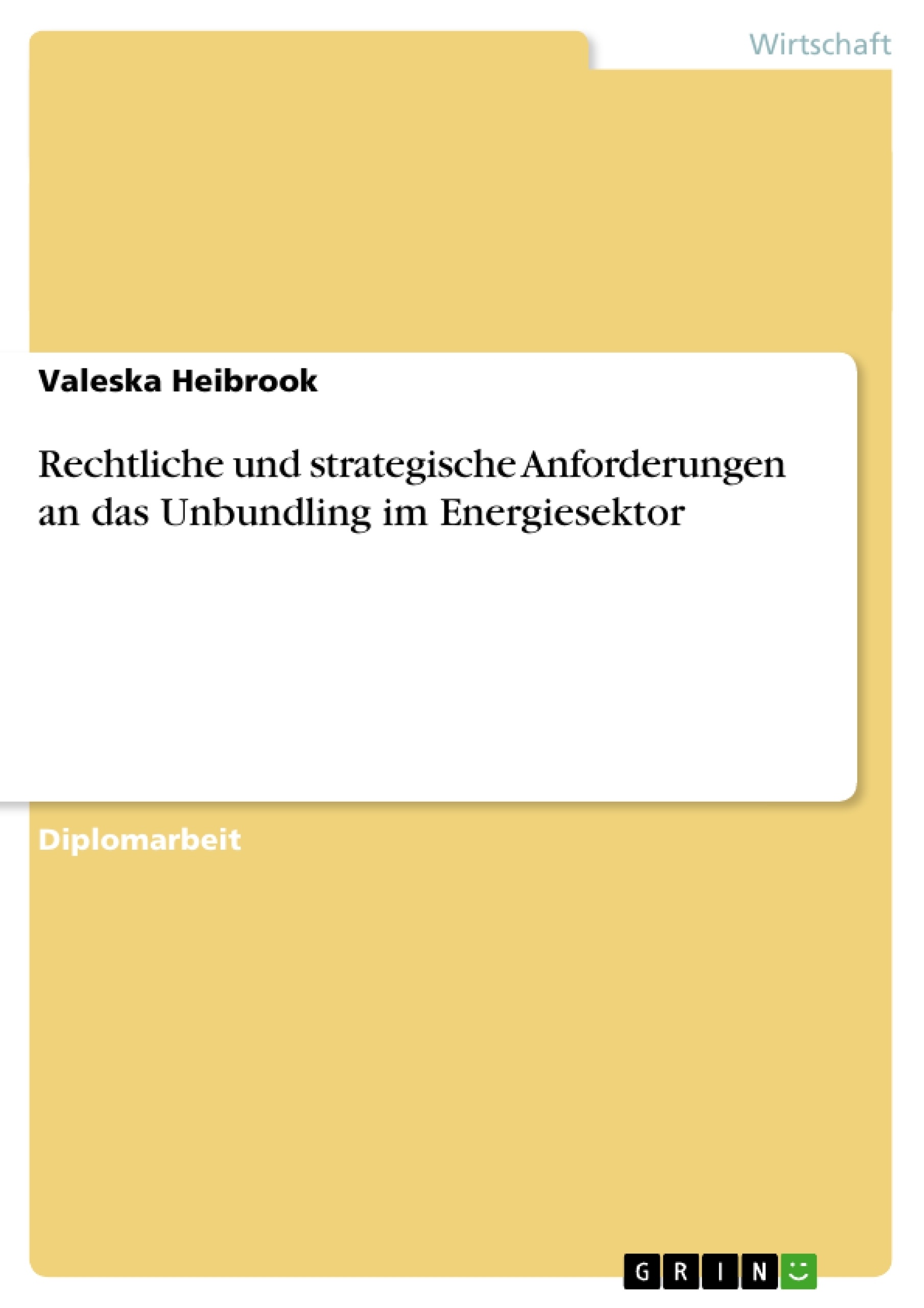Das Schlagwort „Unbundling“ dominiert in den letzten Jahren jede Diskussion des Energiesektors. Eben diese Tatsache ist Anlass für die vorliegende Arbeit. „Zudem ist die Welle der Veränderung noch keineswegs ausgerollt. Lehr- und Erläuterungsbüchern, die älter als fünf Jahre sind, kommt heute kaum noch mehr als rechtsgeschichtliche Bedeutung zu.“ Einen identischen Begriff zu „Unbundling“ kennt der deutsche Wortschatz nicht, dennoch existieren zahlreiche Entsprechungen. Am ehesten treffen wohl die Synonyme „Entflechtung“ , „Entbündelung“ oder „Trennung“ zu. Unbundling im Energiesektor ist die Trennung der Monopol- und Wettbewerbsbereiche. Es handelt sich um eine Maßnahme, bei der die Wertschöpfungsstufen einer Unternehmung voneinander getrennt und in eigenständige Unternehmensbereiche überführt werden. Wie diese Trennung vollzogen werden kann, soll im Verlauf dieser Arbeit erläutert werden. Ursächlich für die Unbundling-Diskussion waren ursprünglich die Liberalisie-rungsbemühungen der EU, welche in den Jahren 1996 und 1998 in mehreren Sektoren eine Marktöffnung anstrebte, mit dem Ziel der Wettbewerbssteigerung und Effizienzerhöhung. Neben der Telekommunikations- und Postbranche trafen diese Bestrebungen auch den Energiesektor. Liberalisierung im Energiesektor, insbesondere auf dem Strommarkt, bedeutet Wettbewerb unter den Produzenten. Wettbewerb heißt, dass der Kunde seinen Anbieter selbständig wählen und zu ihm wechseln kann. Problematisch ist dabei, dass zwischen den Produzenten und den Kunden der Netzbetreiber steht. In der Regel sind die Energieversorgungsunternehmen neben ihrer Tätigkeit als Stromversorger, Inhaber des Netzes. Ein direkter Wettbewerb ist in einer solchen Situation unmöglich. Angesichts dieses Problems hat die EU-Kommission im Jahre 2003 zwei Beschleunigungsrichtlinien erlassen, welche in Deutschland derzeit in nationales Recht umgesetzt werden. Die EU schreibt den Energieversorgungsunternehmen darin die Umsetzung des Unbundling und somit die Ausgründung des Netzes vor und stellt sie damit vor große Herausforderungen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Entwicklung des Unbundling
- 1. Arten und Eigenschaften von Netzen
- 2. Entwicklung des Unbundling
- 3. Beschreibung und Ziele des Unbundling
- 4. De-Minimis-Grenze
- 5. Regulierungsbehörde
- 6. Zusammenfassung
- III. Rechtliche Anforderungen an das Unbundling
- 1. EU-Beschleunigungsrichtlinien Strom und Gas
- a. Buchhalterisches Unbundling
- b. Informatorisches Unbundling
- c. Organisatorisches Unbundling
- d. Legal Unbundling
- e. Rechtlich unzulässige Stufe: Ownership Unbundling
- 2. EnWG-Entwurf
- 3. Verbändevereinbarung
- 4. Kommentare und Stellungnahmen
- 5. Zusammenfassung
- 1. EU-Beschleunigungsrichtlinien Strom und Gas
- IV. Strategische Anforderungen an das Unbundling im Unternehmen
- 1. Herausforderungen und Ziele
- 2. Chancen und Risiken
- 3. Strategieentwicklung
- a. Umsetzung anhand von Modellen
- b. Vertragliche Ausgestaltung
- 4. Entscheidungsfindung und Positionierung am Markt
- 5. Zusammenfassung
- V. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die rechtlichen und strategischen Anforderungen an das Unbundling im Energiesektor. Sie untersucht die Entwicklung des Unbundlings, die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die strategischen Herausforderungen und Chancen für Unternehmen im Zuge der Deregulierung des Energiemarktes.
- Entwicklung des Unbundling im Energiesektor
- Rechtliche Anforderungen an das Unbundling auf nationaler und europäischer Ebene
- Strategische Herausforderungen und Chancen für Unternehmen im Zuge des Unbundlings
- Modelle und Ansätze zur Strategieentwicklung im Kontext des Unbundlings
- Entscheidungsfindung und Positionierung am Markt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Unbundling im Energiesektor ein und erläutert die Relevanz der Thematik im Kontext der Deregulierung des Energiemarktes. Im zweiten Kapitel wird die Entwicklung des Unbundlings anhand der verschiedenen Arten und Eigenschaften von Netzen nachgezeichnet. Die rechtlichen Anforderungen an das Unbundling werden im dritten Kapitel beleuchtet, wobei die EU-Beschleunigungsrichtlinien, der EnWG-Entwurf sowie die Verbändevereinbarung im Detail betrachtet werden. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den strategischen Anforderungen an das Unbundling im Unternehmen, wobei die Herausforderungen und Chancen, sowie die Strategieentwicklung und Entscheidungsfindung im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Unbundling, Energiesektor, Deregulierung, Rechtliche Rahmenbedingungen, Strategische Anforderungen, Unternehmen, EU-Beschleunigungsrichtlinien, EnWG, Verbändevereinbarung, Modelle, Strategieentwicklung, Entscheidungsfindung, Marktpositionierung.
- Quote paper
- Valeska Heibrook (Author), 2004, Rechtliche und strategische Anforderungen an das Unbundling im Energiesektor, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33997