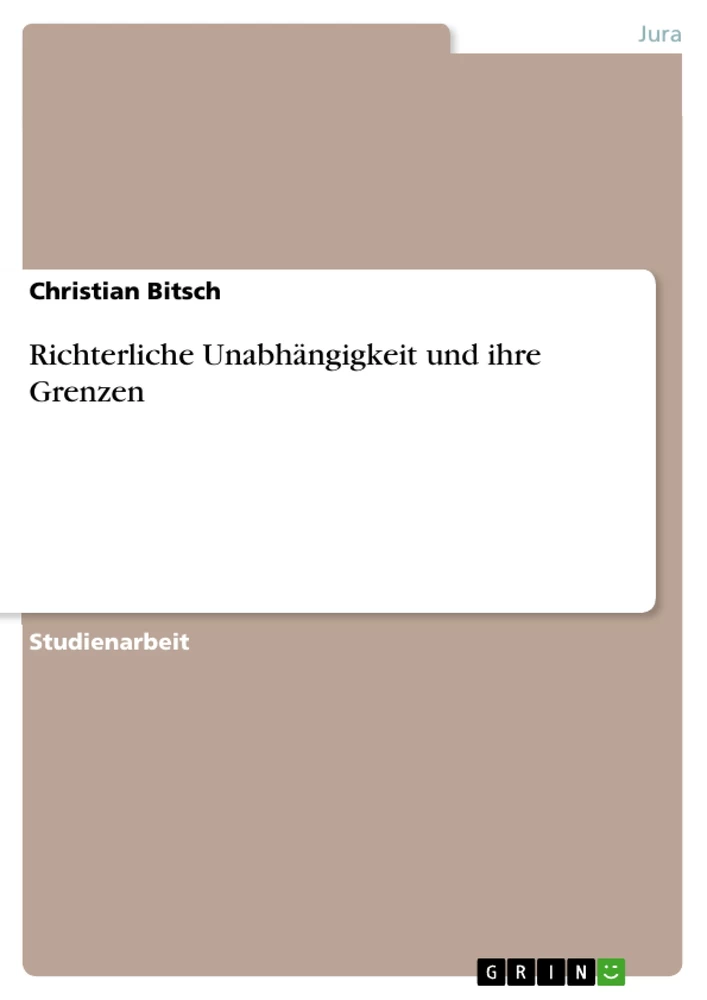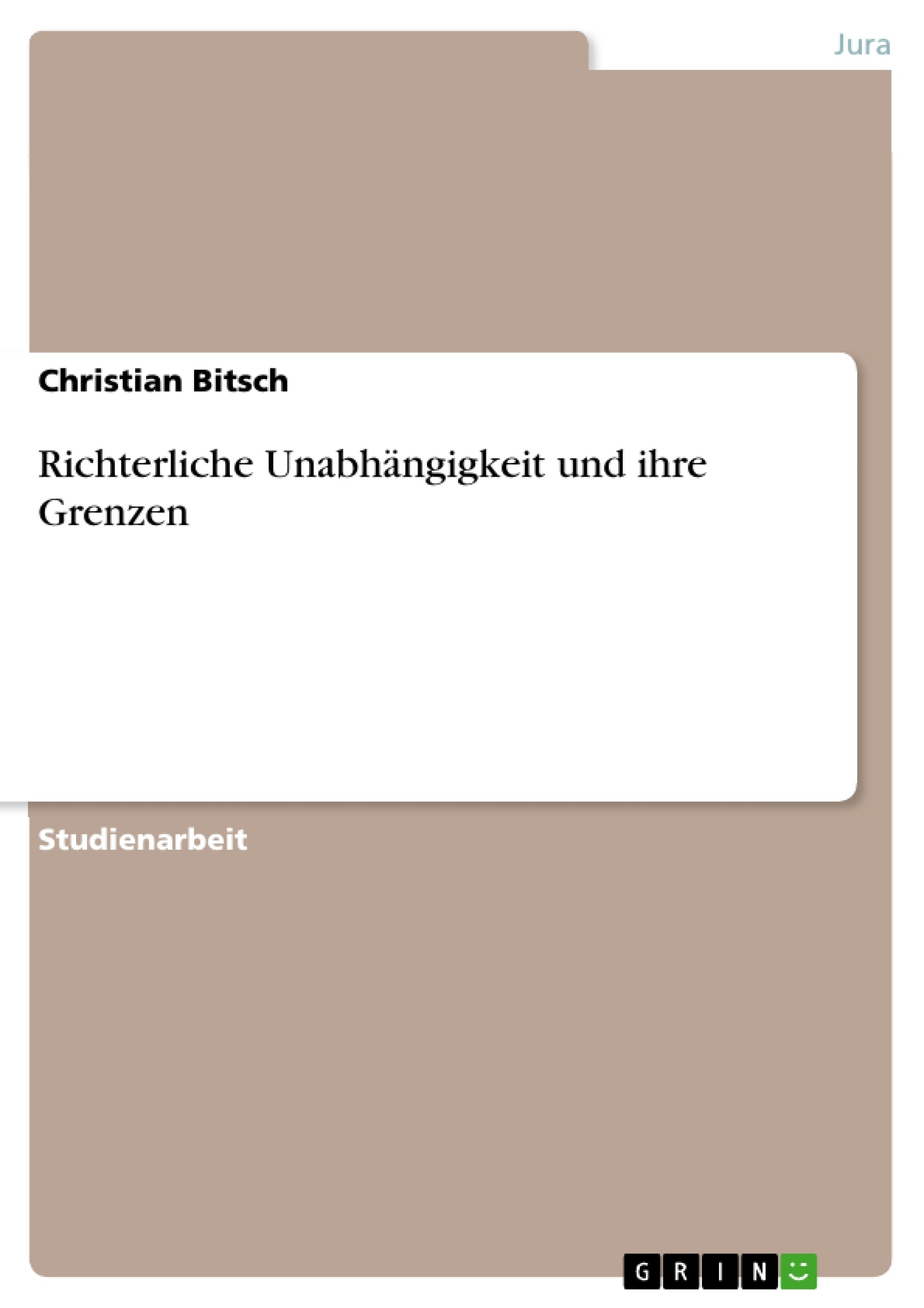Mit dem Ausruf „Wehe dem armen Opfer, wenn derselbe Mund, der das Gesetz gab, auch das Urteil spricht“1, brachte schon Friedrich Schiller in seinem Drama „Maria Stuart“ die Forderung nach unabhängigen Gerichten deutlich zum Ausdruck.
Ihm liegt die Idee der richterliche Unabhängigkeit als Ausfluss der Gewaltenteilung2 zu Grunde. Daneben ist sie aber auch Ursprung eines gerechten Rechtsstaates3, indem Rechtsfälle nicht von einem Beamten oder Minister, sondern von einem unbeteiligten Dritten4, dem Richter, entschieden werden.
In Zeiten der sparsamen öffentlichen Haushaltspolitik scheint dieser Ausspruch allmählich zu verklingen. So denken Finanz- und Justizpolitiker aller Parteien immer intensiver über Reformen des als teuer und behäbig empfunden Justizapparates nach5. Nach jahrzehntelanger Spar- und Kürzungspolitik im personellen und materiellen Bereich6 stehen gegenwärtig ebenso vielversprechend wie beängstigend klingende Projekte zur Debatte. Da ist die Rede von der „Zusammenlegung einzelner Gerichtszweige“7 oder von „Ökonomisierung der Justiz“8, sogar über „Kostenkontrolle“ und „Benchmarking“ innerhalb der Gerichtsbarkeiten9 wird offen nachgedacht 10.
[...]
1 Schiller, F.: „Maria Stuart“, Reclam-Ausgabe 2001, 1. Aufzug, 7. Auftritt (Zeile 858 ff.).
2 Kissel, O.: „Gerichtsverfassungsgesetz“, § 1 Rdnr. 1.
3 Jarass, H-D., in: Jarass/Pieroth, Art. 20, Rdnr. 15 f.
4 BVerfGE 3, 377 (381); 4, 331 (346); 14, 56 (69); vgl. auch Pieroth, B., in: Jarass/Pieroth, Art. 92, Rdnr. 5.
5 Beschluss der Herbstkonferenz der Justizminister am 25.11.2004 in Berlin, veröffentlicht unter: http://www2.
bremen.de/justizsenator/Kap8/hbeschl/BV-Endfassung%20Einleitung_Presse.pdf
6 Lorse, J.: „Personalentwicklung von Richtern – quo vadis?“, in: DRiZ 2004, 122 ff.
7 Flint, T.: „Für eine Zusammenlegung von Sozialgerichten und Verwaltungsgerichten“, in: DRiZ 2004, 217 ff.
8 Vgl. hierzu: Schulze-Fielitz, H./ Schütz, C.: „Einleitung“, in: Dies. (Hrsg.): Justiz und Justizverwaltung
zwischen Ökonomisierungsdruck und Unabhängigkeit“,, S. 9 ff.
9 Vgl. den „Erfahrungsbericht“ von Brand, J.: „Benchmarking in der nordrhein-westfälischen Sozialgerichtsbarkeit“, in: Schulze-Fielitz/ Schütz (Fn. 8), S. 99 ff.
10 Vgl. hierzu die Anmerkungen von Kirchhof, in FAZ vom 01.12.04 und Müller, in: FAZ vom 07.12.04.
Inhaltsverzeichnis
- A. EINLEITUNG
- B. HISTORISCHE ENTWICKLUNG
- I. Mittelalter
- II. Das Reichskammergericht
- III. Die Entwicklung in Preußen im 18. Jahrhundert
- IV. Verfassungen in den deutschen Staaten zwischen 1818 und 1871
- VI. Das Kaiserreich und Gerichtsverfassung
- VII. Weimarer Republik
- VIII. Nationalsozialismus
- IX. Die Lage in der DDR
- X. Entwicklungen zum Grundgesetz
- C. RICHTERLICHE UNABHÄNGIGKEIT IN DEUTSCHLAND
- I. Der Begriff der Rechtsprechung im Sinne des Art. 92 GG
- 1. Formelle Definition
- 2. Materielle Definition
- 3. Gewonnene Definition
- II. „Richter" im Sinne des Art. 97 GG
- 1. Allgemeines
- 2. Ausgewählte Beispiele
- 3. Zusammenfassung
- III. Begründung und Typus der richterlichen Unabhängigkeit
- 1. Richterliche Unabhängigkeit als Grundrecht?
- 2. Richterliche Unabhängigkeit als staatsorganisatorische Konkretisierung?
- IV. Inhalt und Grenzen der Unabhängigkeit
- 1. Institutionelle Unabhängigkeit
- a. Grundsatz: institutionelle Unabhängigkeit
- b. Durchbrechung und Grenzen
- c. Zusammenfassung
- 2. Sachliche Unabhängigkeit
- a. Kernbereich
- b. Äußerer Ordnungsbereich
- c. Sachliche Unabhängigkeit gegenüber der Exekutive
- aa. Einwirkungen auf den Kernbereich
- bb. Einfluss auf äußere Rahmenbedingungen
- cc. Einzelfragen
- d. Sachliche Unabhängigkeit gegenüber der Legislative und Gesetzesbindung
- aa. Gesetzesbindung
- bb. Dennoch: Unabhängigkeit im Einzelfall
- e. Sachliche Unabhängigkeit gegenüber der Rechtsprechung?
- f. Sachliche Unabhängigkeit gegenüber Privaten?
- g. Zusammenfassung
- 3. Persönliche Unabhängigkeit
- a. Grundsatz: Unversetzbarkeit und Unabsetzbarkeit
- b. Grenzen der persönlichen Unabhängigkeit
- 4. Innere Unabhängigkeit - Unvoreingenommenheit
- 5. Verpflichtung zur Unabhängigkeit?
- 1. Institutionelle Unabhängigkeit
- V. Weitere Grenzen der Unabhängigkeit
- 1. Sanktionen gegen den Richter
- a. Strafrechtliche Verfolgbarkeit
- b. Dienstaufsicht und Disziplinarmaßnahmen
- aa. Maßnahmen
- bb. Förmliche Disziplinarverfahren
- cc. Zuständigkeit
- c. Die zivilrechtliche Amtshaftung
- d. Die Richteranklage vor dem Bundesverfassungsgericht
- 2. „Außer-rechtliche“ Grenzen der Unabhängigkeit
- a. Beförderungen und Beurteilungszwang
- aa. Beförderungen
- bb. Dienstliche Beurteilungen
- cc. Zusammenfassung
- b. Aktuelle Entwicklungen
- aa. Benchmarking
- bb. Controlling
- cc. Überlastung und „Ärmlichkeitsprinzip“
- c. Selbstverwaltung als Ausweg?
- a. Beförderungen und Beurteilungszwang
- VI. Rechtsschutz gegen unzulässige Eingriffe in die Unabhängigkeit
- 1. Der Rechtsweg des Richters
- a. Dienstgerichte
- b. Der Verwaltungsrechtsweg
- c. Verfassungsbeschwerde durch den Richter
- 2. Der Rechtsweg der Verfahrensbeteiligten
- a. Ablehnung des Richters
- b. Verfassungsbeschwerde durch den Verfahrensbeteiligten
- 1. Der Rechtsweg des Richters
- D. RICHTERLICHE UNABHÄNGIGKEIT IN EU UND EUROPARAT
- I. Die Richter am EuGH
- II. Die Richter am EGMR
- E. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem wichtigen Thema der richterlichen Unabhängigkeit in Deutschland. Ziel ist es, den Begriff der richterlichen Unabhängigkeit im Kontext des Grundgesetzes zu analysieren und seine historischen Wurzeln aufzuzeigen. Darüber hinaus werden die Inhalte und Grenzen der richterlichen Unabhängigkeit in Deutschland untersucht, wobei ein besonderes Augenmerk auf die verschiedenen Formen der Unabhängigkeit – institutionelle, sachliche, persönliche und innere Unabhängigkeit – gelegt wird.
- Historisches Verständnis der richterlichen Unabhängigkeit
- Der Begriff der Rechtsprechung und „Richter" im Sinne des Grundgesetzes
- Inhalt und Grenzen der institutionellen, sachlichen und persönlichen Unabhängigkeit
- Rechtsschutz gegen unzulässige Eingriffe in die Unabhängigkeit
- Richterliche Unabhängigkeit im europäischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und liefert eine kurze Übersicht über die historische Entwicklung der richterlichen Unabhängigkeit. Kapitel B beleuchtet die historischen Entwicklungen der richterlichen Unabhängigkeit in Deutschland, beginnend im Mittelalter bis hin zur Entwicklung im Grundgesetz. Kapitel C widmet sich der richterlichen Unabhängigkeit in Deutschland im Detail, einschließlich des Begriffs der Rechtsprechung und der Definition von „Richtern" im Sinne des Grundgesetzes. Des Weiteren wird die Begründung und der Typus der richterlichen Unabhängigkeit, sowie deren Inhalt und Grenzen diskutiert. Kapitel V untersucht weitere Grenzen der Unabhängigkeit, einschließlich Sanktionen gegen Richter, „außer-rechtliche" Grenzen und den Rechtsschutz gegen unzulässige Eingriffe. Kapitel D betrachtet die richterliche Unabhängigkeit in der Europäischen Union und im Europarat, indem es die Situation der Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) und am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) beleuchtet. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Richterliche Unabhängigkeit, Grundgesetz, Rechtsprechung, institutionelle Unabhängigkeit, sachliche Unabhängigkeit, persönliche Unabhängigkeit, innere Unabhängigkeit, Rechtsschutz, Europäische Union, Europarat, EuGH, EGMR.
- 1. Sanktionen gegen den Richter
- I. Der Begriff der Rechtsprechung im Sinne des Art. 92 GG
- Citar trabajo
- Christian Bitsch (Autor), 2005, Richterliche Unabhängigkeit und ihre Grenzen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33958