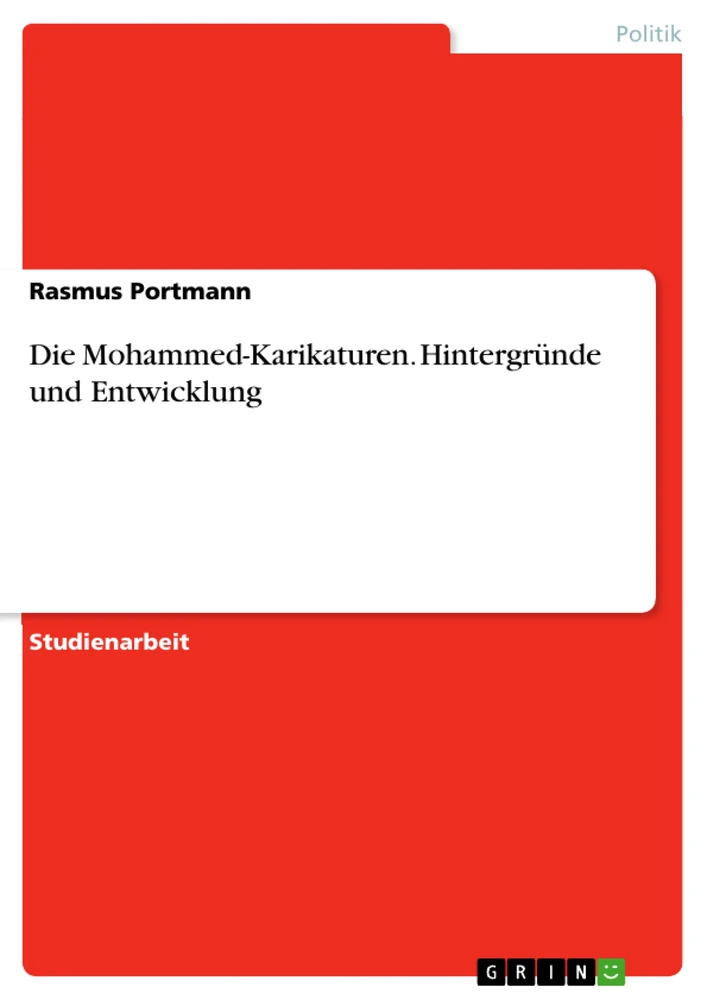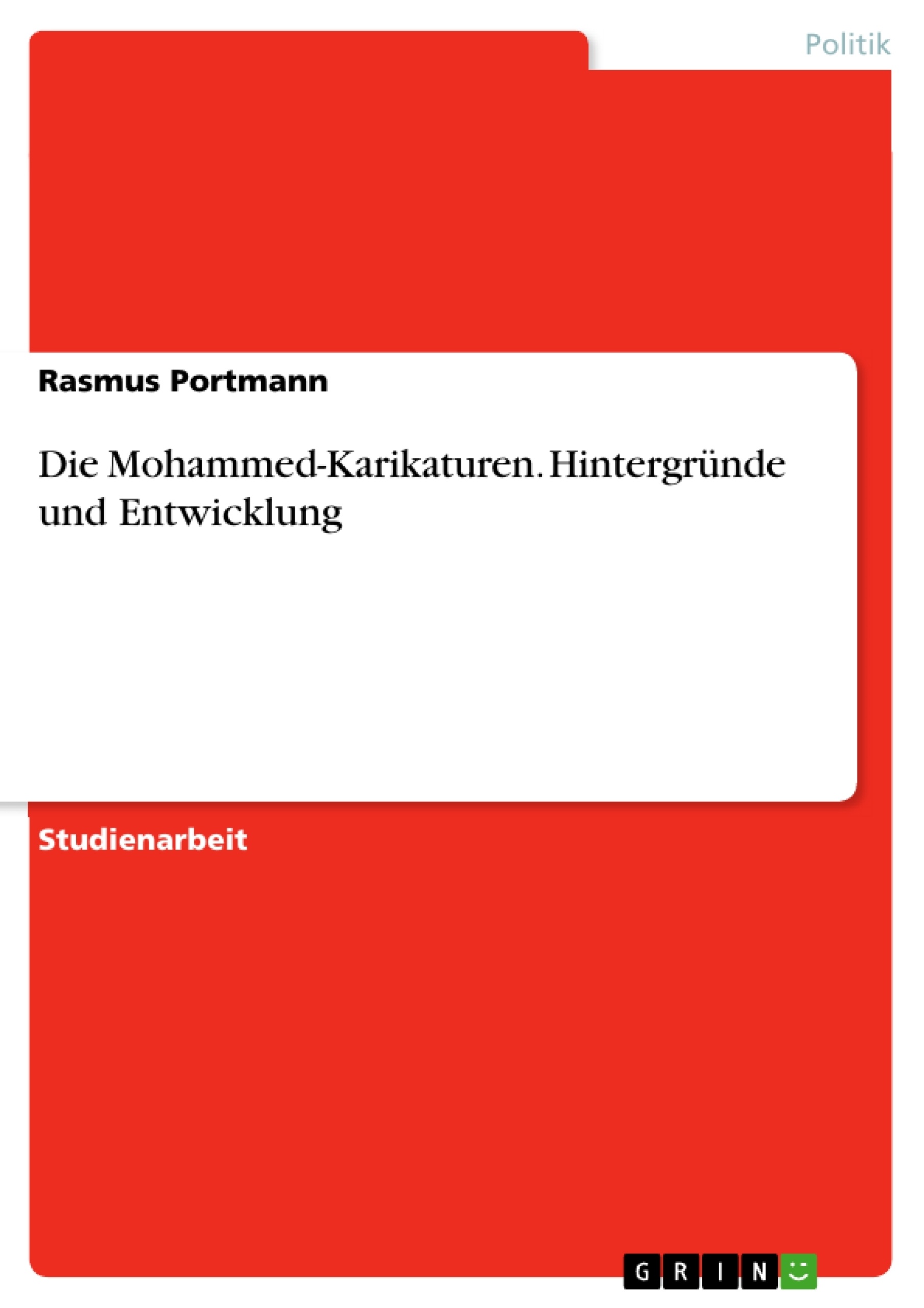Die folgende Seminararbeit soll das Thema der sog. „Mohammed-Karikaturen“ behandeln, die 2005 von der dänischen Tageszeitung „Jyllands-Posten“ veröffentlicht wurden. Sie soll versuchen zu erläutern warum diese Karikaturen es geschafft haben ein weltweites Politikum zu werden. Es sollen die Hintergründe und Folgen des Karikaturen-Streits für das Verhältnis des sog. Westen und dem Islam besprochen werden.
Im ersten Teil soll der chronologische Ablauf und die Entwicklung des Streits dokumentiert werden. Im zweiten Teil soll auf den religiösen Aspekt eingegangen werden, genauer das Bilderverbot im Islam um danach zu zeigen wie und von wem dieser Karikaturenstreit nach und nach instrumentalisiert wurde. Die beiden letzten Abschnitte sollen einen kritischen Blick auf die mediale Berichterstattung in Deutschland werfen um danach die Bedeutung der sog. Stereotype und die daraus resultierende Unfähigkeit einer sachlichen, differenzierten Beurteilung des Islams aus Sicht von Nicht-Muslimen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hintergründe und Chronologie des Karikaturenstreits
- 3. Bilderverbot im Islam
- 4. Instrumentalisierung der Karikaturen
- 4.1. Instrumentalisierung durch islamischen Vertreter
- 4.2. Instrumentalisierung durch westliche Vertreter
- 5. Islambild der deutschen Presse im Karikaturenstreit
- 5.1. Der Karikaturenstreit in den deutschen Printmedien
- 5.2. Zusammenfassung
- 6. Bedeutung der Stereotypen im Karikaturenstreit
- 6.1. Einfluss des Islam auf Europa
- 6.2. Entwicklung der Stereotype
- 6.3. Die „Türkengefahr“ (15. bis 17. Jahrhundert)
- 6.4. Islambild zur Zeit der Aufklärung
- 6.5. Islambild im Imperialismus und Orientalismus
- 7. Stereotypen in Bezug auf den Karikaturenstreit
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert den Konflikt um die Mohammed-Karikaturen von 2005, die von der dänischen Zeitung „Jyllands-Posten“ veröffentlicht wurden. Ziel ist es, die Hintergründe des weltweiten Politikums zu beleuchten und die Folgen für das Verhältnis zwischen dem Westen und dem Islam zu untersuchen. Die Arbeit dokumentiert den chronologischen Ablauf und analysiert die Instrumentalisierung des Konflikts.
- Chronologie und Entwicklung des Karikaturenstreits
- Das Bilderverbot im Islam und seine historische Entwicklung
- Instrumentalisierung des Konflikts durch islamische und westliche Akteure
- Die Darstellung des Islams in der deutschen Presse
- Die Rolle von Stereotypen und deren Einfluss auf die Wahrnehmung des Islams
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Mohammed-Karikaturen ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie benennt die zentrale Forschungsfrage nach den Gründen für die weltweite politische Relevanz der Karikaturen und kündigt die Analyse der Hintergründe und Folgen des Konflikts an. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis zwischen dem Westen und dem Islam. Die Arbeit gliedert sich in die chronologische Darstellung des Konflikts, die Auseinandersetzung mit dem Bilderverbot im Islam und die Analyse der Instrumentalisierung des Streits sowie eine kritische Betrachtung der medialen Berichterstattung und der Rolle von Stereotypen.
2. Hintergründe und Chronologie des Karikaturenstreits: Dieses Kapitel beschreibt den Ursprung des Streits mit der Veröffentlichung der Karikaturen in der „Jyllands-Posten“. Es schildert die anfängliche schwache Reaktion, die nachfolgenden Proteste islamischer Organisationen und die Reaktion der dänischen Regierung. Besonders wichtig ist die Darstellung der Eskalation des Konflikts durch die Verbreitung weiterer, teilweise deutlich provokanterer Bilder, deren Herkunft ungeklärt blieb. Die Darstellung dieser Ereignisse verdeutlicht die schrittweise Radikalisierung des Konflikts und seine internationalen Auswirkungen mit gewalttätigen Protesten und Anschlägen.
3. Bilderverbot im Islam: Dieses Kapitel widerlegt die weitverbreitete Annahme eines absoluten Bilderverbots im Islam. Es erläutert, dass ein striktes Verbot primär für die Darstellung Gottes gilt und dass sich die Haltung gegenüber der Abbildung von Menschen und Tieren historisch entwickelt hat. Die Arbeit verweist auf die Sure 59:25 und 64:4 des Korans als Grundlage für das Verbot der Darstellung Gottes und schildert die Lockerung des Verbots ab dem 13. Jahrhundert. Der Einfluss des mongolischen Reiches und die Entwicklung von Bildnissen von Mohammed, teils mit, teils ohne Gesicht, werden beleuchtet. Das Kapitel relativiert also das häufig zitierte Argument des Bilderverbots im Kontext der Karikaturen.
Schlüsselwörter
Mohammed-Karikaturen, Jyllands-Posten, Bilderverbot, Islam, Westen, Karikaturenstreit, Instrumentalisierung, Medien, Stereotype, Islambild, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Proteste, Anschläge, Selbstzensur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Der Karikaturenstreit 2005
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert den Konflikt um die Mohammed-Karikaturen, die 2005 von der dänischen Zeitung „Jyllands-Posten“ veröffentlicht wurden. Sie untersucht die Hintergründe des weltweiten politischen Aufruhrs und die Folgen für das Verhältnis zwischen dem Westen und dem Islam.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Chronologie des Konflikts, die Instrumentalisierung durch islamische und westliche Akteure, die Darstellung des Islams in der deutschen Presse, die Rolle von Stereotypen und das Bilderverbot im Islam. Sie beleuchtet auch die historische Entwicklung des Islambildes in Europa.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zur Chronologie des Karikaturenstreits, dem Bilderverbot im Islam, der Instrumentalisierung des Konflikts, der Darstellung des Islams in der deutschen Presse und der Rolle von Stereotypen. Sie endet mit einem Fazit.
Welche Rolle spielt das Bilderverbot im Islam?
Die Arbeit widerlegt die Annahme eines absoluten Bilderverbots im Islam. Sie erklärt, dass das Verbot primär für die Darstellung Gottes gilt und die Haltung gegenüber der Abbildung von Menschen und Tieren sich historisch entwickelt hat. Der Einfluss des mongolischen Reiches und die Entwicklung von Bildnissen Mohammeds werden beleuchtet.
Wie wurde der Konflikt instrumentalisiert?
Die Arbeit analysiert die Instrumentalisierung des Konflikts sowohl durch islamische als auch westliche Akteure. Sie untersucht, wie der Streit für politische Zwecke genutzt wurde und wie dies zur Eskalation beitrug.
Welche Rolle spielen Stereotype?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Stereotypen und deren Einfluss auf die Wahrnehmung des Islams. Sie betrachtet die historische Entwicklung von Stereotypen in Bezug auf den Islam und deren Bedeutung im Kontext des Karikaturenstreits.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die genaue Quellenangabe ist in der vollständigen Seminararbeit aufgeführt und wird hier nicht im Detail wiedergegeben. Die Arbeit stützt sich auf eine gründliche Recherche zu den Ereignissen um die Mohammedkarikaturen und deren mediale Rezeption.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit der Seminararbeit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen aus der Analyse des Karikaturenstreits. Dies betrifft die Komplexität des Konflikts, die Rolle der Medien und die Bedeutung von kulturellen Unterschieden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mohammed-Karikaturen, Jyllands-Posten, Bilderverbot, Islam, Westen, Karikaturenstreit, Instrumentalisierung, Medien, Stereotype, Islambild, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Proteste, Anschläge, Selbstzensur.
Wo finde ich die vollständige Seminararbeit?
Die vollständige Seminararbeit ist auf Anfrage beim Verlag erhältlich (genaue Kontaktdaten müssten hier ergänzt werden).
- Quote paper
- Rasmus Portmann (Author), 2014, Die Mohammed-Karikaturen. Hintergründe und Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339497