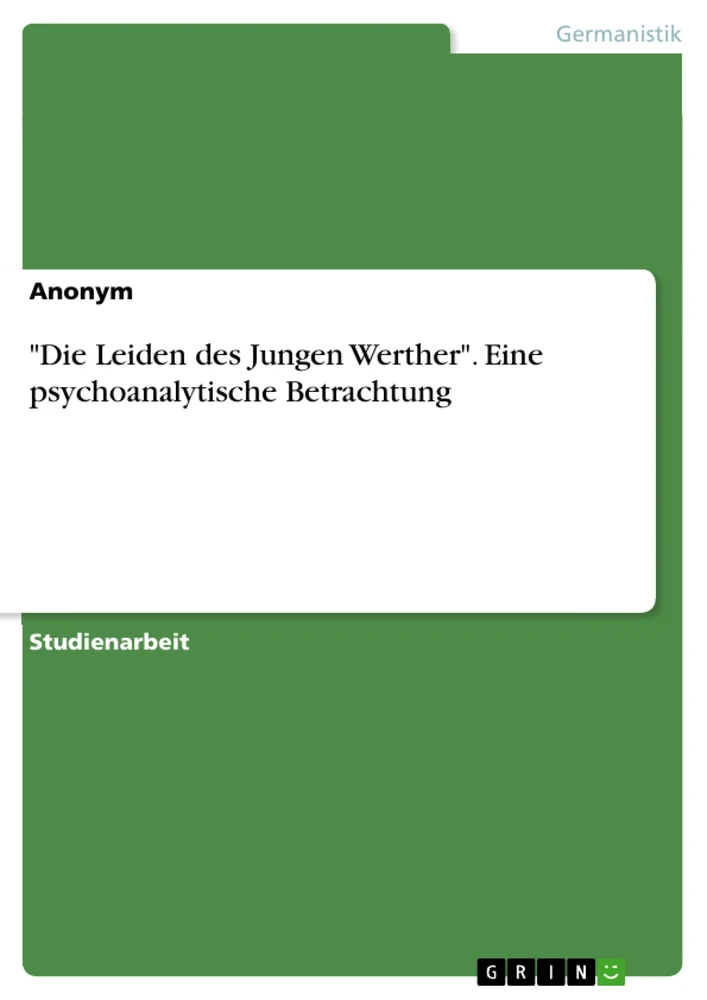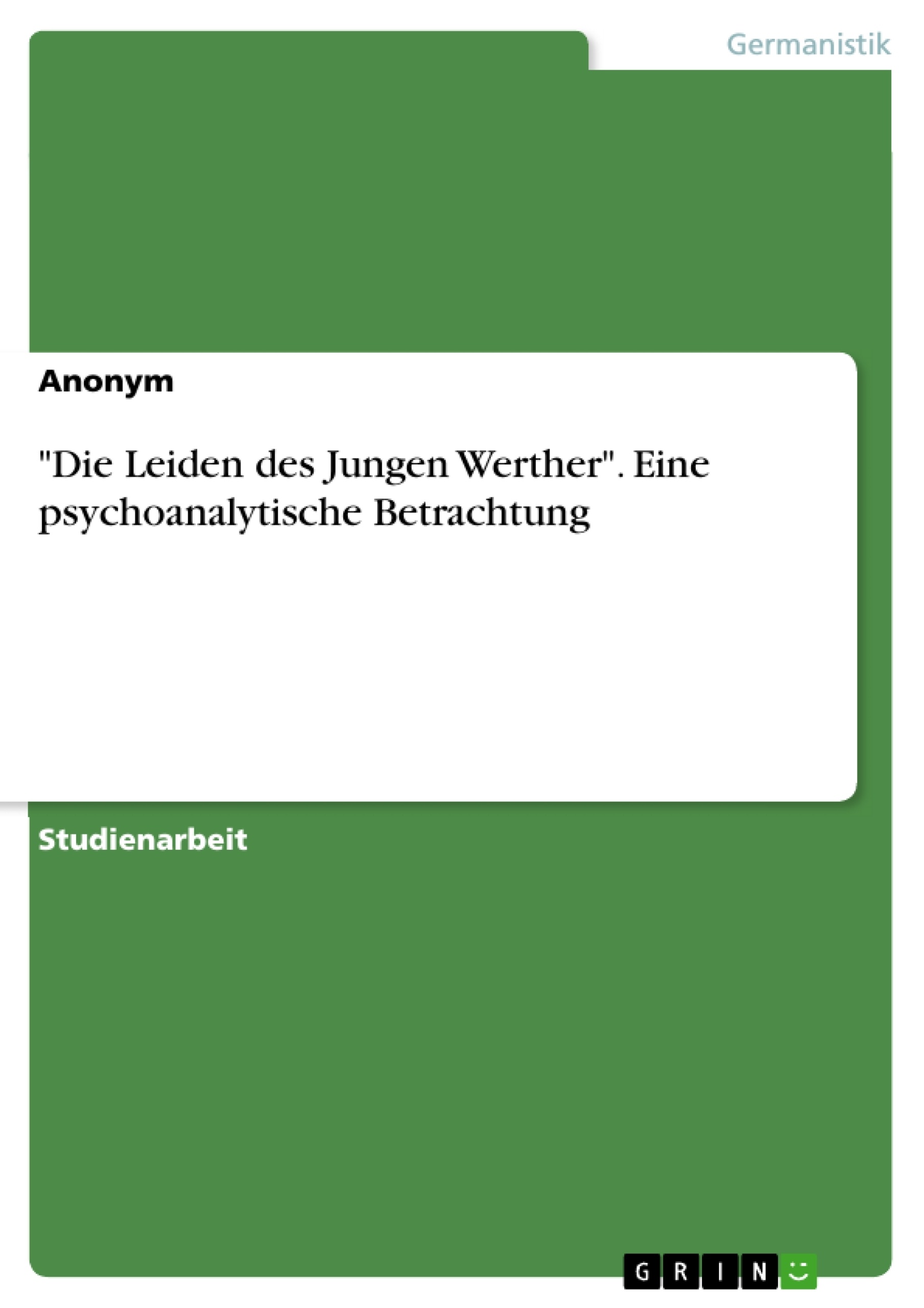Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Roman „Die Leiden des jungen Werther“ von Johann Wolfgang von Goethe. In der Literaturwissenschaft ist es üblich, den „Werther“ als einen Liebesroman zu klassifizieren. Zugleich wird postuliert, dieser Briefroman sei ein Werk, das die Grundkonflikte eines Menschen zeige, der sich in der Epoche der Aufklärung an die vorherrschenden Verhaltensmuster und Normen nicht gewöhnen könne. Dieser Mensch heißt Werther und er wird vom fiktiven Herausgeber bereits im Vorwort eingeführt. Werther beharrt einerseits auf seinem Recht der Entfaltung seiner Persönlichkeit und der Verwirklichung seiner Liebe; andererseits muss er erfahren, dass ihm die Gesellschaft dieses Recht verweigert.
Dieser Grundkonflikt der Werther Gestalt, aus dem dann sich der Liebeskonflikt entwickelt, hat mich zu der Entscheidung kommen lassen, mich der Figur des Werther mit psychoanalytischen Methoden anzunähern. Mein Ziel ist es dabei, eine Antwort auf folgende Fragen zu finden: „Woran leidet Werther?“ und „Warum ist er in einem Konflikt?“ Eine mögliche Antwort ist, dass Werther an der Gesellschaft, an seinen persönlichen Konflikten und Gefühlen leidet. Um meine Hypothese zu überprüfen, werde ich die Arbeit von Elisabeth AUER (1999) „Selbstmord begehen zu wollen ist wie ein Gedicht zu schreiben. Eine psychoanalytische Studie zu Goethes Briefroman 'Die Leiden des jungen Werther'“ und den Aufsatz von Ernst FEISE „Goethes Werther als nervöser Charakter“ zugrunde legen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Die Leiden des jungen Werther“ in der Literaturgeschichte
- Form und Erzähltechnik des Romans
- Zum Inhalt des Romans
- Der fiktive Herausgeber
- Die Funktionen der Parallelepisoden
- Werthers Depression und sein Tod
- Eine Charakterisierung Werthers
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werther“ aus einer psychoanalytischen Perspektive. Der Fokus liegt darauf, die Ursachen für Werthers Leiden und seine Konflikte zu verstehen. Die Arbeit untersucht die Figur des Werther anhand der psychoanalytischen Ansätze von Elisabeth Auer und Ernst Feise.
- Die Einordnung des Romans in die Literaturgeschichte
- Form und Erzähltechnik des Briefromans
- Die Rolle des fiktiven Herausgebers und die Bedeutung der Parallelepisoden
- Werthers Depression und sein Selbstmord
- Die Charakterisierung von Werther als eine Figur, die sich in Konflikt mit den Normen der Aufklärung befindet
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage, woran Werther leidet und warum er in einem Konflikt steht. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, diese Fragen mithilfe psychoanalytischer Methoden zu beantworten. Die Arbeit bezieht sich auf die Studien von Elisabeth Auer und Ernst Feise, um Werthers Selbstmord und seine Depression zu analysieren.
„Die Leiden des jungen Werther“ in der Literaturgeschichte
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Romans „Die Leiden des jungen Werther“ im Kontext der deutschen Literaturgeschichte. Es wird erläutert, dass der Roman als moderne Form des Romans in Deutschland gilt, die eine subjektive Konfession in Briefform darstellt. Der Text analysiert die Bedeutung des Romans für die Epoche der Aufklärung, in der die Befreiung des Individuums von höfischen und klerikalen Zwängen eine zentrale Rolle spielte. Der „Werther“ spiegelt die Schwierigkeiten des bürgerlichen Individuums wider, sich in die ständisch gegliederte Gesellschaft zu integrieren.
Form und Erzähltechnik des Romans
Das Kapitel befasst sich mit der monologischen Form des Briefromans und seiner Nähe zum fiktiven Tagebuch. Es wird die Bedeutung dieser Form für die psychoanalytische Auseinandersetzung mit Werthers inneren und äußeren Konflikten beleuchtet. Der schwedische Literaturwissenschaftler Staffan Björck argumentiert, dass Goethe mit dem „Werther“ versucht, innere und äußere Konflikte zu analysieren und zu verarbeiten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind „Die Leiden des jungen Werther“, „Johann Wolfgang von Goethe“, „Briefroman“, „Psychoanalyse“, „Selbstmord“, „Aufklärung“, „Individuum“, „Gesellschaft“, „Liebeskonflikt“, „Depression“, „Elisabeth Auer“, „Ernst Feise“, „Parallelepisoden“, „Form“, „Erzähltechnik“ und „Charakterisierung“.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2008, "Die Leiden des Jungen Werther". Eine psychoanalytische Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339435