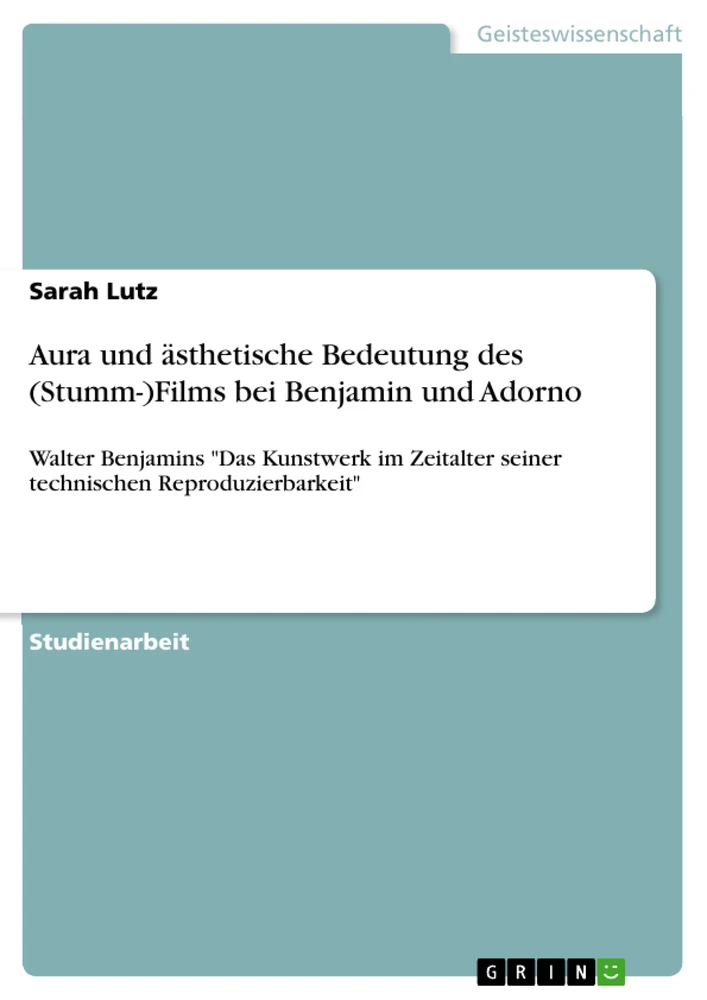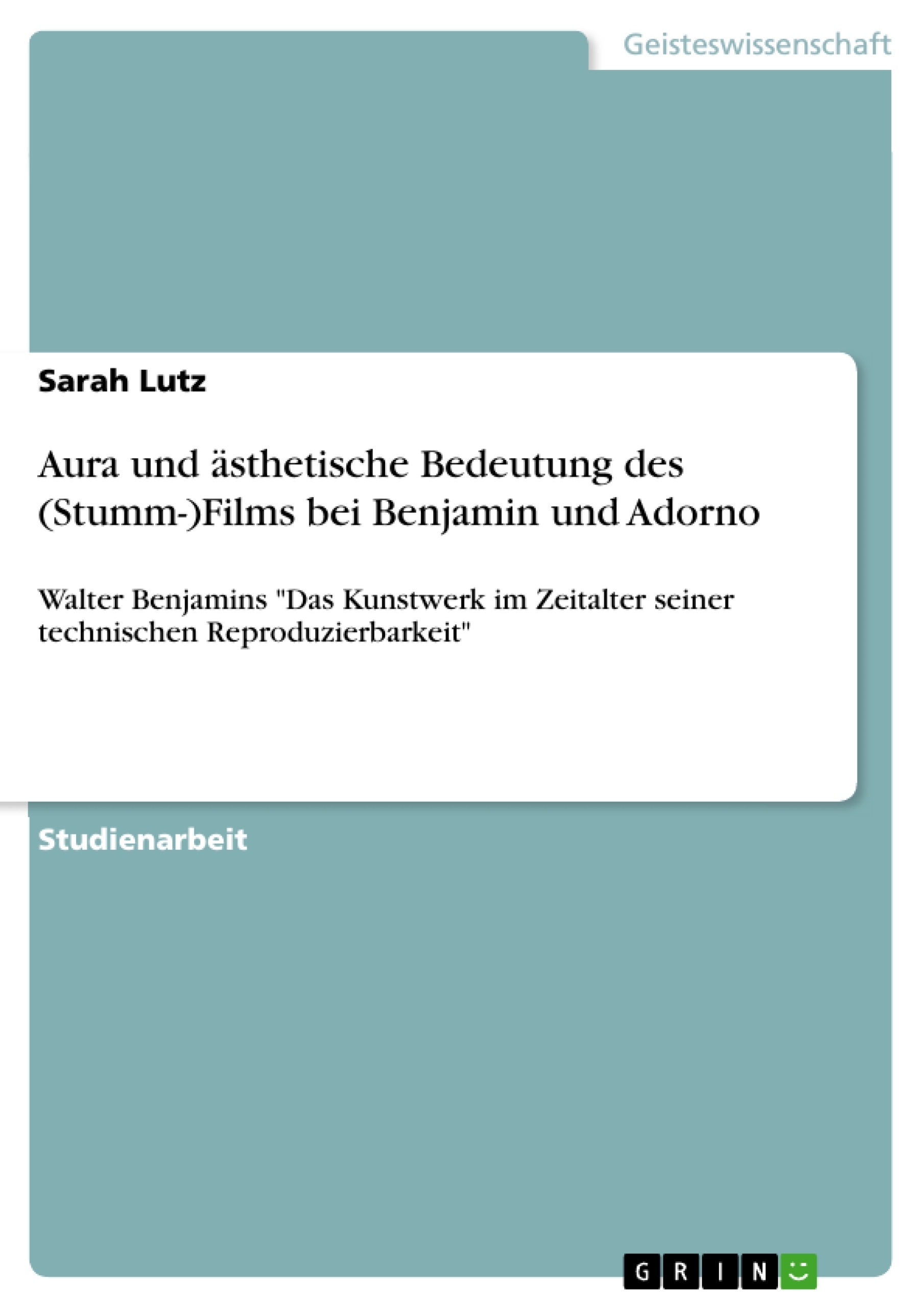Walter Benjamins Schrift "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" – oder auch kurz "Kunstwerkaufsatz" – entstand 1935 im Pariser Exil, wo sich Benjamin als Jude auf der Flucht vor den Nationalsozialisten aufhielt. Der relativ kurze Text gilt heute als Grundlagentext für Kunst-, Kultur- und Medientheorien. Er dient in folgender Arbeit als Ausgangs- und Bezugswerk.
Nach einem kurzen Überblick über Quellen und Methoden, die in dieser Arbeit angewandt wurden, widmet sich der Aufsatz zunächst vertieft der "Kunstwerkschrift", wobei die Inhalte knapp dargelegt und zusammengefasst werden. Darauffolgend sollen die zeitgenössischen Rezeptionen, allen voran diejenige von Benjamins Freund Theodor W. Adorno genauer untersucht werden. Ausgehend von dieser allgemeinem Analyse des Textes und dessen Aufnahme, wird in einem dritten, abschließenden Teil, das Beispiel Film herausgegriffen und einer tieferen Analyse unterworfen. Dabei sollen vor allem die von Benjamin selbst als bedeutend eingestuften Begriffe der Massenproduktion und der Rezeption von Kunst durch die Massen im Allgemeinen, sowie des Mediums Film im Besonderen, dargelegt werden und eine kritische Auseinandersetzung mit denselben erfolgen.
Benjamin verfasste seinen Grundlagentext ohne Publikationsvereinbarung durch seinen Verleger und ohne eine längere dem Text vorangestellte Planungsphase, in nur wenigen Wochen in den Herbstmonaten 1935. Er kann jedoch in eine Reihe Texte eingegliedert werden, die Benjamin entweder vor oder nach der Kunstwerkschrift verfasste. Dazu gehören Erfahrung und Armut (1933), Der Autor als Produzent (1934) und Erzähler (1936), aber auch das 1931 entstandene Essay über die Photographie, in welchem zum ersten Mal eine Definition der für Benjamin so wichtigen Aura geliefert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 1.1 METHODEN UND QUELLEN
- 2 WALTER BENJAMINS KUNSTWERK-SCHRIFT
- 2.1 DIE ADORNO-REZEPTION
- 2.2 WEITERE REZEPTIONEN
- 3 BENJAMIN UND DER FILM
- 3.1 MASSENPRODUKTION UND REZEPTION DURCH MASSEN
- 3.2 STUMM- UND TONFILM
- 3.3 ADORNO VS. BENJAMIN
- 4 CONCLUSIO
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss von Walter Benjamins Essay „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ auf die Filmästhetik. Sie beleuchtet Benjamins Gedanken zu Film, Ästhetik und Massenkultur und analysiert Theodor W. Adornos Reaktion auf den Essay. Die Arbeit zeigt Übereinstimmungen zwischen Benjamin und Adorno auf, trotz gegensätzlicher Positionen.
- Benjamins Konzept der Aura und ihre Veränderung durch technische Reproduzierbarkeit
- Die Rolle des Films in der Massenkultur und seine ästhetische Bedeutung
- Vergleichende Analyse der Positionen Benjamins und Adornos zum Film und zur Kunst
- Massenproduktion und Massenrezeption von Kunst
- Der Unterschied zwischen Stumm- und Tonfilm im Kontext von Benjamins Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext der Entstehung von Benjamins Essay „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ im Pariser Exil 1935. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit Benjamins Essay, dessen Rezeption, insbesondere durch Adorno, und einer detaillierten Analyse des Films auseinandersetzt. Der Essay wird als Grundlagentext für Kunst-, Kultur- und Medientheorien vorgestellt, und es wird die Bedeutung der Massenproduktion und der Massenrezeption von Kunst hervorgehoben.
1.1 Methoden und Quellen: Dieser Abschnitt beschreibt die methodische Vorgehensweise und die verwendeten Quellen der Arbeit. Die Primärquelle ist die 1963 von Suhrkamp veröffentlichte Fassung von Benjamins Essay. Die methodische Herangehensweise ist gegenstandsbezogen, wobei der Film und das Radio zentrale Bedeutung haben. Benjamins kritische Auseinandersetzung mit dem Kunstanspruch des Films und die Herausarbeitung filmspezifischer Eigenschaften werden betont.
2 Walter Benjamins Kunstwerk-Schrift: Dieses Kapitel bietet eine Zusammenfassung von Benjamins Essay "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit". Es beleuchtet die zentralen Thesen des Textes und bereitet den Boden für die anschließende Analyse der Rezeption, insbesondere durch Adorno. Die Entstehung des Essays unter schwierigen Umständen im Exil und seine spätere, immense Bedeutung für die Kunst- und Medientheorie werden hervorgehoben.
2.1 Die Adorno-Rezeption: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf Adornos Reaktion auf Benjamins Essay. Er analysiert die Kritikpunkte Adornos, aber auch mögliche Übereinstimmungen, die trotz unterschiedlicher Perspektiven bestehen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis beider Denker bezüglich der Auswirkungen der technischen Reproduzierbarkeit auf Kunst und Gesellschaft.
2.2 Weitere Rezeptionen: Dieser Teil gibt einen Überblick über die Rezeption von Benjamins Essay jenseits von Adornos Kritik. Er skizziert die breite und anhaltende Wirkung des Textes auf die Kunst- und Medientheorie und beleuchtet seine Bedeutung für verschiedene Diskurse und Generationen. Die Bedeutung der 1963 erschienenen Einzelpublikation und der Rezeption durch die 1968er Generation werden angesprochen.
3 Benjamin und der Film: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit Benjamins Analyse des Films. Es untersucht die Konzepte der Massenproduktion und der Massenrezeption im Kontext des filmischen Mediums. Der Unterschied zwischen Stumm- und Tonfilm wird im Lichte von Benjamins Theorie diskutiert, und es erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit den von Benjamin herausgearbeiteten Aspekten. Die spezifischen Eigenschaften des Films im Vergleich zu anderen Medien wie Fotografie, Malerei und Theater werden analysiert.
3.1 Massenproduktion und Rezeption durch Massen: Dieser Abschnitt untersucht detailliert Benjamins Verständnis von Massenproduktion und Massenrezeption von Filmen und Kunst im Allgemeinen. Es wird analysiert, wie die technische Reproduzierbarkeit die Aura des Kunstwerks verändert und wie dies die Rezeption beeinflusst.
3.2 Stumm- und Tonfilm: Hier wird der Unterschied zwischen Stumm- und Tonfilm im Kontext von Benjamins Theorie untersucht. Die spezifischen Auswirkungen des Tons auf die Aura und die Rezeption des Films werden analysiert und in Bezug zu anderen Aspekten von Benjamins Argumentation gesetzt.
3.3 Adorno vs. Benjamin: Dieser Abschnitt vergleicht die Positionen von Adorno und Benjamin zum Film. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansätzen und Schlussfolgerungen werden herausgestellt und analysiert. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit den jeweiligen Kritikpunkten und der Erörterung der unterschiedlichen Perspektiven auf die Bedeutung des Films in der Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Aura, technische Reproduzierbarkeit, Massenproduktion, Massenrezeption, Film, Stummfilm, Tonfilm, Theodor W. Adorno, Ästhetik, Medientheorie, Kunsttheorie, Kulturtheorie.
Häufig gestellte Fragen zu: Walter Benjamins "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" - Seminararbeit
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Einfluss von Walter Benjamins Essay "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" auf die Filmästhetik. Sie beleuchtet Benjamins Gedanken zu Film, Ästhetik und Massenkultur und analysiert Theodor W. Adornos Reaktion auf den Essay. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der Positionen Benjamins und Adornos, trotz ihrer gegensätzlichen Standpunkte.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Benjamins Konzept der Aura und deren Veränderung durch technische Reproduzierbarkeit, die Rolle des Films in der Massenkultur, eine vergleichende Analyse der Positionen Benjamins und Adornos zum Film und zur Kunst, Massenproduktion und Massenrezeption von Kunst sowie den Unterschied zwischen Stumm- und Tonfilm im Kontext von Benjamins Theorie.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Benjamins Essay und dessen Rezeption (inkl. Adornos Reaktion und weiterer Rezeptionen), und ein Kapitel zu Benjamin und dem Film (inkl. Massenproduktion/Rezeption, Stumm- und Tonfilm sowie einem Vergleich Adorno vs. Benjamin). Abschließend gibt es eine Conclusio.
Wie wird die methodische Vorgehensweise beschrieben?
Der Abschnitt "Methoden und Quellen" beschreibt die methodische Vorgehensweise und die verwendeten Quellen. Die Primärquelle ist die 1963 von Suhrkamp veröffentlichte Fassung von Benjamins Essay. Die methodische Herangehensweise ist gegenstandsbezogen, wobei der Film und das Radio zentrale Bedeutung haben. Die kritische Auseinandersetzung mit dem Kunstanspruch des Films und die Herausarbeitung filmspezifischer Eigenschaften werden betont.
Welche Rolle spielt Theodor W. Adorno in der Seminararbeit?
Adornos Reaktion auf Benjamins Essay ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit. Die Seminararbeit analysiert Adornos Kritik an Benjamin, aber auch mögliche Übereinstimmungen zwischen beiden Denkern bezüglich der Auswirkungen der technischen Reproduzierbarkeit auf Kunst und Gesellschaft.
Wie wird der Film in der Seminararbeit analysiert?
Das Kapitel "Benjamin und der Film" analysiert Benjamins Perspektive auf den Film eingehend. Es untersucht die Konzepte der Massenproduktion und der Massenrezeption im filmischen Kontext, den Unterschied zwischen Stumm- und Tonfilm im Lichte von Benjamins Theorie und vergleicht die Positionen Benjamins und Adornos zum Film.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Aura, technische Reproduzierbarkeit, Massenproduktion, Massenrezeption, Film, Stummfilm, Tonfilm, Theodor W. Adorno, Ästhetik, Medientheorie, Kunsttheorie, Kulturtheorie.
Wo findet man die Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Zusammenfassung der Kapitel findet sich im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel". Dieser Abschnitt bietet für jedes Kapitel eine kurze Inhaltsbeschreibung.
Was ist die Zielsetzung der Seminararbeit?
Die Zielsetzung der Seminararbeit besteht darin, den Einfluss von Walter Benjamins Essay auf die Filmästhetik zu untersuchen und die Positionen Benjamins und Adornos zu diesem Thema zu vergleichen und zu analysieren.
- Quote paper
- Sarah Lutz (Author), 2015, Aura und ästhetische Bedeutung des (Stumm-)Films bei Benjamin und Adorno, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339381