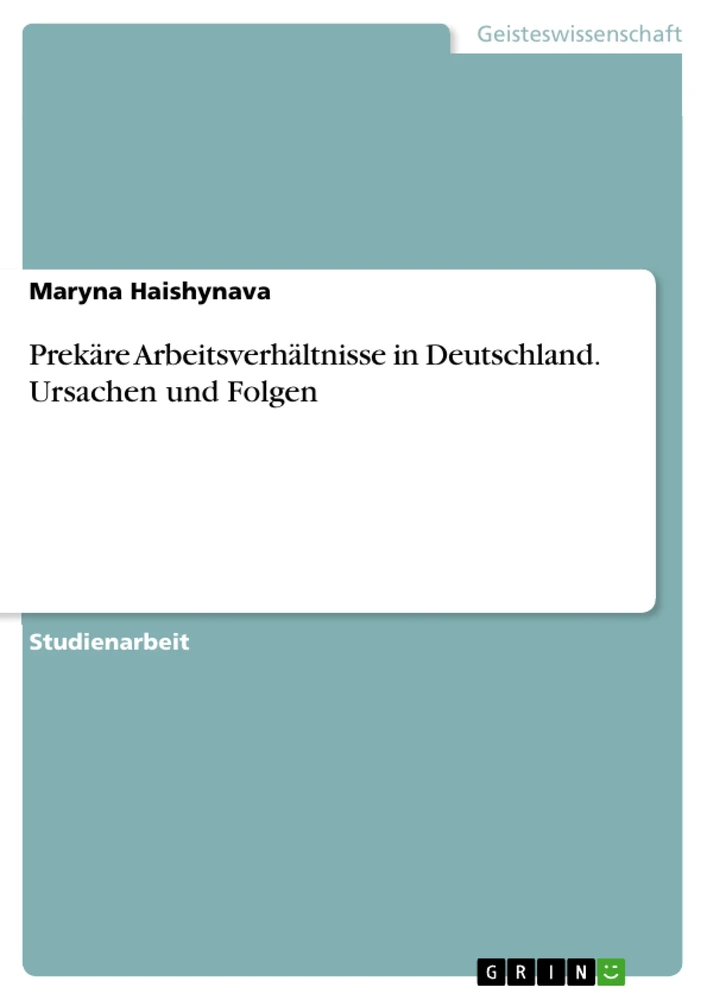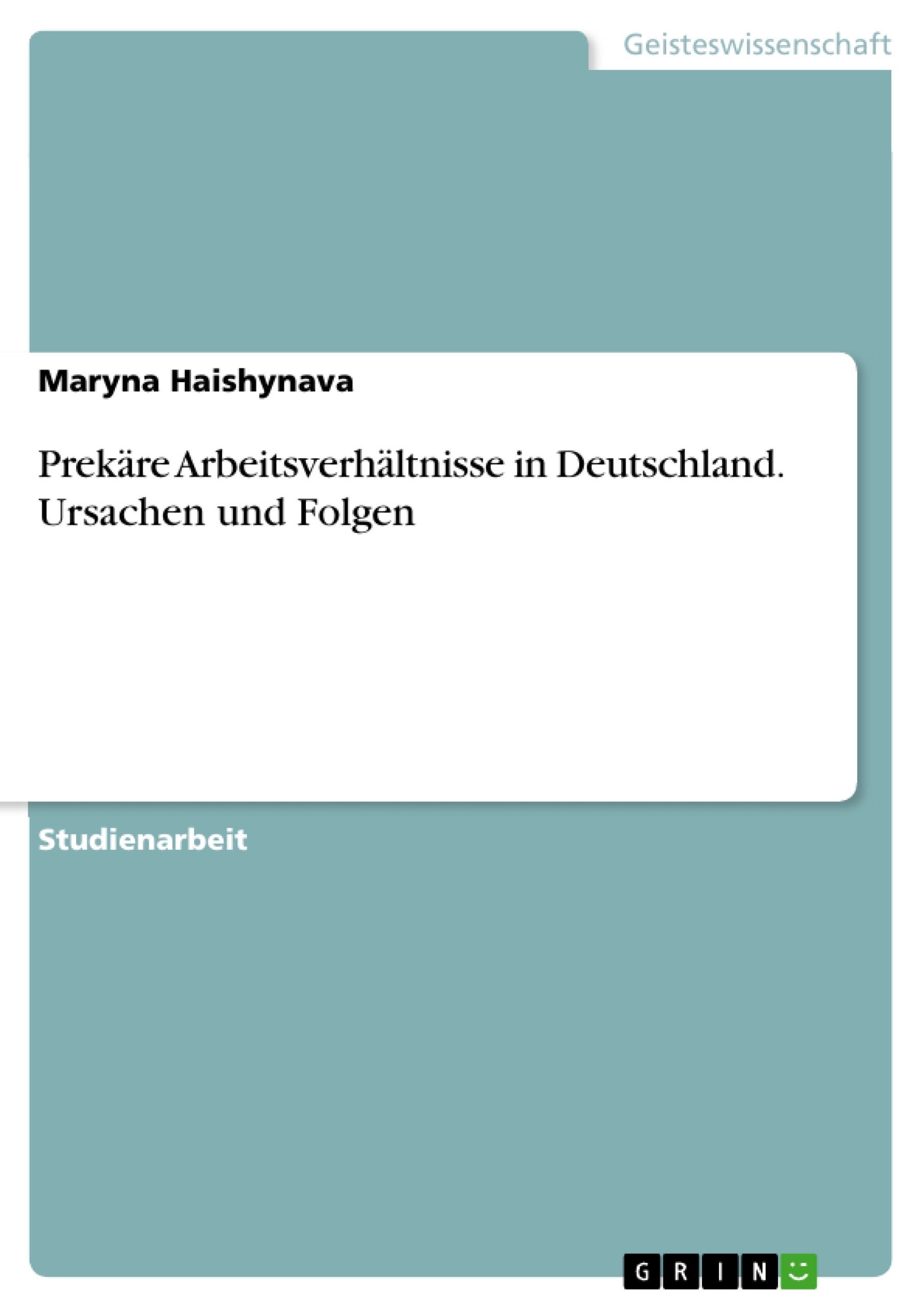Die Zahl der „Normalarbeitsplätze“ in der deutschen Wirtschaft sinkt. Ein Normalarbeitsplatz in diesem Sinne ist eine unbefristete, sozialversicherte Vollzeitbeschäftigung. Zwar entstehen derzeit auch wieder Normalarbeitsplätze, dennoch nehmen längerfristig gesehen die atypischen Formen von Arbeit eher zu und die Zahl sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung ab.
Die Definition von prekären Beschäftigungsverhältnissen ist schwierig. Nicht jede atypische Beschäftigung, wie zum Beispiel Teilzeitarbeit, ist auch prekär. Prekär ist Erwerbsarbeit in der Regel dann, wenn der Lohn deutlich unter dem Durchschnittseinkommen liegt, keine zuverlässige Zukunftsplanung für den einzelnen möglich ist und Arbeitnehmerschutzrechte reduziert sind. Prekär sind die Jobs vor allem deswegen, weil sich die Risiken des Arbeitsmarktes hier besonders konzentrieren. Viele Jobs sind unsicher und/oder niedrig bezahlt; die Chance, erneut arbeitslos zu werden, ist besonders groß, Phasen der Beschäftigung und Nichtbeschäftigung wechseln einander ab.
Die Ursachen für das Zurückdrängen des Normalarbeitsverhältnisses und die Zunahme prekärer Beschäftigungsformen sind vielfältig. Globalisierungsprozesse und die Internationalisierung der Märkte erzeugen einen hohen Konkurrenzdruck für Wirtschaft und Betriebe. Sie müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Die Lohnkosten spielen hierbei eine wichtige Rolle. Von Arbeitgeberseite werden deshalb prekäre Beschäftigungsverhältnisse oftmals auch als Brücke hin zu gesicherten Arbeitsplätzen verstanden. Welche Formen prekären Arbeitsverhältnissen gibt es? Welche Folgen und Ursachen haben prekäre Jobs? Und was bedeutetes überhaupt, sich in einer prekären Lage zu befinden?
Um diese Fragen beantworten zu können, ist es zuerst zweckdienlich, den Begriff zu definieren. Also, im ersten Abschnitt meiner Arbeit stellt sich die Frage nach der Definition des Begriffes „Prekarität“. Im weiteren Abschnitten beschäftige ich mich mit den Formen prekärer Arbeitsverhältnissen. Hierzu soll auf die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Definition des Begriffes „Prekarität“
- 2. Prekäre Beschäftigungsformen
- 2.1 Unterbeschäftigung und sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit
- 2.1.1 Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung
- 2.2 Befristete Beschäftigung
- 2.2.1 Aktuelle Entwicklung
- 2.3 Geringfügige Beschäftigung - Mini-Jobs
- 2.3.1 Aktuelle Entwicklung
- 2.4 Leiharbeit - Arbeitnehmerüberlastung
- 2.4.1 Aktuelle Entwicklung
- 3. Warum steigen prekäre Beschäftigungen immer an?
- 4. Soziale Folgen unsicherer Beschäftigungsverhältnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die wachsende Bedeutung prekärer Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland und untersucht die Ursachen und Folgen dieser Entwicklung. Sie befasst sich mit der Definition von Prekarität, beschreibt verschiedene Formen prekärer Beschäftigung und deren aktuelle Entwicklung, untersucht die Gründe für den Anstieg prekärer Jobs und beleuchtet die sozialen Folgen unsicherer Arbeitsverhältnisse.
- Definition von Prekarität und deren Bedeutung im Kontext der heutigen Arbeitswelt
- Analyse verschiedener Formen prekärer Beschäftigung, wie Teilzeitarbeit, Befristung, Geringfügige Beschäftigung und Leiharbeit
- Untersuchung der Ursachen für den Anstieg prekärer Beschäftigungsverhältnisse
- Beurteilung der sozialen Folgen unsicherer Arbeitsverhältnisse für die Betroffenen
- Diskussion der Herausforderungen, die prekäre Beschäftigung für die Gesellschaft darstellt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Definition des Begriffes „Prekarität“
Dieses Kapitel definiert den Begriff „Prekarität“ im soziologischen Kontext und erläutert, wie sich unsichere Arbeitsverhältnisse auf die Lebensverhältnisse von Menschen auswirken können. Es werden verschiedene Definitionen von Prekarität vorgestellt, die sich auf die Unsicherheit der Erwerbstätigkeit, das niedrige Einkommensniveau und den reduzierten Arbeitnehmerschutz konzentrieren.
2. Prekäre Beschäftigungsformen
In diesem Kapitel werden verschiedene Formen prekärer Beschäftigung im Detail vorgestellt, darunter die sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit, befristete Beschäftigung, geringfügige Beschäftigung (Mini-Jobs) und Leiharbeit. Das Kapitel beleuchtet die aktuelle Entwicklung dieser Beschäftigungsformen und zeigt auf, wie sie sich auf den Arbeitsmarkt auswirken.
3. Warum steigen prekäre Beschäftigungen immer an?
Dieses Kapitel untersucht die Ursachen für den Anstieg prekärer Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland. Es beleuchtet die Rolle von Globalisierungsprozessen, dem Konkurrenzdruck für Unternehmen und der Kostensenkung als treibende Faktoren. Das Kapitel diskutiert, wie Arbeitgeber prekäre Beschäftigung als Brücke zu gesicherten Arbeitsplätzen verstehen.
4. Soziale Folgen unsicherer Beschäftigungsverhältnisse
Dieses Kapitel widmet sich den sozialen Folgen prekärer Beschäftigung für die Betroffenen. Es analysiert die Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale Sicherung und die gesellschaftliche Teilhabe. Das Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen, die mit unsicheren Arbeitsverhältnissen verbunden sind.
Schlüsselwörter
Prekarität, prekäre Beschäftigung, atypische Beschäftigung, Teilzeitarbeit, Befristung, Geringfügige Beschäftigung, Mini-Jobs, Leiharbeit, Arbeitsmarkt, Globalisierung, Wettbewerbsdruck, Kostensenkung, soziale Folgen, Lebensqualität, soziale Sicherung, gesellschaftliche Teilhabe, Arbeitnehmerrechte.
- Quote paper
- Maryna Haishynava (Author), 2015, Prekäre Arbeitsverhältnisse in Deutschland. Ursachen und Folgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339363