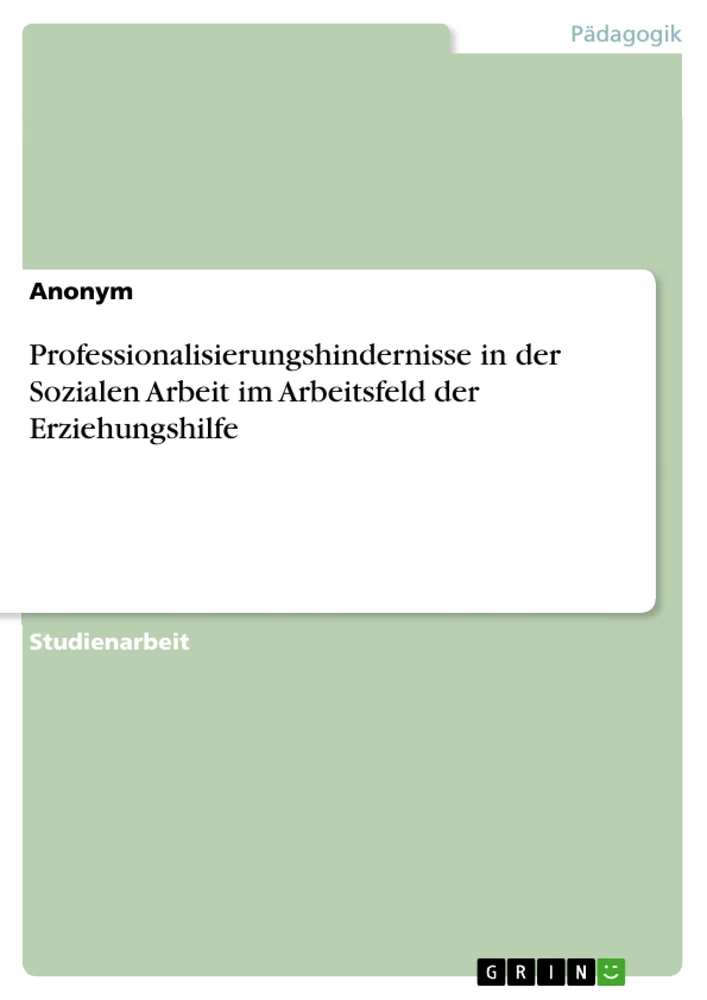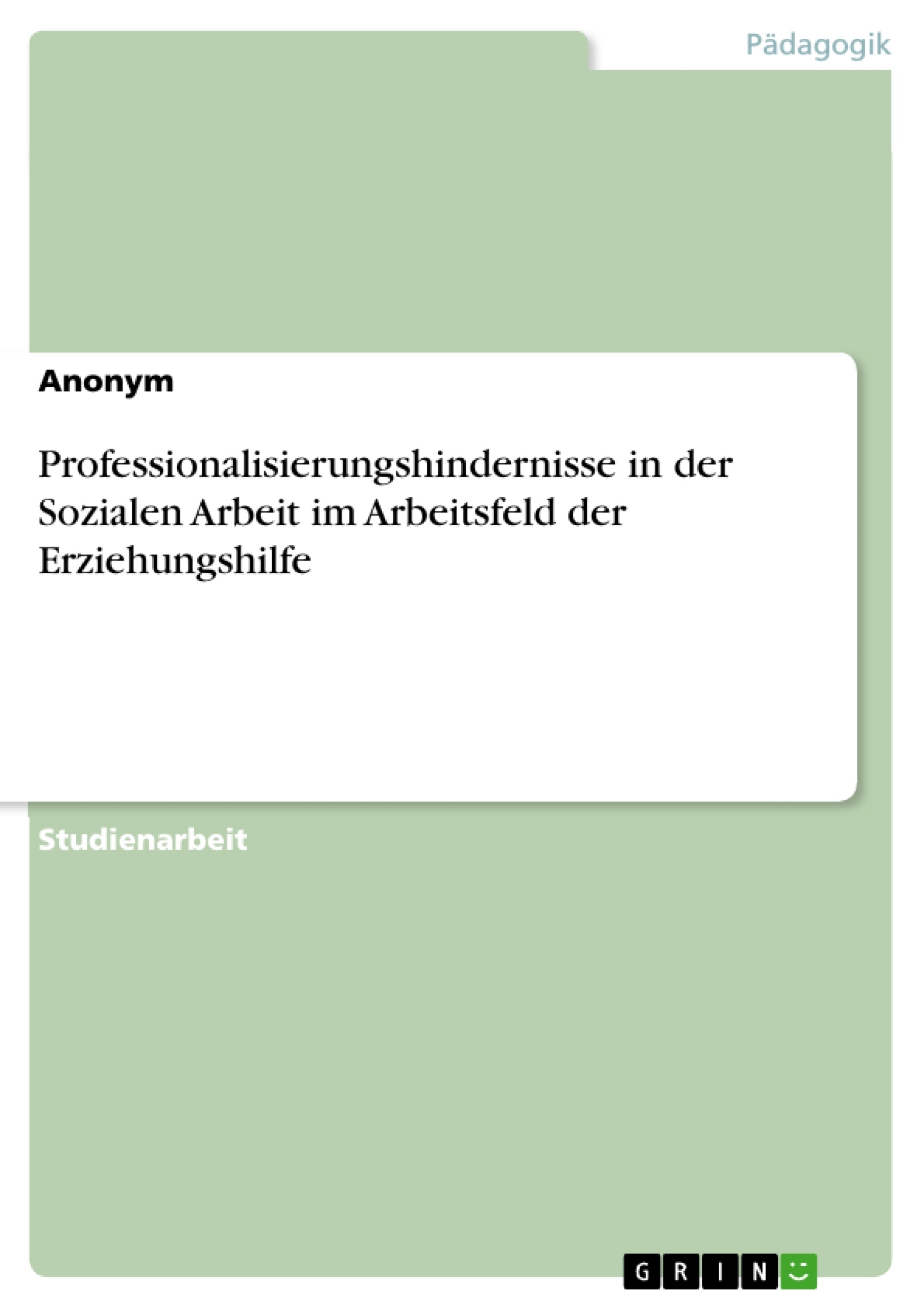Die Erziehung der Kinder galt über Jahrtausende als private Angelegenheit im Aufgabenbereich der Familie, die von der Elternschaft sowie den Vertrauens- und Bezugspersonen übernommen wurde und somit von staatlichen Interventionen getrennt war. Geändert hat sich das im 19.Jahrhundert mit der Entstehung von institutionellen Erziehungshilfen. Der Ausgangpunkt lag jedoch weniger im Interessensspektrum der Privatfamilien, sondern diente vielmehr dem staatlichen Gebrauch mit dem Ziel der Erhaltung einer funktionierenden Wirtschafts- sowie Wertegesellschaft.1 Für viele Menschen in der Gesellschaft ist allerdings bis heute unklar inwiefern die Erziehungshilfe als Hilfe akzeptiert werden kann oder nicht eher als Kontrolle in Privatangelegenheiten gemessen werden kann. Zudem tritt die Soziale Arbeit in vielen unterschiedlichen Arbeitsfeldern auf, so dass häufig die Frage im Zusammenhang von Expertisen gestellt wird.
Wie ist nun die Professionalität der Sozialen Arbeit zu verstehen, wenn doch früher viel eher der Rat der lebenserfahrenden klugen Großeltern eingeholt wurde? Aus dieser Betrachtungsweise kann annähernd nachvollzogen werden, warum die Professionalisierung in einer Erziehungshilfe stets als zentrales Thema in der Sozialen Arbeit bleibt. Welche Professionalisierungshindernisse bestehen oder entstehen können soll in dieser schriftlichen Ausarbeitung erörtert werden.
Es werden dafür zunächst die verschiedenen Theoriepositionen zur Professionalisierungsdebatte von Ulrich Oevermann und Bernd Dewe vorgestellt, um nachvollziehen zu können, wie Professionalität in der Sozialen Arbeit, bzw. Sozialpädagogik aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive different erfasst wird. Danach wird sich mit der Professionalität in der Erziehungshilfe befasst, die im eigentlichen Sinne die Professionalität in der Arbeitsbeziehung zwischen Adressaten und Sozialarbeiter meint. Hier bezieht man sich hauptsächlich auf das Modell „Arbeitsbündnis“ von Oevermann, das jedoch auch mit den Thesen von Annegrets Wigger ergänzt wird, wobei hier angemerkt wird, dass Wigger Bezug auf dessen Studien nimmt. Abschließend wird auf die möglichen Professionalisierungshindernisse der Erziehungshilfe nach Stefan Köngeter’s Thesen eingegangen. Diese gehen insbesondere auf die Ursachen ein, wie ein Arbeitsbündnis nach Oevermann verhindert werden kann bevor überhaupt eine aktive Zusammenarbeit entsteht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoriepositionen zur Professionalisierungsdebatte
- Oevermann's Theorie: die Soziale Arbeit - nicht professionalisierbar?
- Dewe's Theorie: Soziale Arbeit als Semi-Profession
- Professionalität in der Erziehungshilfe - Merkmale einer professionellen Beziehung im pädagogischen Handeln
- Professionalisierungshindernisse in der Erziehungshilfe
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Professionalisierungshindernisse in der Sozialen Arbeit im Arbeitsfeld der Erziehungshilfe. Sie analysiert die verschiedenen Theoriepositionen zur Professionalisierungsdebatte, insbesondere die Ansätze von Ulrich Oevermann und Bernd Dewe. Dabei wird die Frage beleuchtet, inwiefern die Soziale Arbeit als Profession betrachtet werden kann und welche Herausforderungen die Professionalisierung im Bereich der Erziehungshilfe mit sich bringt.
- Professionalisierung der Sozialen Arbeit im Kontext der Erziehungshilfe
- Theoriepositionen zur Professionalisierung von Ulrich Oevermann und Bernd Dewe
- Merkmale einer professionellen Beziehung in der Erziehungshilfe
- Professionalisierungshindernisse in der Erziehungshilfe
- Autonomie und Arbeitsbündnis in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Professionalisierungshindernisse in der Sozialen Arbeit im Bereich der Erziehungshilfe ein. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Erziehungshilfe und stellt die Frage nach ihrer Akzeptanz und Kontrolle in privaten Angelegenheiten.
Theoriepositionen zur Professionalisierungsdebatte
Dieses Kapitel stellt die verschiedenen Theorien zur Professionalisierungsdebatte vor, insbesondere die Ansätze von Ulrich Oevermann und Bernd Dewe. Oevermann's Theorie betrachtet die Soziale Arbeit als eine Form der „stellvertretenden Krisenbewältigung“, die aufgrund der individuellen Problemlagen von Klienten erforderlich ist. Dewe hingegen sieht die Soziale Arbeit als eine Semi-Profession, die durch bürokratische Strukturen und gesellschaftliche Normen eingeschränkt ist.
Professionalität in der Erziehungshilfe - Merkmale einer professionellen Beziehung im pädagogischen Handeln
Dieses Kapitel befasst sich mit den Merkmalen einer professionellen Beziehung im pädagogischen Handeln, insbesondere im Kontext des von Oevermann beschriebenen „Arbeitsbündnisses“. Es werden die Thesen von Annegret Wigger vorgestellt, die auf Oevermann's Modell aufbauen und die Bedeutung von Freiwilligkeit, Symmetrie und Asymmetrie in der Arbeitsbeziehung zwischen Sozialarbeiter und Klienten hervorheben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Professionalisierung der Sozialen Arbeit, insbesondere im Bereich der Erziehungshilfe. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Professionalisierungshindernisse, Theoriepositionen, Arbeitsbündnis, Autonomie, Semi-Profession, Erziehungshilfe, pädagogisches Handeln, Professionalität, Klienten, Sozialarbeiter, und Arbeitsbeziehung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Professionalisierungshindernisse in der Sozialen Arbeit im Arbeitsfeld der Erziehungshilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339264