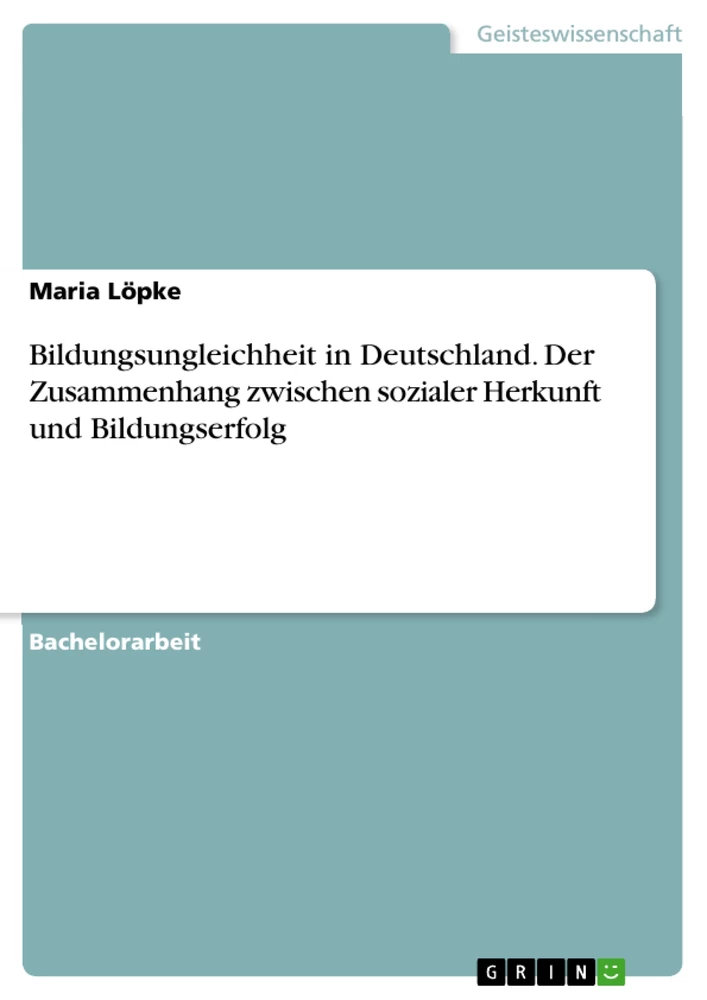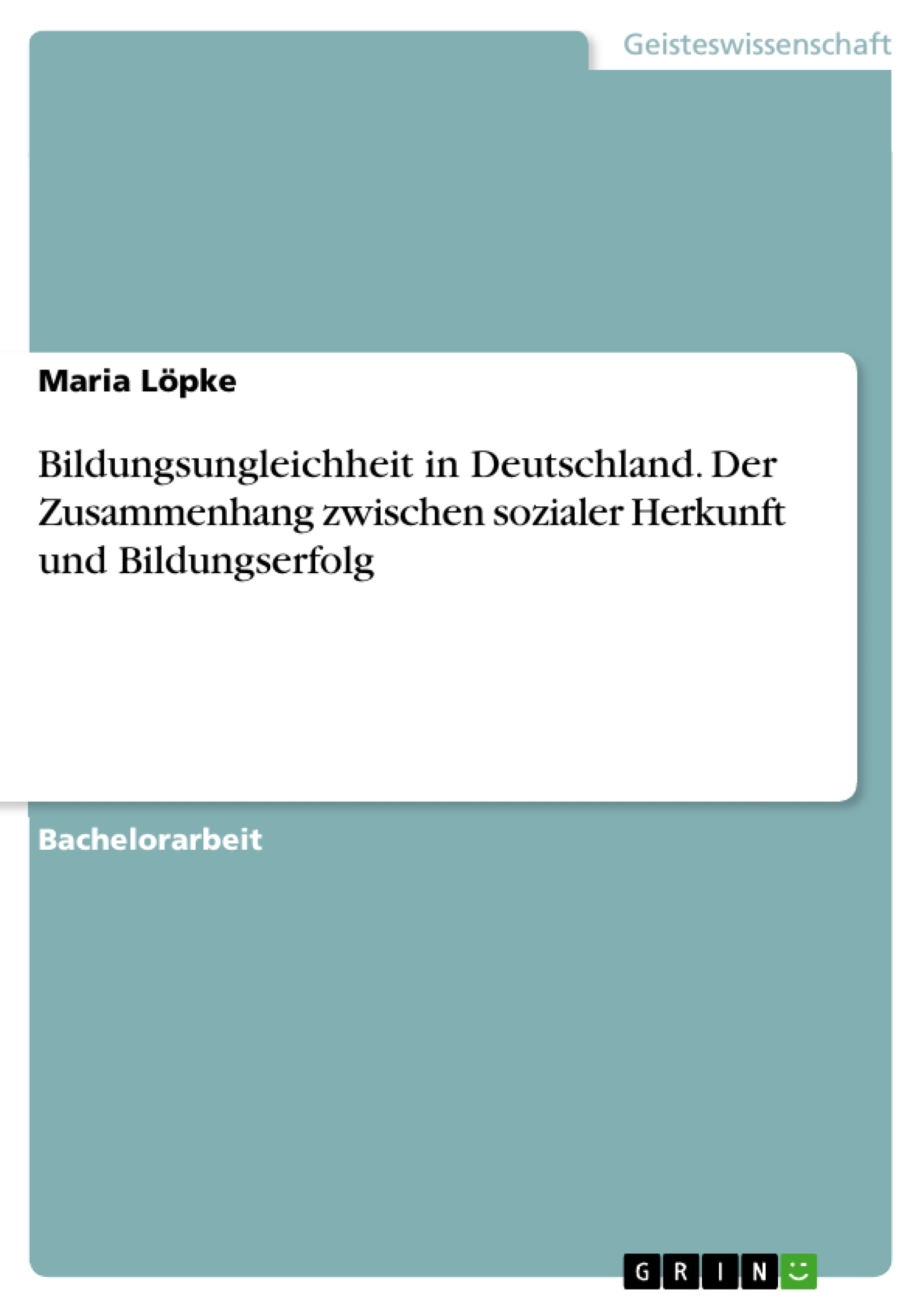Das Thema Bildung steht bereits seit mehreren Jahrzehnten im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Die große Bedeutung von Bildung in der heutigen Gesellschaft ist unumstritten. Seit der Bildungsexpansion in den 50er und der Bildungsdebatte in den 60er Jahren sind im Bereich Bildung sowohl positive wie auch negative Entwicklungen zu verzeichnen. So wurde durch die Bildungsexpansion eine allgemeine Anhebung des Bildungsniveaus erreicht, das heißt, dass sich die Bildungschancen für alle Schichten verbessert haben. Dennoch konnten gravierende schichttypische Ungleichheiten bis heute nicht beseitigt werden. Im Gegenteil, die Ungleichheiten wachsen weiter an.
Die Arbeit wurde literarisch mit teilempirischen Elementen angefertigt. Zu Beginn wurden eventuelle Begriffsunklarheiten durch Erläuterungen beseitigt und der Aufbau des deutschen Bildungssystems vorgestellt. Anschließend wurde mit Hilfe von der PISA Studie und der geschichtlichen Entwicklung der aktuelle Forschungsstand in Deutschland erläutert. Mit Kapitel 3 wird offengelegt, warum die Abhängigkeit des Schulerfolgs von der sozialen Herkunft überhaupt ein Problem darstellt und welche Faktoren dabei den Grundstein legen. Kapitel 4 behandelt die Erfassung der Ursachen der Bildungsungleichheit in Deutschland mit Hilfe von soziologischen Theorien und spannt den Bogen zur Entstehung von Bildungsaspirationen bei Eltern. Anschließend wurde in Kapitel 5 mit Hilfe von eigens erhobenen Daten erforscht, welcher Zusammenhang zwischen dem Bildungsabschluss der Eltern und deren Wunschvorstellungen in Bezug auf den Bildungsweg des Kindes bestehen. Hierzu wurden Eltern mittels eines Fragebogens interviewt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Bildungsungleichheit in Deutschland – Stand und Entwicklung
- 2.1 Begriffsbestimmungen
- 2.1.1 Soziale Herkunft
- 2.1.2 Bildungsungleichheit
- 2.2 Aufbau des deutschen Bildungssystems
- 2.3 Aktueller Forschungsstand
- 2.3.1 Die Geschichte der Bildungsungleichheit in Deutschland und rechtliche Grundlagen
- 2.3.2 Die PISA-Studie und ihre Ergebnisse in Bezug auf die Bildungsungleichheit durch soziale Herkunft
- 3 Das Problem der Abhängigkeit des Schulerfolgs von der sozialen Herkunft
- 3.1 Zwei Faktoren der herkunftsabhängigen Bildungschancen
- 3.2 Warum die Abhängigkeit der Bildungschancen von der sozialen Herkunft als Problematik anzusehen ist
- 3.2.1 Bildung als Schlüssel für Lebensqualität
- 3.2.2 Das biologische Argument und seine Nichtigkeit
- 4 Ursachen der Bildungsungleichheit – theoretischer Hintergrund
- 4.1 Ansätze der Rational-Choice-Theorie
- 4.1.1 Primäre und sekundäre Herkunftseffekte nach Boudon (1974)
- 4.1.2 Die Humankapitaltheorie
- 4.1.3 Die Weiterentwicklung des Humankapitals durch Gambetta (1987)
- 4.1.4 Erikson/Jonsson (1996)
- 4.1.5 Wert-Erwartungstheorie nach Esser (1999)
- 4.2 Der Ansatz Pierre Bourdieus
- 4.2.1 Die Illusion der Chancengleichheit (1971)
- 4.2.2 Das Kapital und seine Bedeutung im sozialen Raum
- 4.3 Wie entstehen Bildungsaspirationen?
- 4.4 Fazit und Kritik
- 5 Empirische Untersuchung
- 5.1 Ziele und Fragestellung
- 5.2 Hypothesen
- 5.3 Methode
- 5.3.1 Stichprobe
- 5.3.2 Fragebogen und Untersuchungsdesign
- 5.3.3 Übersicht der Variablen
- 5.3.4 Vorgehensweise bei der Befragung
- 5.3.5 Methodisches Vorgehen
- 5.3.6 Datenanalyse
- 5.4 Ergebnisse
- 5.4.1 Gesamtstichprobe n = 40
- 5.4.2 Differenzierung nach Familienstatus: alleinerziehend
- 5.4.3 Differenzierung nach Familienstatus: nicht alleinerziehend
- 5.4.4 Interpretation und Diskussion
- 6 Abschließende Reflexion, Ausblick und Handlungsansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bildungsungleichheit in Deutschland. Ziel ist es, den aktuellen Stand der Forschung darzustellen, wesentliche Ursachen zu analysieren und mögliche Handlungsansätze aufzuzeigen. Die empirische Untersuchung soll die Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg beleuchten.
- Soziale Herkunft als Einflussfaktor auf den Bildungserfolg
- Theoretische Erklärungsansätze für Bildungsungleichheit
- Das deutsche Bildungssystem und seine Rolle bei der Reproduktion sozialer Ungleichheit
- Empirische Ergebnisse und deren Interpretation
- Handlungsempfehlungen zur Reduktion von Bildungsungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Bildungsungleichheit in Deutschland ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es betont die gesellschaftliche Relevanz des Themas und die Notwendigkeit, Ursachen und Folgen von Bildungsungleichheit zu verstehen.
2 Bildungsungleichheit in Deutschland – Stand und Entwicklung: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über den aktuellen Stand der Bildungsungleichheit in Deutschland. Es definiert zentrale Begriffe wie "soziale Herkunft" und "Bildungsungleichheit" und beschreibt den Aufbau des deutschen Bildungssystems. Der aktuelle Forschungsstand wird dargestellt, inklusive der Bedeutung von Studien wie PISA und der historischen Entwicklung der Bildungsungleichheit in Deutschland.
3 Das Problem der Abhängigkeit des Schulerfolgs von der sozialen Herkunft: Dieses Kapitel beleuchtet die Problematik der Abhängigkeit des Schulerfolgs von der sozialen Herkunft. Es werden zwei zentrale Faktoren herausgestellt, die diese Abhängigkeit beeinflussen. Die Arbeit argumentiert, warum diese Abhängigkeit als gesellschaftliches Problem betrachtet werden muss, mit Fokus auf Bildung als Schlüssel zur Lebensqualität und der Widerlegung biologischer Argumente.
4 Ursachen der Bildungsungleichheit – theoretischer Hintergrund: In diesem Kapitel werden verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung von Bildungsungleichheit vorgestellt. Es werden Ansätze der Rational-Choice-Theorie (z.B. Boudon, Humankapitaltheorie, Gambetta, Erikson/Jonsson, Esser) und der Ansatz Pierre Bourdieus mit seinen Konzepten von Kapital und sozialem Raum ausführlich diskutiert. Der Einfluss von Bildungsaspirationen wird ebenfalls beleuchtet.
5 Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführte empirische Untersuchung. Es werden die Ziele, Hypothesen, Methoden (Stichprobe, Fragebogen, Datenanalyse) und das methodische Vorgehen detailliert dargestellt. Die Ergebnisse werden für die Gesamtstichprobe sowie differenziert nach Familienstatus (alleinerziehend/nicht alleinerziehend) präsentiert und interpretiert. Die Interpretation der Ergebnisse legt den Fokus auf die Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen und bietet eine fundierte Diskussion der Befunde.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, soziale Herkunft, Bildungssystem Deutschland, PISA-Studie, Rational-Choice-Theorie, Pierre Bourdieu, Humankapital, Bildungsaspirationen, empirische Untersuchung, Chancengleichheit, soziale Ungleichheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Bildungsungleichheit in Deutschland
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bildungsungleichheit in Deutschland. Sie analysiert den aktuellen Stand der Forschung, wesentliche Ursachen und mögliche Handlungsansätze zur Reduktion dieser Ungleichheit.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg, theoretische Erklärungsansätze für Bildungsungleichheit (Rational-Choice-Theorie, Pierre Bourdieu), das deutsche Bildungssystem und seine Rolle bei der Reproduktion sozialer Ungleichheit, die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Bildungsungleichheit in Deutschland – Stand und Entwicklung, Das Problem der Abhängigkeit des Schulerfolgs von der sozialen Herkunft, Ursachen der Bildungsungleichheit – theoretischer Hintergrund, Empirische Untersuchung und Abschließende Reflexion, Ausblick und Handlungsansätze. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und trägt zum Gesamtverständnis des Themas bei.
Welche theoretischen Ansätze werden zur Erklärung der Bildungsungleichheit verwendet?
Die Arbeit nutzt verschiedene theoretische Ansätze, darunter die Rational-Choice-Theorie (mit Unterpunkten wie Boudon's Primär- und Sekundäreffekte, Humankapitaltheorie, Gambetta, Erikson/Jonsson, Esser) und den Ansatz von Pierre Bourdieu mit seinen Konzepten von Kapital und sozialem Raum. Die Bildungsaspirationen werden ebenfalls als relevanter Faktor betrachtet.
Wie sieht die empirische Untersuchung aus?
Die empirische Untersuchung beinhaltet die Formulierung von Zielen und Hypothesen, die Beschreibung der Methodik (Stichprobe, Fragebogen, Datenanalyse), die Präsentation der Ergebnisse für die Gesamtstichprobe (n=40) und eine differenzierte Betrachtung nach Familienstatus (alleinerziehend/nicht alleinerziehend). Die Ergebnisse werden interpretiert und diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bildungsungleichheit, soziale Herkunft, Bildungssystem Deutschland, PISA-Studie, Rational-Choice-Theorie, Pierre Bourdieu, Humankapital, Bildungsaspirationen, empirische Untersuchung, Chancengleichheit, soziale Ungleichheit.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den aktuellen Stand der Forschung zur Bildungsungleichheit in Deutschland darzustellen, wesentliche Ursachen zu analysieren und mögliche Handlungsansätze aufzuzeigen. Die empirische Untersuchung soll die Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg beleuchten.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Untersuchung?
Die konkreten Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden im Kapitel 5 detailliert dargestellt und interpretiert, inklusive einer Differenzierung nach Familienstatus (alleinerziehend/nicht alleinerziehend). Die Interpretation legt den Fokus auf die Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen.
Gibt es Handlungsempfehlungen?
Ja, die Arbeit schließt mit einer abschliessenden Reflexion, einem Ausblick und konkreten Handlungsansätzen zur Reduktion von Bildungsungleichheit.
- Quote paper
- Maria Löpke (Author), 2016, Bildungsungleichheit in Deutschland. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339079