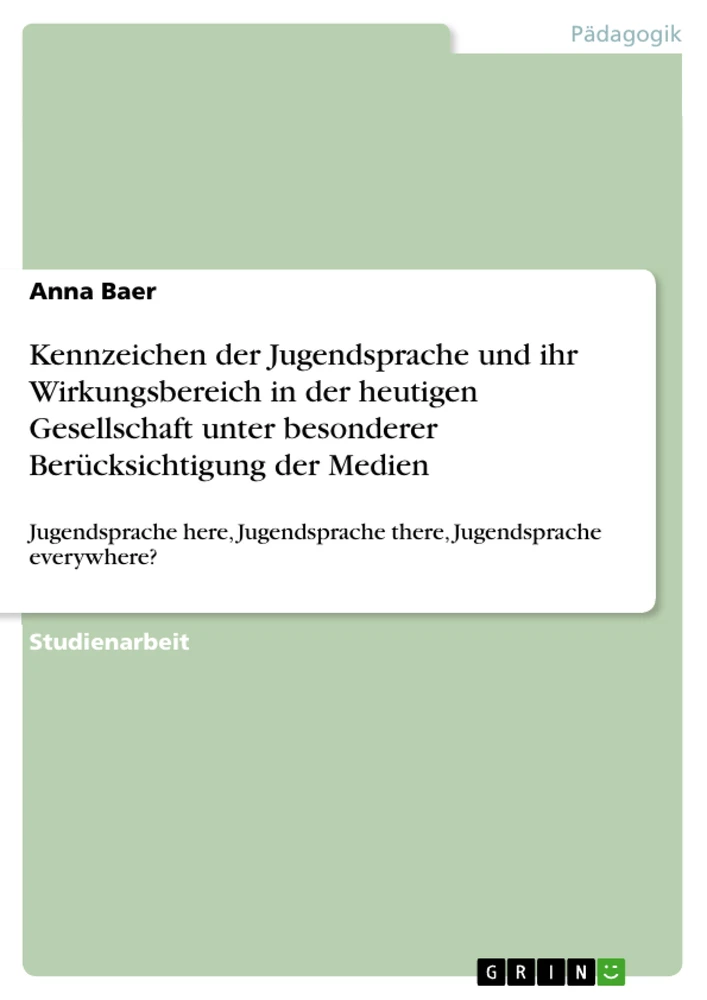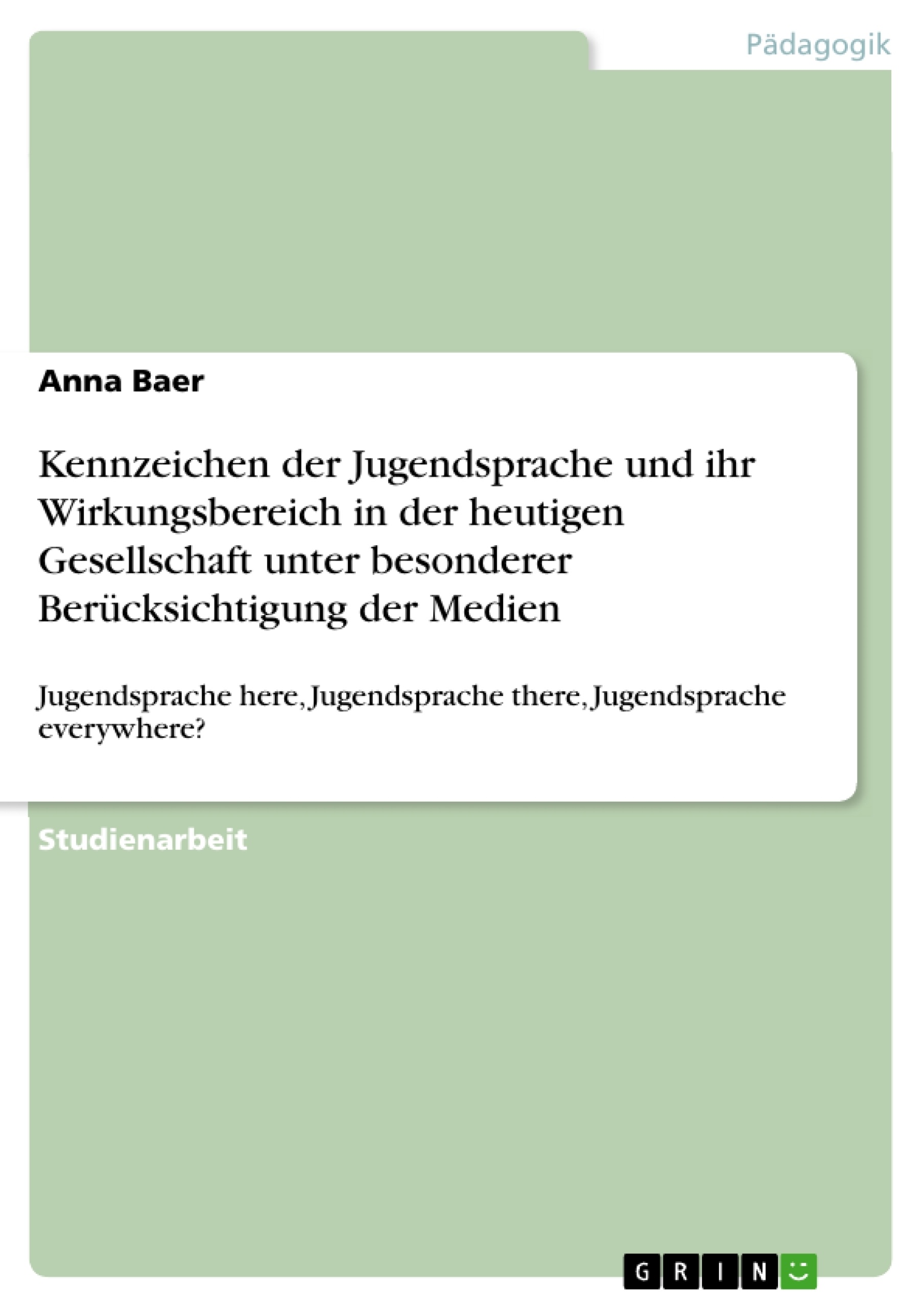Viele Werke, die sich mit Jugendsprache auseinandersetzen, wollen das Informationsbedürfnis der Gesellschaft befriedigen und sie unterhalten. Der wissenschaftliche Anspruch tritt dabei leider in den Hintergrund. Diese Entwicklung wird auch von den Medien unterstützt, die unter anderem auch „an dem Mythos der Jugendsprache gestrickt“ haben. Inwieweit die Medien Einfluss auf die Jugendsprache haben, soll im dritten Kapitel diskutiert werden. Näher beschäftigen möchte ich mich in diesem Kapitel vor allem mit dem Fernsehen (3.1.), der Werbung (3.2.), einem Film (3.3.) und einer bekannten Jugendzeitschrift, der BRAVO (3.4.). Es soll gezeigt werden, in welchen Bereichen Jugendsprache auftaucht und diskutiert werden, ob diese Jugendsprache reine Fiktion ist oder die sprachliche Realität gut abbildet.
Der Langenscheidt-Verlag kürt seit 2008 jedes Jahr ein Wort zu dem Jugendwort des Jahres. Durch diese Abstimmung wusste mein Großvater auch gut über „Läuft bei dir“ Bescheid, welches 2014 den ersten Platz belegte. In dem vierten Kapitel soll es um das Voting für das Jugendwort gehen und auch ältere „Gewinner-Wörter“ in den Blick genommen werden. Bildet diese Umfrage des Langenscheidt-Verlages die sprachliche Realität besser ab, als andere (pseudowissenschaftliche) Untersuchungen zum Thema Jugendsprache? Außerdem möchte ich mich in dem Kapitel im Hinblick auf die Popularisierung von Jugendwörtern kurz mit dem DUDEN beschäftigen, der auch jugendsprachliche Ausdrücke aufnimmt (4.2.).
Wenn es um das Thema Jugendsprache geht, ist in diesem Zusammenhang oft die Rede von Sprachverfall. Die deutsche Sprach- und Wortentwicklung würde durch die Jugendszene geprägt, welches nicht immer Begeisterung unter den Hütern der deutschen Sprache hervorruft, da Jugendsprache die Allgemeinsprache negativ beeinflussen würde. In dem fünften Kapitel werde ich mich mit Kritik an der Jugendsprache beschäftigen und außerdem diskutieren, ob es durch Jugendsprache zu Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den verschiedenen Generationen kommen kann. Das Werk von Heike Wiese soll in diesem Kontext der Kritik Argumente gegen den Sprachverfall, der angeblich durch Jugendsprache unterstützt wird, liefern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Jugendsprache generell
- 2.1. Definition von „Jugend“
- 2.2. Kennzeichen der Jugendsprache
- 3. Jugendsprache in den Medien
- 3.1. Fernsehen
- 3.2. Werbung
- 3.3. Filme - Fack ju Göhte
- 3.4. Zeitschrift BRAVO
- 4. Popularisierung von Jugendwörtern
- 4.1. Jugendwort des Jahres
- 4.1.1. Jugendwörter der vergangenen Jahre
- 4.1.2. Jugendwort des Jahres 2015
- 4.1.3. Untersuchung zu dem Bekanntheitsgrad der gekürten Wörter
- 4.2. Jugendwörter im DUDEN
- 4.1. Jugendwort des Jahres
- 5. Jugendsprache in der Kritik
- 5.1. Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Generationen
- 5.2. Sprachverfall?
- 6. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Jugendsprache in der heutigen Gesellschaft, ihre Kennzeichen und ihren Wirkungsbereich, insbesondere im Kontext der Medien. Das Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Jugendsprache zu zeichnen und gängige Mythen und kritische Auseinandersetzungen zu beleuchten.
- Definition und Kennzeichen von Jugendsprache
- Der Einfluss der Medien auf die Jugendsprache
- Popularisierung von Jugendwörtern durch Initiativen wie das Jugendwort des Jahres
- Kritik an der Jugendsprache und die Debatte um Sprachverfall
- Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Generationen im Kontext der Jugendsprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den persönlichen Anstoß zur Auseinandersetzung mit dem Thema Jugendsprache anhand einer Anekdote mit den Großeltern. Sie stellt die Schwierigkeit einer präzisen Definition von Jugendsprache heraus und umreißt den Fokus der Arbeit: die Untersuchung der Jugendsprache in Deutschland, unter besonderer Berücksichtigung ihres Auftretens in den Medien und der gesellschaftlichen Kritik an ihr. Der wissenschaftliche Anspruch wird betont, im Gegensatz zu vielen bestehenden, eher unterhaltenden Publikationen zum Thema.
2. Jugendsprache generell: Dieses Kapitel beginnt mit einer Definition des Begriffs „Jugend“, indem es die Jugendphase als Übergangsphase zwischen Kindheit und Erwachsenenalter beschreibt, in der die Entwicklung von Selbstständigkeit, eigenem Lebensstil und sozialer Identität im Vordergrund steht. Die Bedeutung von Peer-Groups und die Abgrenzung von der Erwachsenenwelt werden hervorgehoben. Anschließend werden die Kennzeichen der Jugendsprache erläutert. Es wird betont, dass es sich um ein temporäres Phänomen handelt, das auf dem Bestand der deutschen Sprache aufbaut und oft als „Sprache der Intimität“ innerhalb enger Freundeskreise verwendet wird. Die Funktion der Jugendsprache für den Aufbau der Gruppenidentität und die Abgrenzung von anderen Gruppen wird ausführlich diskutiert.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Medien, Jugendwort des Jahres, Sprachverfall, Generationenkonflikt, Peer-Groups, Kommunikation, Sprachwandel, Identität, Soziale Normen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Jugendsprache in den Medien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Jugendsprache in der heutigen Gesellschaft. Sie beleuchtet deren Kennzeichen, ihren Wirkungsbereich (insbesondere in den Medien) und gängige Mythen und kritische Auseinandersetzungen. Das Ziel ist ein umfassendes Bild der Jugendsprache zu zeichnen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Definition und Kennzeichen von Jugendsprache; Einfluss der Medien auf die Jugendsprache; Popularisierung von Jugendwörtern (inkl. "Jugendwort des Jahres"); Kritik an der Jugendsprache und die Debatte um Sprachverfall; Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Generationen im Kontext der Jugendsprache.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, die den persönlichen Anstoß zum Thema und den wissenschaftlichen Anspruch der Arbeit beschreibt. Es folgen Kapitel zur Jugendsprache im Allgemeinen (Definition von "Jugend", Kennzeichen der Jugendsprache), zur Jugendsprache in den Medien (Fernsehen, Werbung, Filme, Zeitschriften), zur Popularisierung von Jugendwörtern (inkl. Untersuchung zum Bekanntheitsgrad), und zur Kritik an der Jugendsprache (Kommunikationsschwierigkeiten, Sprachverfall). Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Fazit.
Wie wird Jugendsprache definiert?
Die Arbeit definiert Jugendsprache als ein temporäres Phänomen, das auf dem Bestand der deutschen Sprache aufbaut und oft als „Sprache der Intimität“ innerhalb enger Freundeskreise verwendet wird. Ihre Funktion liegt im Aufbau der Gruppenidentität und der Abgrenzung von anderen Gruppen.
Welche Medien werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss verschiedener Medien auf die Jugendsprache, darunter Fernsehen, Werbung, Filme (am Beispiel "Fack ju Göhte") und die Zeitschrift BRAVO.
Welche Rolle spielt das "Jugendwort des Jahres"?
Das "Jugendwort des Jahres" dient als Beispiel für die Popularisierung von Jugendwörtern. Die Arbeit untersucht Jugendwörter vergangener Jahre, das Jugendwort des Jahres 2015 und den Bekanntheitsgrad der gekürten Wörter.
Wie wird die Kritik an der Jugendsprache dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet die Kritik an der Jugendsprache, insbesondere die Debatte um den "Sprachverfall" und die damit verbundenen Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Generationen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Jugendsprache, Medien, Jugendwort des Jahres, Sprachverfall, Generationenkonflikt, Peer-Groups, Kommunikation, Sprachwandel, Identität, Soziale Normen.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die wichtigsten Punkte und Erkenntnisse jedes Abschnitts hervorhebt.
- Quote paper
- Anna Baer (Author), 2015, Kennzeichen der Jugendsprache und ihr Wirkungsbereich in der heutigen Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338957