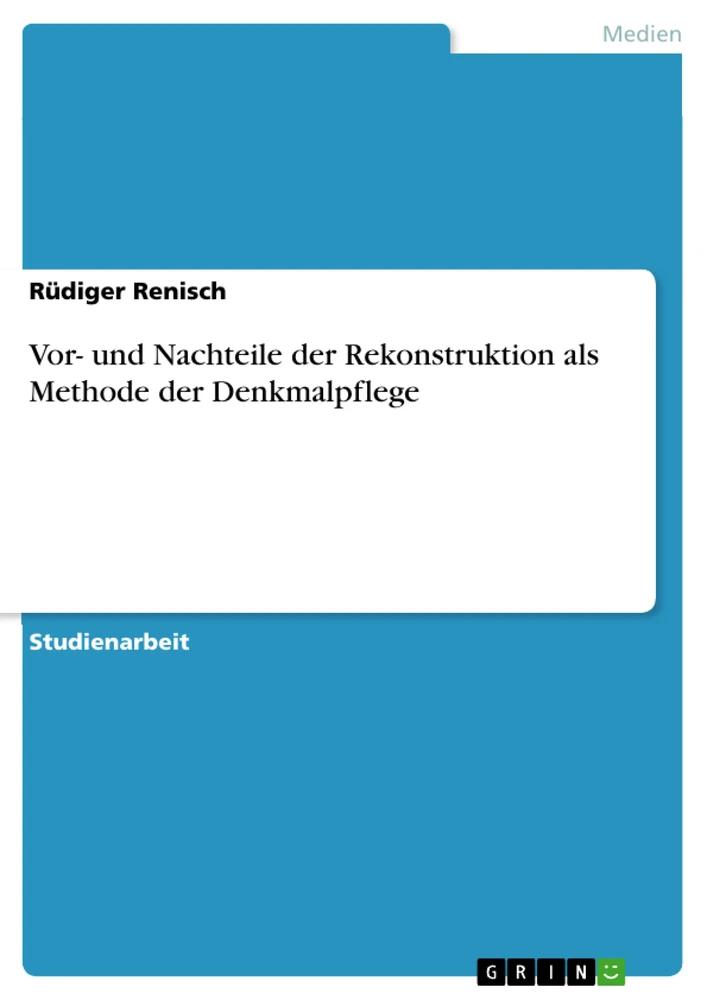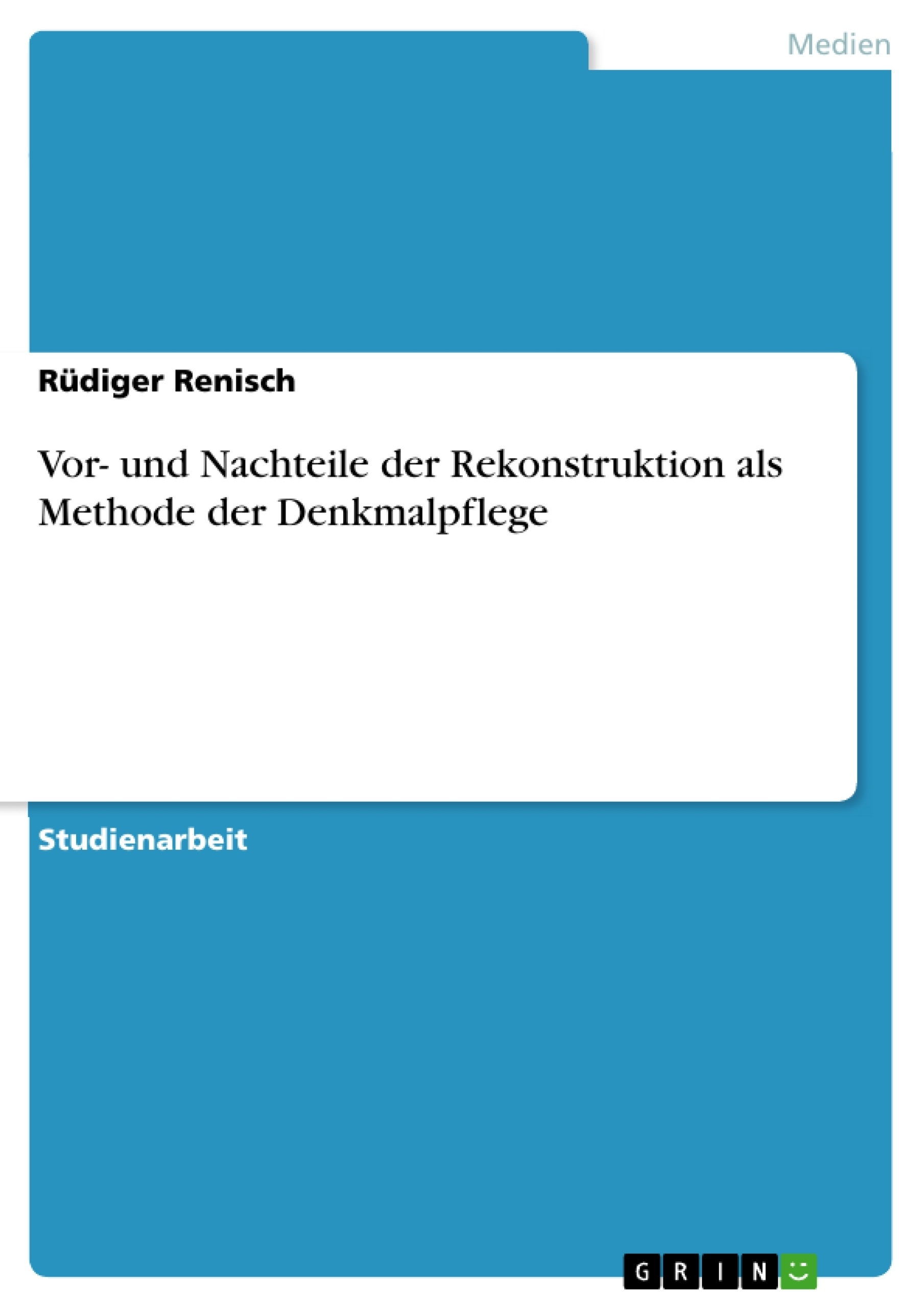Das Verhältnis zwischen Denkmalpflege und Rekonstruktion ist bis heute Gegenstand einer äußerst intensiven wie kontroversen Diskussion, in der sich die Standpunkte der Denkmalpfleger und die der Rekonstruktionsbefürworter zumeist unversöhnlich gegenüberstehen.
Dies ist nicht erstaunlich, scheinen doch die Gebiete der Rekonstruktion und Denkmalpflege im Prinzip keine Berührungspunkte zu haben. Allein die Gegenstandsbestimmung und daraus resultierende Zielsetzungen beider Aufgabengebiete scheinen sich auf den ersten Blick gegenseitig auszuschließen. Die Aufgabe der Denkmalpflege, die Bewahrung des Denkmalwertes eines Objekts, basiert auf der pflegerischen Erhaltung dessen materieller Substanz, nach Artikel 14 der Charta von Burra. Ihr konkreter Gegenstand ist somit ein vorhandenes, materielles Objekt. Bei der Rekonstruktion hingegen kann das Objekt rein hypothetischen Charakter haben: Das Denkmal, welches durch den Prozess der Rekonstruktion erst hergestellt wird, ist hier im Gegensatz zum Gegenstand der Denkmalpflege gewissermaßen ein immaterieller Gegenstand, der erst im Zuge der Rekonstruktion zum tatsächlichen Objekt wird. In der Charta von Venedig wird das Denkmal als Zeugnis bezeichnet, das eine geistige Botschaft der Vergangenheit vermittelt. Allerdings wird in der Charta nicht explizit erwähnt, welche Beschaffenheit dieses Zeugnis haben muss, also ob es definitiv einen materiellen Hintergrund haben muss, oder ob es auch eine immaterielle Beschaffenheit haben kann, wie zum Beispiel eine Sprache, die nicht schriftlich fixiert ist.
Pointiert formuliert: Denkmalpflege befasst sich mit dem Denkmal als einem materiellen Gegenstand. Rekonstruktion befasst sich hingegen mit dem Denkmal als einem immateriellen Gegenstand. In diesen gegensätzlichen Ansprüchen von Denkmalpflege und Rekonstruktion liegen die Gründe für die Debatte zwischen den Denkmalpflegern und den Rekonstruktionsbefürwortern. Wobei anzumerken ist, dass sich unter den Rekonstruktionsbefürwortern auch Denkmalpfleger befinden. Ein wesentlicher Grund, warum sich die Denkmalpfleger um ihr materielles Erbe sorgen und es ablehnen, sich mit zerstörten oder vergangenen Denkmälern zu befassen, liegt in der sogenannten Authentizität der materiellen Hinterlassenschaften begründet.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0. Einleitung
- 1.1. Zwischen Denkmalpflege und Rekonstruktion-Hans Nadler
- 1.2. Definitionsklärung der Begriffe Rekonstruktion, Kopie, Wiederaufbau und Anastylose
- 1.3. Versuch einer Positionsbestimmung: Rekonstruktion und Denkmalpflege
- 2.0. Wesentliche Gründe gegen die Rekonstruktion als Methode in der Denkmalpflege
- 2.1. Wesentliche Gründe die für eine Rekonstruktion sprechen
- 2.2. Zusammenfassung der Rekonstruktionsdebatte
- 2.3. Befürwortung der Rekonstruktion bei Beachtung von Mindestanforderungen
- 3.0. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Verhältnis zwischen Denkmalpflege und Rekonstruktion. Sie setzt sich zum Ziel, die Positionen von Denkmalpflegern und Rekonstruktionsbefürwortern zu beleuchten und eine eigene Positionsbestimmung zu erarbeiten. Dabei soll auch der Einfluss der Authentizität im Kontext der Denkmalpflege erörtert werden.
- Rekonstruktion als Methode der Denkmalpflege
- Authentizitätsbegriff in der Denkmalpflege
- Definitionen von Rekonstruktion, Kopie, Wiederaufbau und Anastylose
- Argumente für und gegen die Rekonstruktion
- Positionsbestimmung zur Rekonstruktion im Kontext der Denkmalpflege
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den kontroversen Diskurs um die Rekonstruktion im Kontext der Denkmalpflege. Dabei wird der Fokus auf die gegensätzlichen Zielsetzungen beider Bereiche gelegt. Die unterschiedlichen Ansätze, wie sie durch die Charta von Burra und die Charta von Venedig vertreten werden, werden ebenfalls diskutiert.
Kapitel 1.1. widmet sich der Position von Hans Nadler, einem prominenten Befürworter der Rekonstruktion, insbesondere im Kontext der Wiederaufbauphase Dresdens nach dem Zweiten Weltkrieg.
Kapitel 1.2. befasst sich mit den Definitionen von Rekonstruktion, Kopie, Wiederaufbau und Anastylose. Diese Definitionen bilden die Grundlage für die anschließende Analyse der Argumente für und gegen die Rekonstruktion.
Kapitel 1.3. untersucht die Problematik der Positionsbestimmung im Diskurs zwischen Denkmalpflege und Rekonstruktion. Es werden die unterschiedlichen Standpunkte und Argumentationslinien beider Disziplinen betrachtet.
Kapitel 2.0. fokussiert auf die wesentlichen Argumente, die gegen die Rekonstruktion als Methode in der Denkmalpflege sprechen. Die Rolle der Authentizität und der potentiellen Verfälschung der historischen Substanz werden hervorgehoben.
Kapitel 2.1. stellt die Argumente vor, die für die Rekonstruktion sprechen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Wiederherstellung von verlorener Erinnerung und der Möglichkeit, vergangene Bauwerke wieder zugänglich zu machen.
Kapitel 2.2. fasst die in der Debatte um die Rekonstruktion geäußerten Argumente und Standpunkte zusammen. Es werden die zentralen Punkte des Diskurses hervorgehoben und miteinander in Beziehung gesetzt.
Kapitel 2.3. befasst sich mit der Frage, unter welchen Bedingungen die Rekonstruktion eine akzeptable Methode der Denkmalpflege sein kann. Es werden Mindestanforderungen an die Umsetzung von Rekonstruktionsvorhaben erörtert.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit widmet sich den zentralen Themen Denkmalpflege, Rekonstruktion, Authentizität, Wiederaufbau, Geschichte und Erinnerung. Es werden die Begriffe Rekonstruktion, Kopie, Wiederaufbau und Anastylose definiert und im Kontext der Denkmalpflege diskutiert. Die Arbeit beleuchtet die Positionen von Hans Nadler und anderen Rekonstruktionsbefürwortern im Vergleich zu den Argumenten der Denkmalpfleger.
- Arbeit zitieren
- Rüdiger Renisch (Autor:in), 2010, Vor- und Nachteile der Rekonstruktion als Methode der Denkmalpflege, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338575