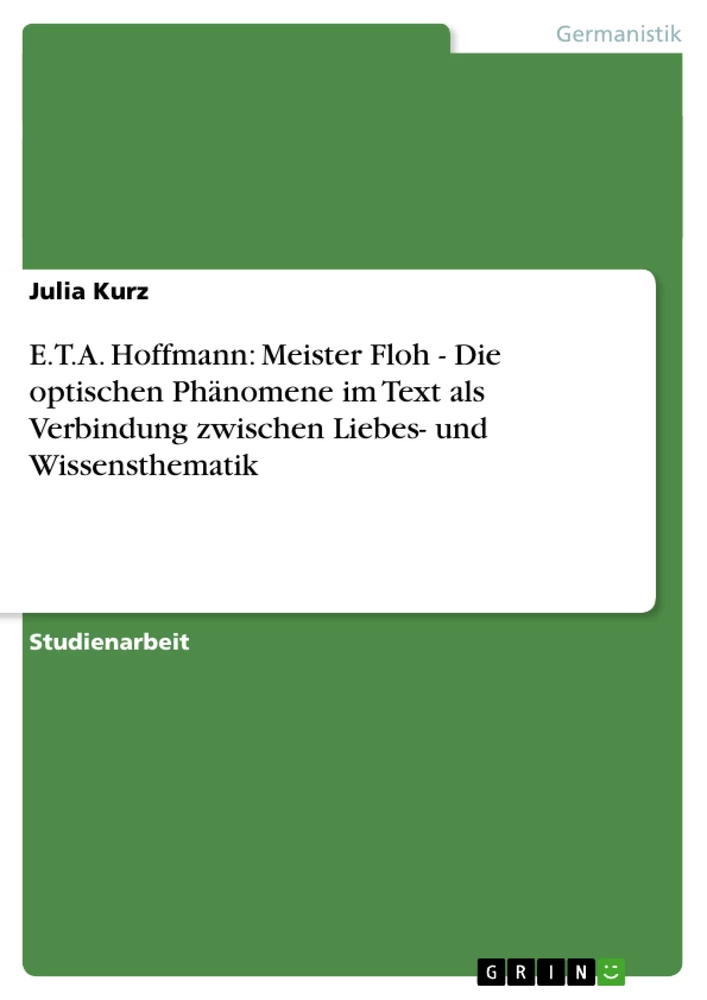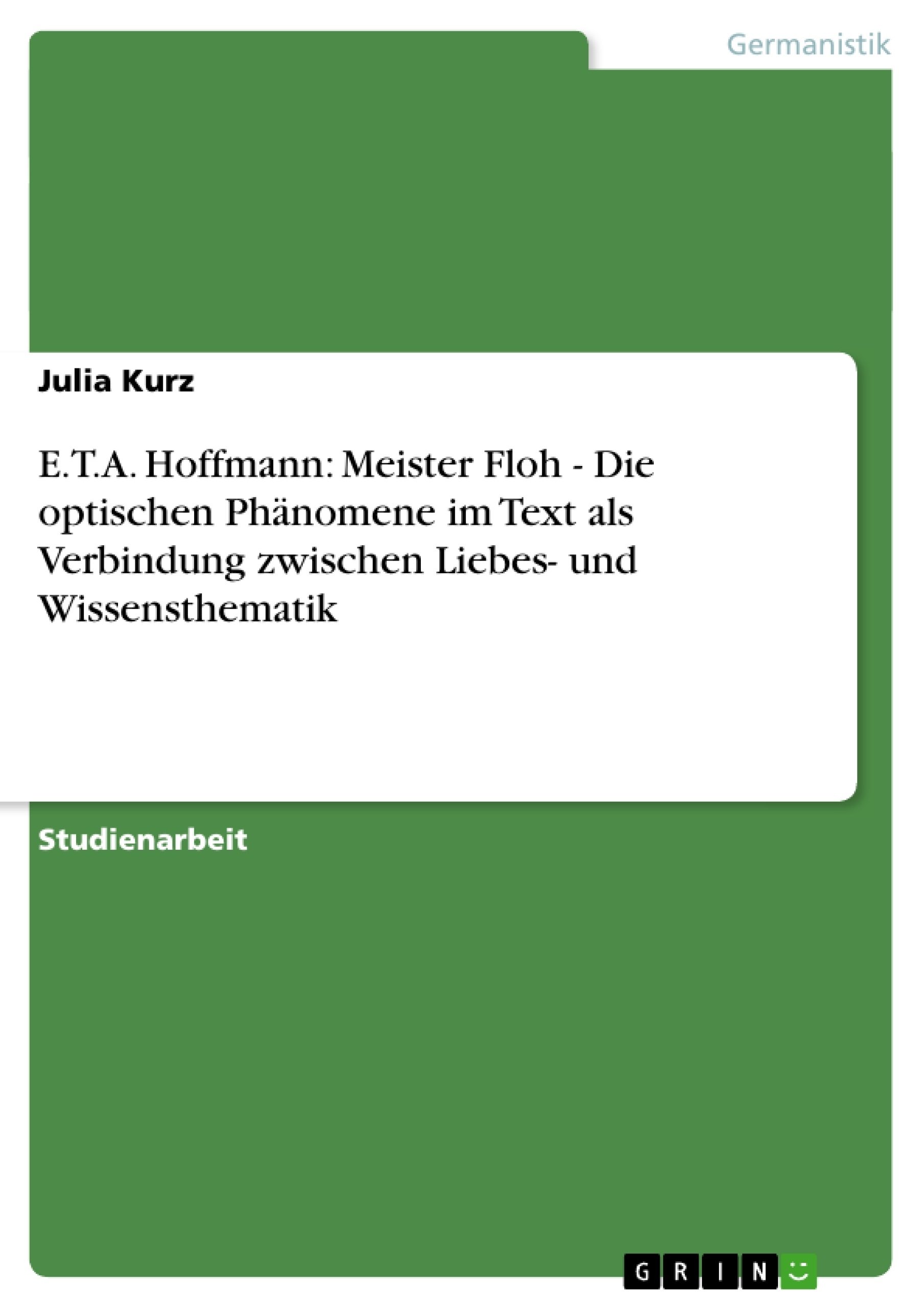Anhand von Briefen E.T.A. Hoffmanns an seinen Frankfurter Verleger Friedrich Wilmans, kann der Entstehungsprozess des „Meister Floh“ sehr genau nachvollzogen werden. Bereits im August 1821 plante Hoffmann ein Märchen zu schreiben, welches im kommenden Winter fertig sein und als Weihnachtsgeschenk dienen sollte. Bedingt durch mehrere Krankheiten wurde das Märchen jedoch nicht in einem Stück, sondern in mehreren, über ein halbes Jahr verteilten Phasen, niedergeschrieben. Erst Anfang November schickte Hoffmann seinem Verleger die erste Lieferung, die restlichen Kapitel sandte er in vier Lieferungen bis zum März des folgenden Jahres. Aus Zeitmangel verzichtete er auf Abschriften, was dazu führte, dass ihm bei der Fertigstellung des Märchens die ersten Abenteuer nicht mehr vorlagen und er darauf angewiesen war, sich daran zu erinnern, wie er seine Geschichte begonnen hatte. Dies wurde, neben diversen Krankheiten, zusätzlich durch die gleichzeitige Arbeit am zweiten Teil des „Kater Murr“ erschwert. Laut vielfacher Meinung1 sei es daher im „Meister Floh“ zu mehreren Unstimmigkeiten gekommen und es Hoffmann nicht gelungen, der Erzählung inhaltliche Geschlossenheit und deutliche Zielsetzung zu geben. Wegen dem problematischen Inhalt, der sogenannten Knarrpanti-Passagen, erschien der „Meister Floh“ erst zwei Monate vor Hoffmanns Tod, im April 1822 in zensierter Form. Der vollständige Text wurde erst im Jahre 1908 von Hans von Müller herausgegeben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Die Entstehungsgeschichte
- 2. Ausblick
- II. Die optischen Phänomene im Text
- III. Die Wissensthemetik
- IV. Liebesthematik
- 1. Liebesvarianten
- 2. Wahre und falsche Liebe
- V. Die Menschwerdung des Peregrinus
- VI. Die Auflösung des Märchengeschehens
- VII. Einordnung des „Meister Floh“ in das Gesamtwerk
- VIII. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert E.T.A. Hoffmanns "Meister Floh" und untersucht die optischen Phänomene im Text als Verbindung zwischen Liebes- und Wissensthemetik. Die Arbeit befasst sich mit der Entstehungsgeschichte des Märchens und verfolgt die Entwicklung des Protagonisten Peregrin, der durch seine Erfahrungen und Begegnungen zu einer weltumfassenden Erkenntnis gelangt.
- Die Bedeutung von optischen Phänomenen als zentrales Darstellungsmittel
- Die Verbindung zwischen optischen Phänomenen, Wissensthemetik und der Entwicklung des Protagonisten
- Die Darstellung von Liebe und deren verschiedenen Facetten im Kontext des Märchens
- Die Rolle der Sinne im Aufbau des "Meister Floh" und die Entstehung des Gesamteindrucks
- Die Integration von Phantastischen und Realen Elementen im Text
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der Entstehungsgeschichte des "Meister Floh" und erläutert die Herausforderungen, die E.T.A. Hoffmann bei der Abfassung des Märchens bewältigen musste. Kapitel II führt die optischen Phänomene im Text ein und untersucht, wie Peregrin seine Umgebung mit seinen Sinnen wahrnimmt. Das dritte Kapitel widmet sich der Wissensthemetik und betrachtet, wie Peregrin im Verlauf der Handlung neues Wissen erwirbt und seine Sicht der Welt verändert. Kapitel IV behandelt die Liebesthematik und analysiert die verschiedenen Liebesvarianten, die im "Meister Floh" dargestellt werden.
Schlüsselwörter
E.T.A. Hoffmann, Meister Floh, optische Phänomene, Wissensthemetik, Liebesthematik, Wahrnehmungsformen, Sinneswahrnehmung, Phantastisches und Reales, Camera obscura, Laterna magica, Peregrin, Aline, Dörtje Elverdink, Prinzessin Gamaheh, Entwicklung des Protagonisten, Erkenntnisgewinn.
- Quote paper
- Julia Kurz (Author), 2004, E.T.A. Hoffmann: Meister Floh - Die optischen Phänomene im Text als Verbindung zwischen Liebes- und Wissensthematik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33849