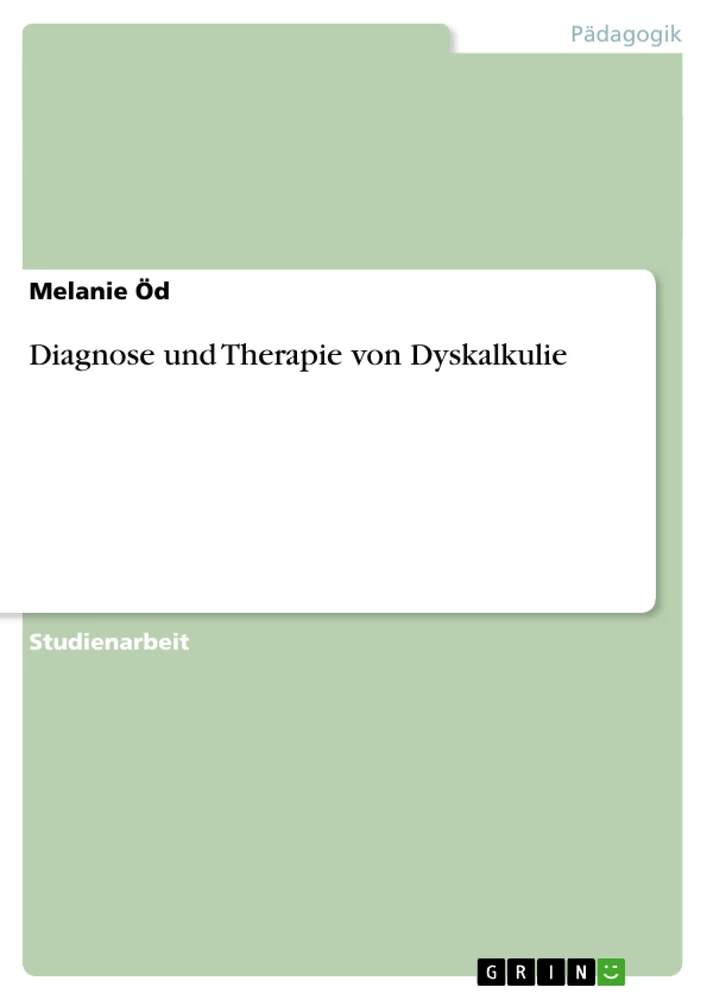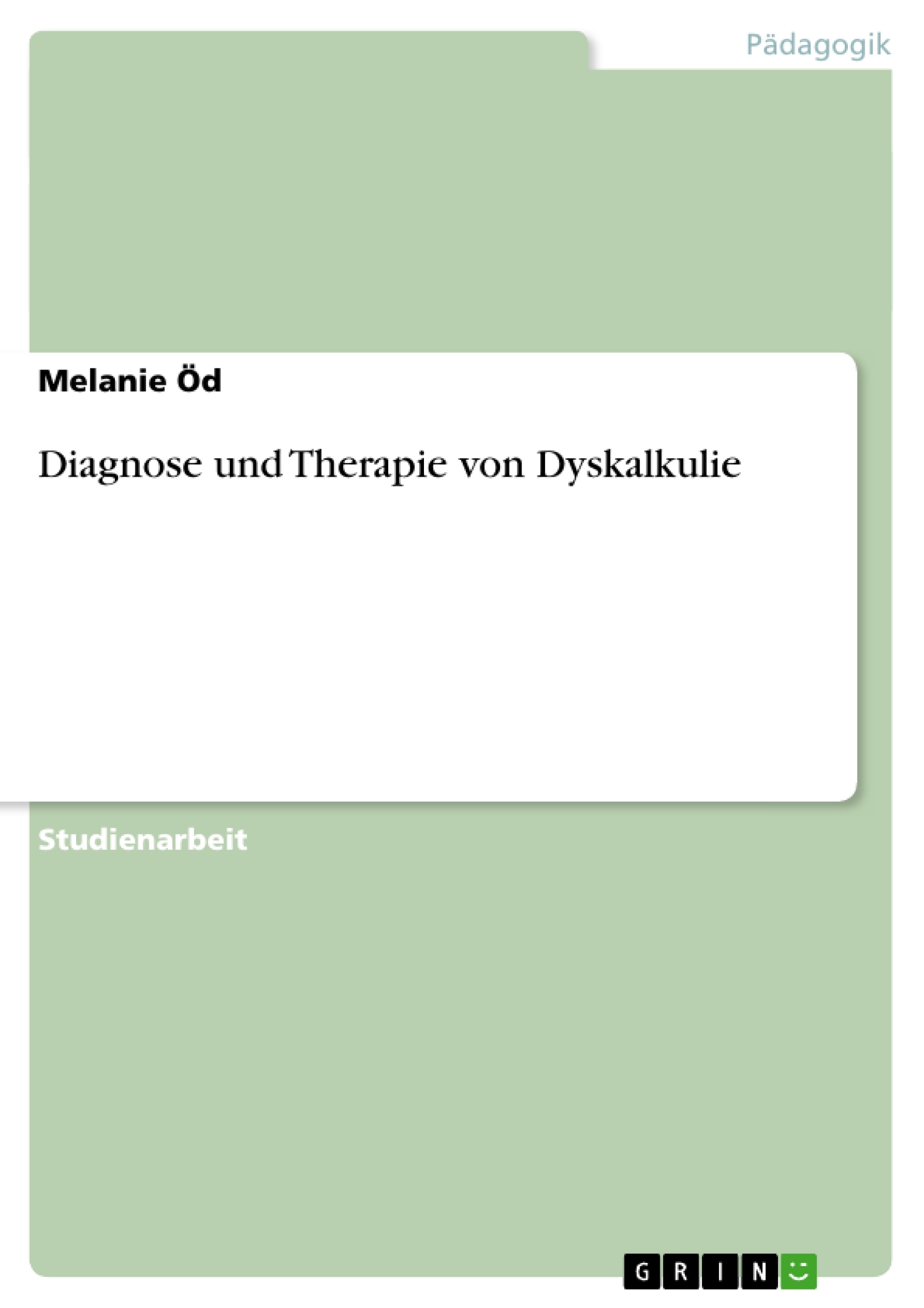„Was ist denn Dyskalkulie?“ So oder so ähnlich lauteten die Kommentare, wenn ich Freunden, Verwandten oder Bekannten erzählt habe, dass ich eine Hausarbeit über Dyskalkulie schreibe. Bei meinen Erklärungen viel dann auch schnell das Wort Legasthenie. Mit diesem Begriff hatten die wenigsten Probleme, damit konnten sie etwas anfangen. Mit Dyskalkulie dagegen nicht. Kein Wunder. Über Legasthenie gibt es einer Reihe von Büchern und auch in den Medien ist es immer wieder Thema. Dyskalkulie dagegen ist noch weitgehend unbekannt. Es gibt kaum Forschung und die Veröffentlichungen dazu sind spärlich. Doch was ist nun Dyskalkulie? In dieser Arbeit möchte ich zunächst einen groben Überblick über Dyskalkulie geben, was versteht man darunter, wie sind die Symptome und wie lässt es sich diagnostizieren. Meinen Schwerpunkt richte ich dann auf Therapiemöglichkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Dyskalkulie-Therapie
- 1. Dyskalkulie - Was ist das?
- 2. Aktuelle Forschungsbefunde
- 3. Diagnose
- 3.1 Ursachen
- 3.2 Symptome und Erscheinungsbild
- 3.2.1 Mengen- und Zahlenvorstellung
- 3.2.2 Zahlen schreiben und Zahlen lesen
- 3.2.3 Zahlenreihe
- 3.2.4 Stellenwertsysteme
- 3.2.5 Schwierigkeiten im Umgang mit Rechenoperationen
- 3.2.6 Schwierigkeiten beim Einmaleins
- 3.2.7 Schwierigkeiten beim Lösen von Sachaufgaben
- 3.2.8 Weiter Schwierigkeiten
- 3.2.9 Die häufigsten Sekundärsymptome der Dyskalkulie nach Erfahrung von Ramacher-Faasen
- 3.3 Dyskalkulie Diagnostik
- 4. Therapie
- 4.1 Präventive Maßnahmen
- 4.2 Wie Eltern helfen können
- 4.3 Pädagogische Hilfen
- 4.4 Dyskalkulietherapie
- 4.4.1 Die Beschäftigung mit Mathematik kann Spaß machen
- 4.4.2 Die Hausaufgaben kann man selbständig bewältigen
- 4.4.3 Ablauf der Therapiestunde
- 4.5 Therapeutische Materialien
- 4.6 Körperarbeit zur Förderung von Dyskalkulenikern
- III. Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Dyskalkulie, einer Entwicklungsstörung, die zu Schwierigkeiten im Rechnen führt. Ziel ist es, einen Überblick über die Störung zu geben, ihre Symptome und Diagnostik zu beschreiben und vor allem verschiedene Therapiemöglichkeiten zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung von Dyskalkulie
- Symptome und Erscheinungsformen der Dyskalkulie
- Diagnostische Verfahren bei Dyskalkulie
- Präventive Maßnahmen und therapeutische Ansätze
- Hilfsangebote für Eltern und Pädagogen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Dyskalkulie ein und veranschaulicht den geringen Bekanntheitsgrad der Störung im Vergleich zu Legasthenie. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit und kündigt den Schwerpunkt auf Therapiemöglichkeiten an. Der Mangel an Forschung und Veröffentlichungen zu Dyskalkulie wird hervorgehoben, was die Relevanz der Arbeit unterstreicht.
II. Dyskalkulie - Therapie: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der Dyskalkulie. Es beginnt mit einer Definition der Störung, die sich von anderen Definitionen abgrenzt, indem sie die Unabhängigkeit von der allgemeinen Intelligenz betont. Es werden verschiedene Synonyme und die Schwierigkeiten bei der Definition aufgrund der individuellen Ausprägung der Störung diskutiert. Anschließend werden die vielfältigen Symptome und Erscheinungsbilder der Dyskalkulie detailliert beschrieben, von Schwierigkeiten bei der Mengen- und Zahlenvorstellung bis hin zu Problemen beim Lösen von Sachaufgaben. Der Abschnitt über die Diagnostik liefert einen Einblick in die Vorgehensweise, während der Schwerpunkt auf den verschiedenen Therapiemöglichkeiten und deren praktischen Umsetzung liegt, inklusive präventiver Maßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern und Pädagogen.
Schlüsselwörter
Dyskalkulie, Rechenstörung, Rechenschwäche, Diagnose, Therapie, Symptome, Zahlenvorstellung, Rechenoperationen, Prävention, Pädagogische Hilfen, Elternarbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Dyskalkulie-Therapie"
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Dyskalkulie, einer Entwicklungsstörung, die zu Schwierigkeiten im Rechnen führt. Sie bietet einen Überblick über die Störung, beschreibt ihre Symptome und Diagnostik und beleuchtet verschiedene Therapiemöglichkeiten.
Was sind die Ziele der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis von Dyskalkulie zu vermitteln. Dies beinhaltet die Definition und Abgrenzung der Störung, die Beschreibung der Symptome und Erscheinungsformen, die Darstellung diagnostischer Verfahren und die Erläuterung präventiver Maßnahmen und therapeutischer Ansätze. Zusätzlich werden Hilfsangebote für Eltern und Pädagogen aufgezeigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Definition und Abgrenzung von Dyskalkulie, Symptome und Erscheinungsformen, diagnostische Verfahren, präventive Maßnahmen und therapeutische Ansätze sowie Hilfsangebote für Eltern und Pädagogen. Ein besonderer Fokus liegt auf den verschiedenen Therapiemöglichkeiten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Dyskalkulie-Therapie und einen Schluss. Das Hauptkapitel umfasst detaillierte Informationen zur Definition, Symptomatik (einschließlich Mengen- und Zahlenvorstellung, Rechenoperationen, Sachaufgaben etc.), Diagnostik und Therapie der Dyskalkulie. Es werden präventive Maßnahmen, Unterstützung für Eltern und pädagogische Hilfen beschrieben.
Welche Symptome der Dyskalkulie werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert eine Vielzahl von Symptomen, darunter Schwierigkeiten bei der Mengen- und Zahlenvorstellung, beim Schreiben und Lesen von Zahlen, im Umgang mit der Zahlenreihe und Stellenwertsystemen, bei Rechenoperationen, beim Einmaleins und beim Lösen von Sachaufgaben. Zusätzlich werden häufige Sekundärsymptome nach Ramacher-Faasen genannt.
Welche Therapieansätze werden vorgestellt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Therapieansätze, darunter präventive Maßnahmen, Hilfestellungen für Eltern, pädagogische Hilfen und spezifische Dyskalkulietherapien. Es wird auch die Bedeutung der spielerischen Auseinandersetzung mit Mathematik und die Unterstützung bei der Bewältigung von Hausaufgaben betont. Körperarbeit zur Förderung wird ebenfalls erwähnt.
Welche diagnostischen Verfahren werden erwähnt?
Die Arbeit gibt einen Überblick über die Vorgehensweise bei der Dyskalkulie-Diagnostik, ohne jedoch konkrete Verfahren im Detail zu beschreiben.
Wer profitiert von dieser Arbeit?
Diese Arbeit richtet sich an alle, die sich mit dem Thema Dyskalkulie auseinandersetzen, einschließlich Eltern, Pädagogen, Therapeuten und Studenten. Sie dient als Informationsquelle und bietet einen umfassenden Überblick über die Störung und deren Behandlung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Dyskalkulie, Rechenstörung, Rechenschwäche, Diagnose, Therapie, Symptome, Zahlenvorstellung, Rechenoperationen, Prävention, Pädagogische Hilfen, Elternarbeit.
- Quote paper
- Melanie Öd (Author), 2003, Diagnose und Therapie von Dyskalkulie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33838