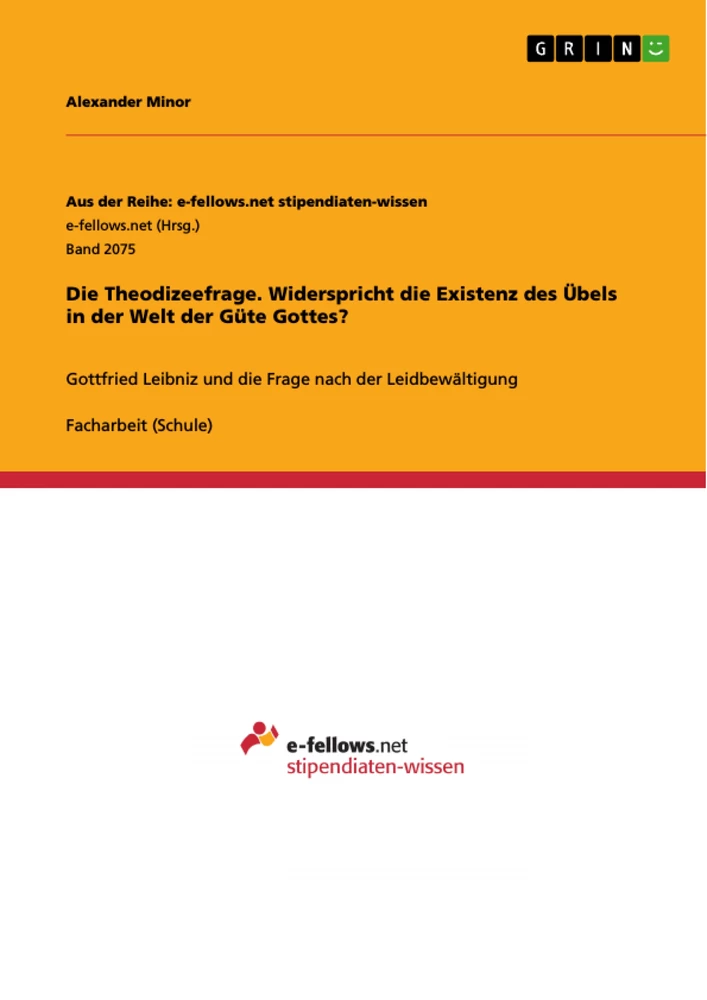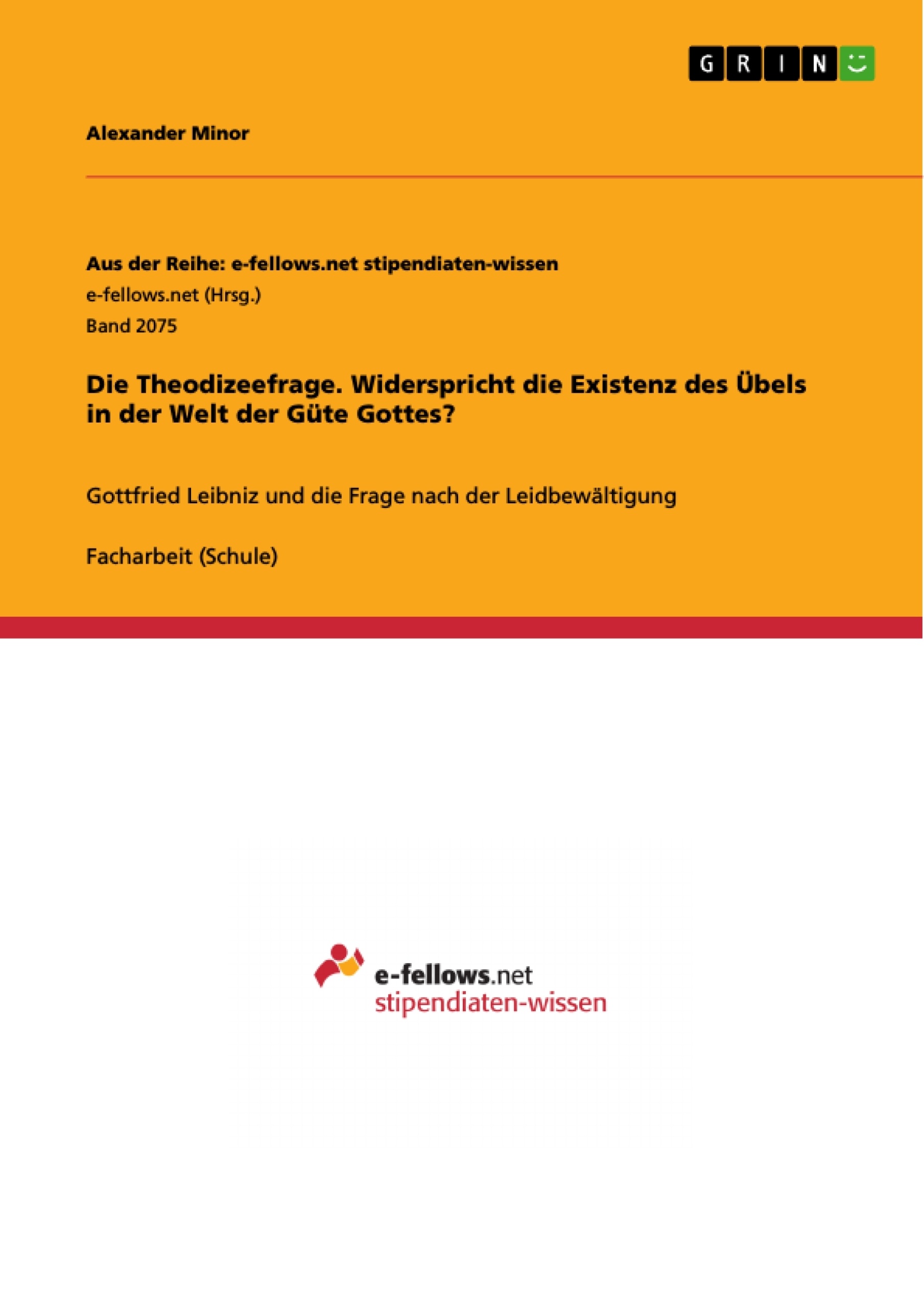Die Arbeit gibt einen Einblick in die Theodizeefrage. Im Folgenden wird Leibniz Antwort auf die Theodizeefrage erläutert. Ein Blick auf das Buch Hiob und ein Vergleich werden dabei helfen, ebenfalls auf die genannte Frage von Epikur einzugehen und zu klären, ob Leibniz Ansichten helfen, Leid zu bewältigen oder zu reduzieren.
Der Begriff „Theodizee“ geht auf den Philosophen Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz zurück. Dieser hat den Begriff 1697 für „die philosophische Beschäftigung mit dem Problem des Übels“ geprägt. Er setzt sich aus den griechischen Wörtern „theos“ (~Gott) und „dike“ (~Gerechtigkeit / Rechtfertigung) zusammen.
Befasst haben sich die Menschen damit allerdings bereits lange Zeit vor Leibniz. Der Erste, der das Problem und die Frage formuliert hat (nachdem die „vorsokratische“ Philosophie sich mit den Ansätzen wie dem Hass befasst hat, war Platon mit der Frage „Si deus est, unde malum?“ (~Falls es einen Gott gibt, woher kommt dann das Übel?).
Epikur dagegen hat die Frage formuliert: „Ist es überhaupt sinnvoll, so zu fragen? Handelt es sich hier [...] nicht um ein praktisches Problem [...] der Leidbewältigung?“
Inhaltsverzeichnis
- „Theodizee“ - der Begriff und die philosophische Beschäftigung..
- Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz
- Die Person und ihr Werk, „Die beste aller Welten“..
- Leibniz Antwort auf die Theodizeefrage
- Was sagt das Buch Hiob zur Leidbewältigung?..
- Epikur: „Handelt es sich hier nicht um ein praktisches Problem?“
- Hilft Leibniz bei der Leidbewältigung oder Leidreduzierung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Theodizeefrage, die sich mit der Frage auseinandersetzt, ob die Existenz des Übels in der Welt der Güte Gottes widerspricht. Im Fokus steht die Antwort des Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz auf diese Frage, wobei seine Argumentation im Kontext des christlichen Gottesbildes und der philosophischen Auseinandersetzung mit dem Problem des Übels betrachtet wird. Darüber hinaus wird das Buch Hiob in Bezug auf die Leidbewältigung analysiert und ein Vergleich mit Leibniz‘ Ansichten gezogen.
- Der Begriff „Theodizee“ und seine historische Entwicklung
- Leibniz’ Antwort auf die Theodizeefrage: „Die beste aller möglichen Welten“
- Die Rolle des Leids in der Welt aus Sicht von Leibniz
- Das Buch Hiob als Beispiel für Leidbewältigung
- Epikurs Frage nach der praktischen Relevanz der Theodizeefrage
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Begriff „Theodizee“ und die philosophische Beschäftigung mit dem Problem des Übels. Es wird die historische Entwicklung der Theodizeefrage von Platon bis Leibniz dargestellt und die Frage nach der Vereinbarkeit von Gottes Güte und der Existenz von Leid aufgeworfen.
Das zweite Kapitel widmet sich der Person Gottfried Wilhelm Leibniz, seiner philosophischen Arbeit und seiner Antwort auf die Theodizeefrage. Leibniz‘ Argumentation, dass unsere Welt „die beste aller möglichen Welten“ ist, wird erläutert und die Frage nach der Rolle des Leids in dieser „besten“ Welt thematisiert.
Das dritte Kapitel analysiert das Buch Hiob und seine Aussagekraft im Kontext der Leidbewältigung. Es wird untersucht, wie das Buch Hiob mit den Herausforderungen des Leids umgeht und welche Botschaften es für den Umgang mit Leid bietet.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit Epikurs Frage, ob die Theodizeefrage nicht eher ein praktisches Problem der Leidbewältigung darstellt. In diesem Zusammenhang wird die Frage aufgeworfen, ob Leibniz‘ Ansichten tatsächlich hilfreich bei der Leidbewältigung oder Leidreduzierung sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen „Theodizee“, „Leid“, „Güte Gottes“, „Leibniz“, „Hiob“, „Epikur“, „Leidbewältigung“, „Leidreduzierung“ und „beste aller möglichen Welten“. Im Zentrum stehen die philosophischen und theologischen Argumente zur Rechtfertigung Gottes angesichts der Existenz von Übel in der Welt und die Frage nach dem Umgang mit Leid.
- Citar trabajo
- Alexander Minor (Autor), 2014, Die Theodizeefrage. Widerspricht die Existenz des Übels in der Welt der Güte Gottes?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338099