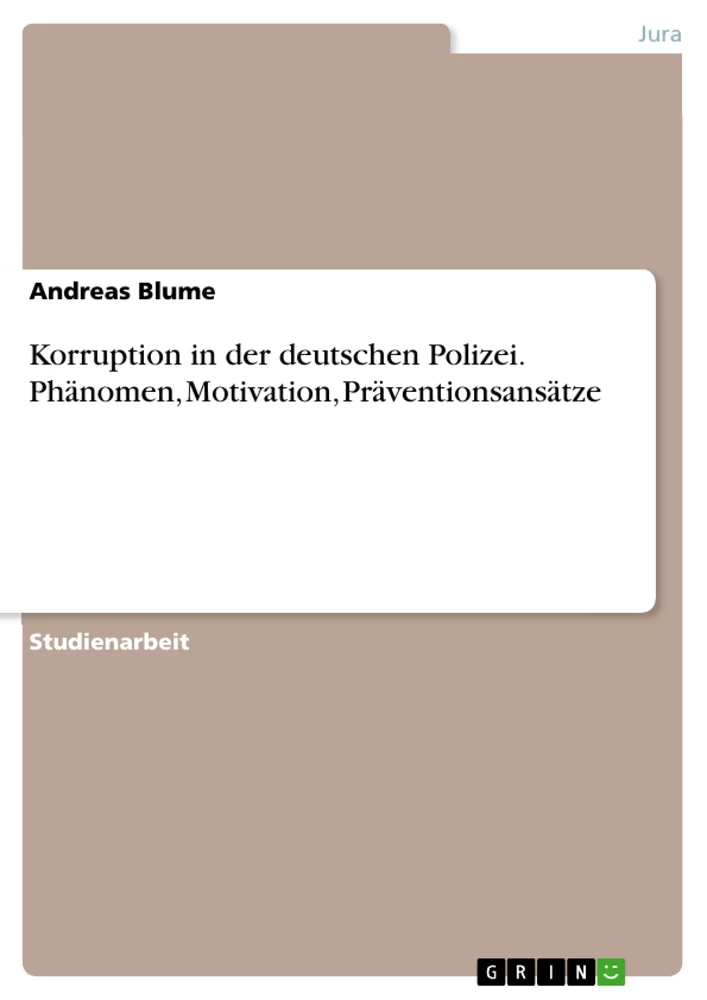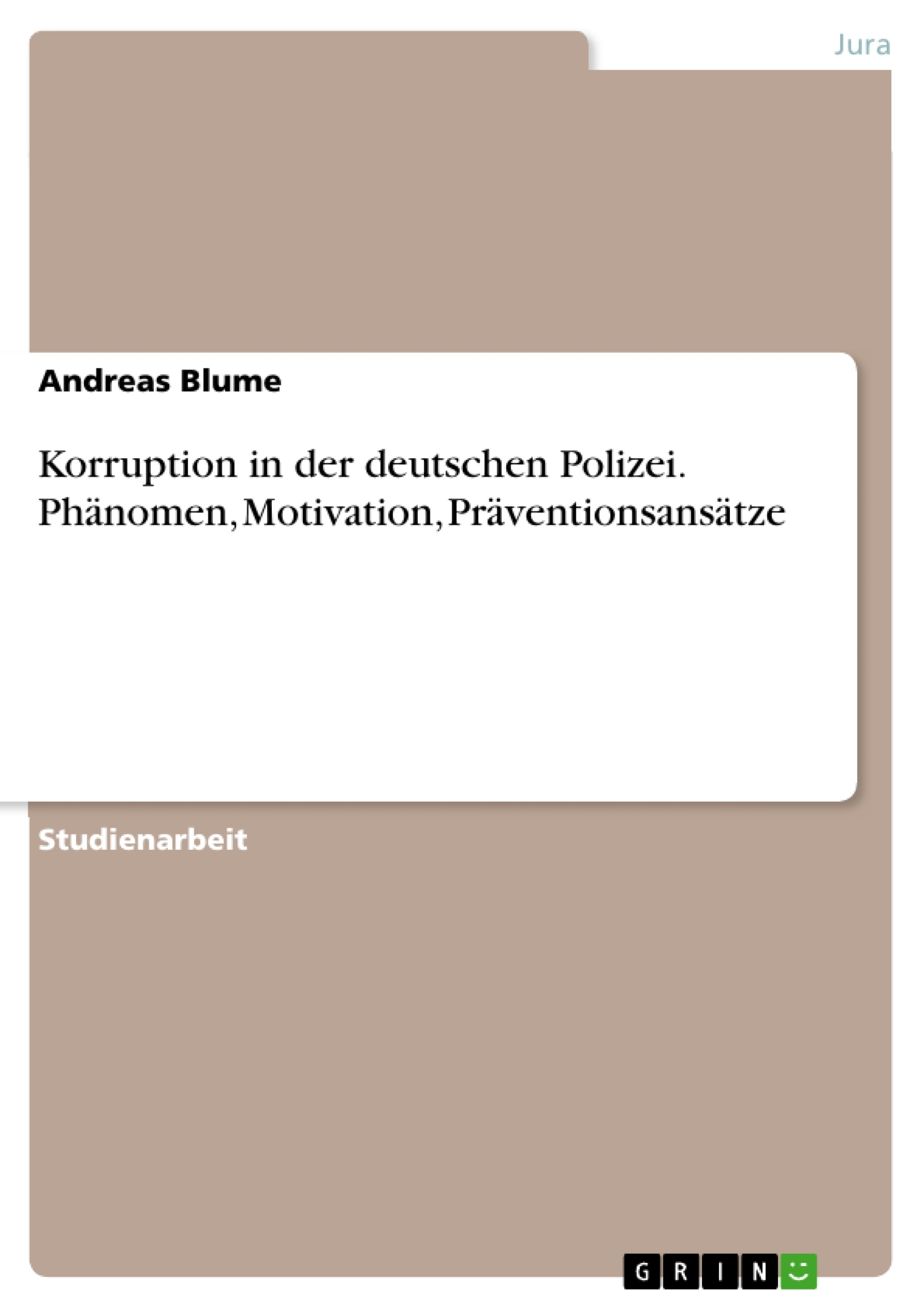Auch wenn es gerade die Polizei ist, die sich korruptes Verhalten in den eigenen Reihen nicht "leisten" kann, kommt Polizeikorruption auch in Deutschland vor. Und sie hat mannigfaltige Gesichter und in vielen Fällen signifikante Konsequenzen.
Diese Studie analysiert, welche Formen korruptiver Praktiken zu identifizieren sind, welch große Bandbreite an verschiedenen Motivationen zugrunde liegt und wie effektive Präventionskonzepte gestaltet werden können.
Als analytisches Gerüst dient das sogenannte Betrugsdreieck von D. Cressey, das besagt, dass dolose Handlungen immer dann wahrscheinlich werden, wenn die drei Faktoren Anreiz, Gelegenheit und Rechtfertigung zusammen kommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Phänomen Polizeikorruption
- 2.1. Definition Polizeikorruption
- 2.2. Quantitative Dimension
- 2.3. Korruptionstypen
- 2.3.1. Situative Korruption
- 2.3.2. Opportunistische Korruption
- 2.3.3. Systematische Korruption
- 3. Anreiz, Gelegenheit und Rechtfertigung
- 3.1. Der theoretische Bezugsrahmen
- 3.2. Täterprofile
- 3.3. Anreize und Motive
- 3.4. Gelegenheiten
- 3.4.1. Besonders kritische Funktionen
- 3.4.2. Institutionelle Schwächen
- 3.5. Rechtfertigung
- 4. Ansätze zur Prävention und Bekämpfung von Polizeikorruption
- 4.1. Das Präventions- und Bekämpfungskonzept der Innenministerkonferenz
- 4.2. Das Dreieck durchbrechen
- 4.2.1. Anreize reduzieren
- 4.2.2. Gelegenheiten verhindern
- 4.2.3. Rechtfertigung erschweren
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Phänomen der Polizeikorruption in Deutschland. Ziel ist es, dieses Phänomen darzustellen und zu analysieren, welche Faktoren – persönliche, situative und umfeldbezogene – die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Polizisten korrupt werden oder aktiv Korruption betreiben. Zusätzlich werden Ansätze für Gegenmaßnahmen skizziert.
- Definition und Ausmaß von Polizeikorruption in Deutschland
- Analyse der Anreize, Gelegenheiten und Rechtfertigungen für korruptes Verhalten von Polizisten
- Untersuchung von Täterprofilen und kritischen Funktionen innerhalb der Polizei
- Bewertung von Präventions- und Bekämpfungskonzepten
- Forschungsstand und Notwendigkeit weiterer Aufklärungsarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert zwei Fallbeispiele von Polizeikorruption in Deutschland und stellt die Relevanz des Themas in den Kontext des guten internationalen Vergleichs Deutschlands im Corruption Perception Index. Sie hebt den Widerspruch zwischen dem Idealbild des unbestechlichen deutschen Polizisten und der Realität von Polizeiskandalen hervor und begründet die Notwendigkeit, sich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Die Arbeit legt ihre Zielsetzung dar: die Darstellung und qualitative Analyse von Polizeikorruption, die Identifizierung von Faktoren, die korruptes Verhalten begünstigen, und die Skizzierung von Gegenmaßnahmen. Das „Dirty-Harry-Syndrom“ wird explizit ausgeschlossen.
2. Das Phänomen Polizeikorruption: Dieses Kapitel definiert den Begriff Polizeikorruption, beleuchtet seine quantitative Dimension und beschreibt verschiedene Korruptionstypen (situativ, opportunistisch, systematisch). Es liefert einen Überblick über das Ausmaß des Problems und differenziert die Arten der Korruption, die innerhalb der Polizei auftreten können. Die quantitative Dimension stellt vermutlich auf die Schwierigkeit hin, verlässliche Daten zu erhalten.
3. Anreiz, Gelegenheit und Rechtfertigung: Dieses Kapitel untersucht die Faktoren, die Polizeikorruption begünstigen. Es nutzt einen theoretischen Bezugsrahmen, analysiert Täterprofile, Anreize und Motive, und beleuchtet Gelegenheiten (kritische Funktionen und institutionelle Schwächen), sowie Rechtfertigungsstrategien von korrupten Polizisten. Es bietet einen detaillierten Einblick in die psychologischen und soziologischen Aspekte, die zum korrupten Verhalten beitragen können, und verbindet diese mit den strukturellen Gegebenheiten innerhalb der Polizei.
4. Ansätze zur Prävention und Bekämpfung von Polizeikorruption: Dieses Kapitel beschreibt Ansätze zur Prävention und Bekämpfung von Polizeikorruption. Es analysiert das Präventions- und Bekämpfungskonzept der Innenministerkonferenz und diskutiert Strategien, um das „Dreieck“ aus Anreiz, Gelegenheit und Rechtfertigung zu durchbrechen, indem Anreize reduziert, Gelegenheiten verhindert und Rechtfertigungen erschwert werden. Es bietet praktische Lösungsansätze und strategische Überlegungen zur Bekämpfung der Korruption.
Schlüsselwörter
Polizeikorruption, Deutschland, Korruptionstypen, Anreize, Gelegenheiten, Rechtfertigung, Prävention, Bekämpfung, Täterprofile, institutionelle Schwächen, kritische Funktionen, Forschungsstand, „Bad Cops“
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Polizeikorruption in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Phänomen der Polizeikorruption in Deutschland. Sie analysiert die Faktoren, die korruptes Verhalten von Polizisten begünstigen (persönliche, situative und umfeldbezogene Aspekte), und skizziert Ansätze für Gegenmaßnahmen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Ausmaß von Polizeikorruption in Deutschland; Analyse der Anreize, Gelegenheiten und Rechtfertigungen für korruptes Verhalten; Untersuchung von Täterprofilen und kritischen Funktionen innerhalb der Polizei; Bewertung von Präventions- und Bekämpfungskonzepten; Forschungsstand und Notwendigkeit weiterer Aufklärungsarbeit. Das "Dirty-Harry-Syndrom" wird explizit ausgeschlossen.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit umfasst fünf Kapitel: Eine Einleitung mit Fallbeispielen und Begründung der Relevanz des Themas; ein Kapitel zur Definition und Quantifizierung von Polizeikorruption und verschiedenen Korruptionstypen (situativ, opportunistisch, systematisch); ein Kapitel zur Analyse von Anreizen, Gelegenheiten und Rechtfertigungsmustern korrupten Verhaltens, inklusive Täterprofilen und kritischen Funktionen; ein Kapitel zu Präventions- und Bekämpfungskonzepten, inklusive der Analyse des Konzepts der Innenministerkonferenz und Strategien zum "Durchbrechen des Dreiecks" aus Anreiz, Gelegenheit und Rechtfertigung; und schließlich ein Fazit.
Welche Arten von Polizeikorruption werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen situativer, opportunistischer und systematischer Korruption. Die quantitative Dimension des Problems wird ebenfalls beleuchtet, wobei die Schwierigkeit, verlässliche Daten zu erhalten, hervorgehoben wird.
Welche Faktoren begünstigen Polizeikorruption laut der Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert Anreize, Gelegenheiten und Rechtfertigungen als zentrale Faktoren. Zu den Gelegenheiten gehören kritische Funktionen und institutionelle Schwächen innerhalb der Polizei. Die Arbeit untersucht auch Täterprofile und die psychologischen und soziologischen Aspekte korrupten Verhaltens.
Welche Präventions- und Bekämpfungsansätze werden diskutiert?
Die Hausarbeit diskutiert das Präventions- und Bekämpfungskonzept der Innenministerkonferenz und Strategien, um das "Dreieck" aus Anreiz, Gelegenheit und Rechtfertigung zu durchbrechen. Dies beinhaltet die Reduktion von Anreizen, die Verhinderung von Gelegenheiten und die Erschwerung von Rechtfertigungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Polizeikorruption, Deutschland, Korruptionstypen, Anreize, Gelegenheiten, Rechtfertigung, Prävention, Bekämpfung, Täterprofile, institutionelle Schwächen, kritische Funktionen, Forschungsstand, „Bad Cops“.
Was ist das Fazit der Hausarbeit?
Das Fazit wird im fünften Kapitel zusammengefasst und ist im vorliegenden Dokument nicht explizit aufgeführt. Es ist jedoch zu erwarten, dass es die wichtigsten Ergebnisse der Analyse von Polizeikorruption in Deutschland sowie Empfehlungen für zukünftige Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen zusammenfasst.
- Quote paper
- Dr. Andreas Blume (Author), 2015, Korruption in der deutschen Polizei. Phänomen, Motivation, Präventionsansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337934