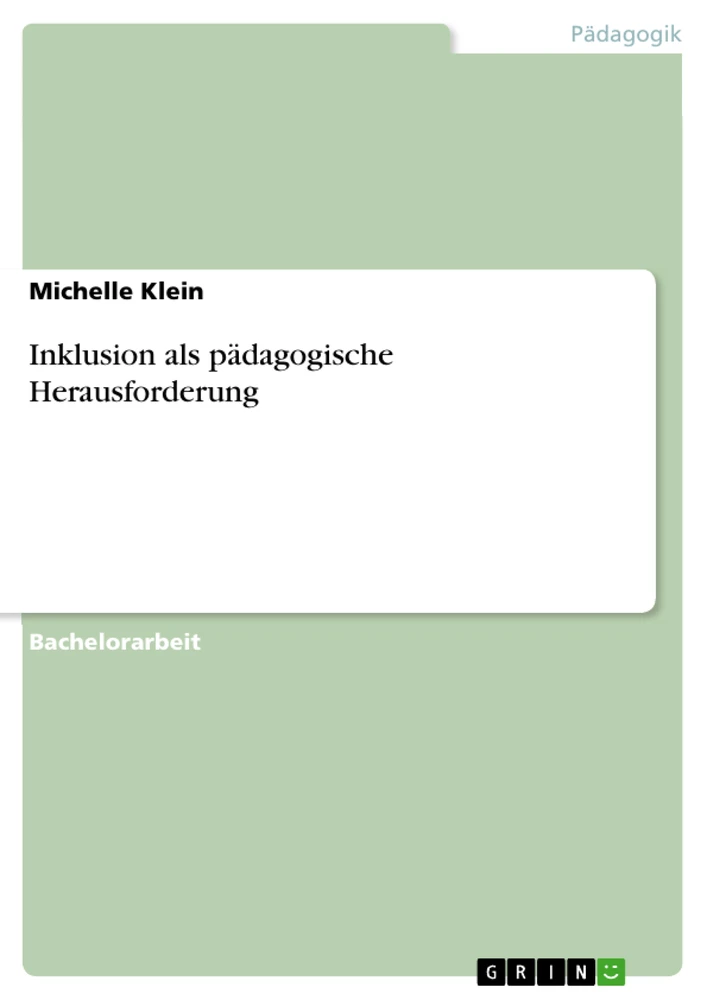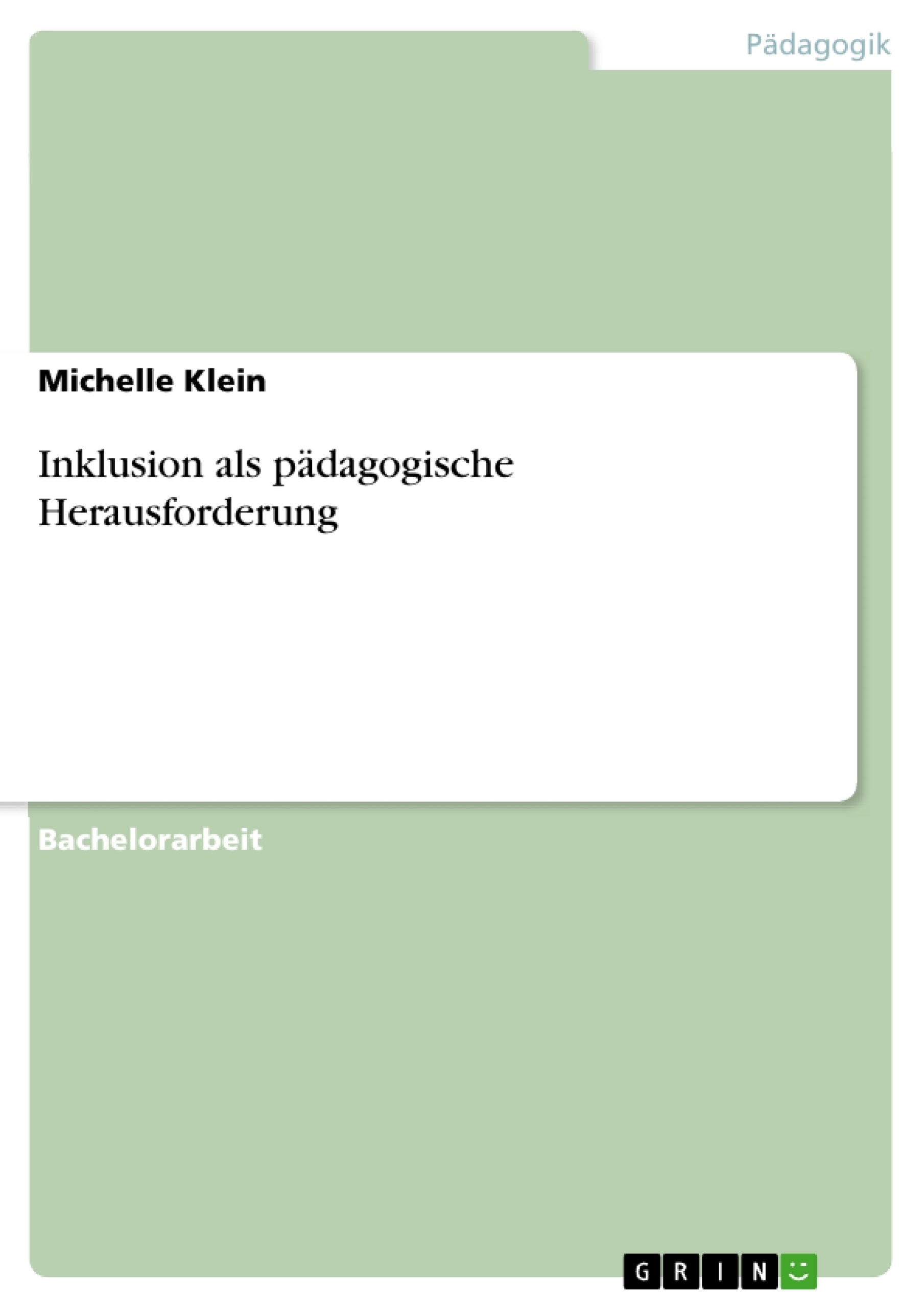Die Forschungskontroverse zeigt eine große Diskrepanz über die Art der Durchführung der Inklusion in Deutschland. Zusätzlich wird die Realisierung dadurch erschwert, dass die Bildungspolitik in Deutschland in der Länderhoheit liegt und aufgrund dessen keine flächendeckende, einheitliche Reform stattfinden kann. Trotz Vorreitern wie Schweden, die ihren Erfolg auch in den PISA Studien belegen, behält Deutschland eine skeptische Haltung gegenüber der Inklusion. Veränderungen zur Umsetzung einer inklusiven Beschulung, wie sie in Kapitel 4 aufgezeigt werden, erfolgen nur marginal.
Um diese Aspekte der Debatte zu beleuchten und die Frage zu beantworten, was Inklusion zu leisten hat, wird die folgende Arbeit die gesetzlichen Gegebenheiten, die Erwartungshaltung der UN-Behindertenrechtskonvention sowie die Umsetzung der Inklusion in Deutschland bei der Analyse berücksichtigen. Die Bestimmung der Begriffe Integration und Inklusion soll zu einem besseren Verständnis beitragen. Ein Vergleich der Bildungssysteme zwischen Deutschland, Italien und Schweden wird hergestellt, um mögliche Erfolgschancen, aber auch Schwierigkeiten der Inklusion aus verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen darzustellen. Das Aufzeigen der Vor- und Nachteile von Förderschulen und von integrativer oder inklusiver Beschulung, dient der Aufklärung und gibt einen Überblick über die differenten Fördermaßnahmen. Schließlich soll geklärt werden, worin die Herausforderungen als auch die Chancen der Inklusion für alle Beteiligten liegen, um demzufolge als Anregung zu einer erfolgreichen Umsetzung beizutragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und Sozialgesetzbuch IX
- UN-Behindertenrechtskonvention
- Bestimmung der Begriffe
- Integration
- Inklusion
- Zwischenfazit
- Inklusionsentwicklung in Europa
- Italien
- Schweden
- Deutschland
- Zwischenfazit
- Sonderpädagogische Fördermaßnahmen im Vergleich
- Förderschulen
- Sonderpädagogische Förderzentren
- Mobile sonderpädagogische Förderung
- Diagnose-Förderklassen
- Kooperationsklassen
- Integrationsklassen und Integrative Regelklassen
- Inklusive Schulen
- Herausforderung und Chancen von inklusiver Bildung
- Behinderte und nicht behinderte Kinder
- Lehrer
- Individualisierung des Unterrichts
- Nachteilsausgleich
- Schulen
- Index für Inklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Herausforderungen und Chancen inklusiver Bildung in Deutschland. Sie beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen, vergleicht die Inklusionsentwicklung in verschiedenen europäischen Ländern und analysiert verschiedene sonderpädagogische Fördermaßnahmen. Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis von Inklusion zu entwickeln und Anregungen für eine erfolgreiche Umsetzung zu liefern.
- Gesetzliche Grundlagen der Inklusion in Deutschland
- Vergleich der Inklusionsentwicklung in Deutschland, Italien und Schweden
- Analyse verschiedener sonderpädagogischer Fördermaßnahmen
- Herausforderungen und Chancen inklusiver Bildung für Schüler, Lehrer und Schulen
- Bewertung der Erfolgsaussichten inklusiver Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Vor- und Nachteilen inklusiver Beschulung für behinderte und nicht-behinderte Kinder. Sie beleuchtet die kontroverse Debatte um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland und die Schwierigkeiten einer flächendeckenden Inklusionsreform aufgrund der Länderhoheit im Bildungssystem. Die Arbeit skizziert ihren Ansatz, indem sie gesetzliche Grundlagen, die Inklusionsentwicklung in verschiedenen Ländern und verschiedene Fördermaßnahmen analysiert, um die Herausforderungen und Chancen von Inklusion zu beleuchten. Die methodische Vorgehensweise und die verwendeten Quellen werden ebenfalls kurz erläutert.
Gesetzliche Grundlagen: Dieses Kapitel untersucht die gesetzlichen Grundlagen der Inklusion in Deutschland, beginnend mit dem Grundgesetz, welches die Nichtbenachteiligung von Menschen mit Behinderung als Staatsziel festschreibt, jedoch keine einklagbaren Grundrechte garantiert. Das Sozialgesetzbuch IX wird ebenfalls analysiert, welches die gemeinsame Betreuung behinderter und nicht-behinderter Kinder anstrebt, jedoch die weiterhin bestehende Segregation aufzeigt. Die UN-Behindertenrechtskonvention wird als wichtiger internationaler Rahmen für die inklusive Bildung vorgestellt, und ihre Bedeutung für die deutsche Bildungspolitik wird hervorgehoben. Das Kapitel betont die Diskrepanz zwischen dem gesetzlich verankerten Anspruch auf Inklusion und der Realität der Schulpraxis in Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Inklusive Bildung in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Herausforderungen und Chancen inklusiver Bildung in Deutschland. Sie beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen, vergleicht die Inklusionsentwicklung in verschiedenen europäischen Ländern (Italien, Schweden, Deutschland), analysiert verschiedene sonderpädagogische Fördermaßnahmen (Förderschulen, Förderzentren, Integrationsklassen, inklusive Schulen) und bewertet die Erfolgsaussichten inklusiver Bildung für Schüler, Lehrer und Schulen. Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und ein Stichwortverzeichnis (implizit durch die Gliederung erkennbar).
Welche gesetzlichen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (insbesondere die Nichtbenachteiligung von Menschen mit Behinderung als Staatsziel), das Sozialgesetzbuch IX (gemeinsame Betreuung behinderter und nicht-behinderter Kinder) und die UN-Behindertenrechtskonvention als internationalen Rahmen für inklusive Bildung. Die Diskrepanz zwischen gesetzlichem Anspruch und Schulpraxis wird hervorgehoben.
Welche Länder werden im Vergleich zur Inklusionsentwicklung herangezogen?
Die Arbeit vergleicht die Inklusionsentwicklung in Deutschland, Italien und Schweden.
Welche sonderpädagogischen Fördermaßnahmen werden verglichen?
Verglichen werden Förderschulen, sonderpädagogische Förderzentren (mit mobilem sonderpädagogischen Unterricht, Diagnose-Förderklassen und Kooperationsklassen), Integrationsklassen, integrative Regelklassen und inklusive Schulen.
Welche Herausforderungen und Chancen inklusiver Bildung werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen für behinderte und nicht-behinderte Kinder, Lehrer (Individualisierung des Unterrichts, Nachteilsausgleich), Schulen und das gesamte Bildungssystem. Der "Index für Inklusion" wird ebenfalls erwähnt.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht die Vor- und Nachteile inklusiver Beschulung für behinderte und nicht-behinderte Kinder im Kontext der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland und den Schwierigkeiten einer flächendeckenden Inklusionsreform.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die methodische Vorgehensweise wird in der Einleitung kurz erläutert (genaue Details sind nicht im vorliegenden Auszug enthalten). Die Arbeit analysiert gesetzliche Grundlagen, vergleicht internationale Entwicklungen und analysiert verschiedene Fördermaßnahmen.
- Quote paper
- Michelle Klein (Author), 2014, Inklusion als pädagogische Herausforderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337801