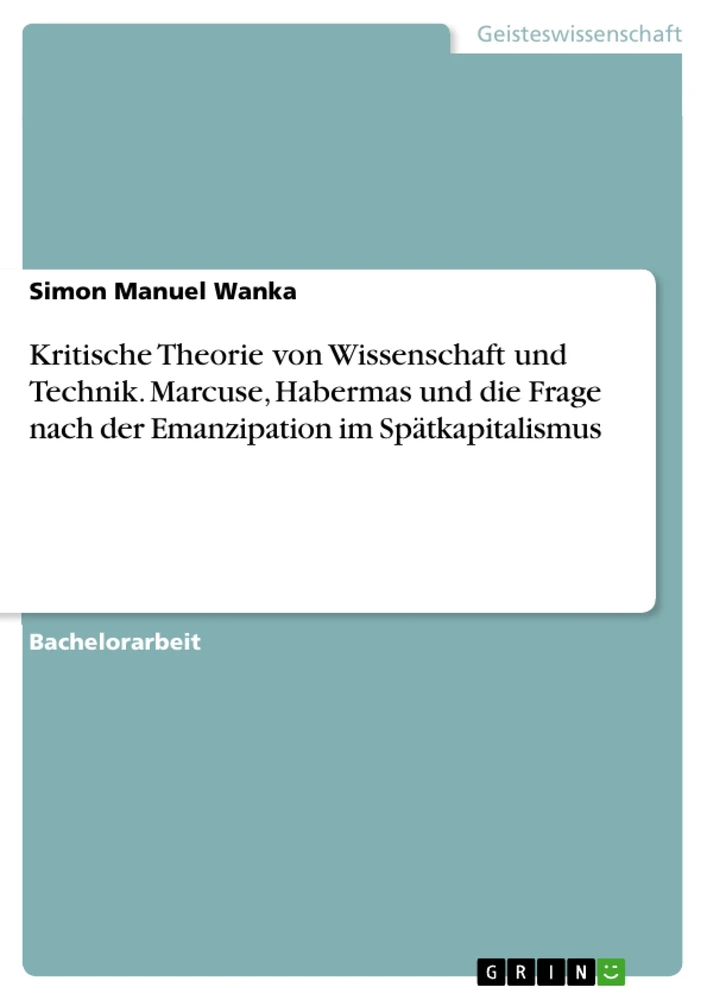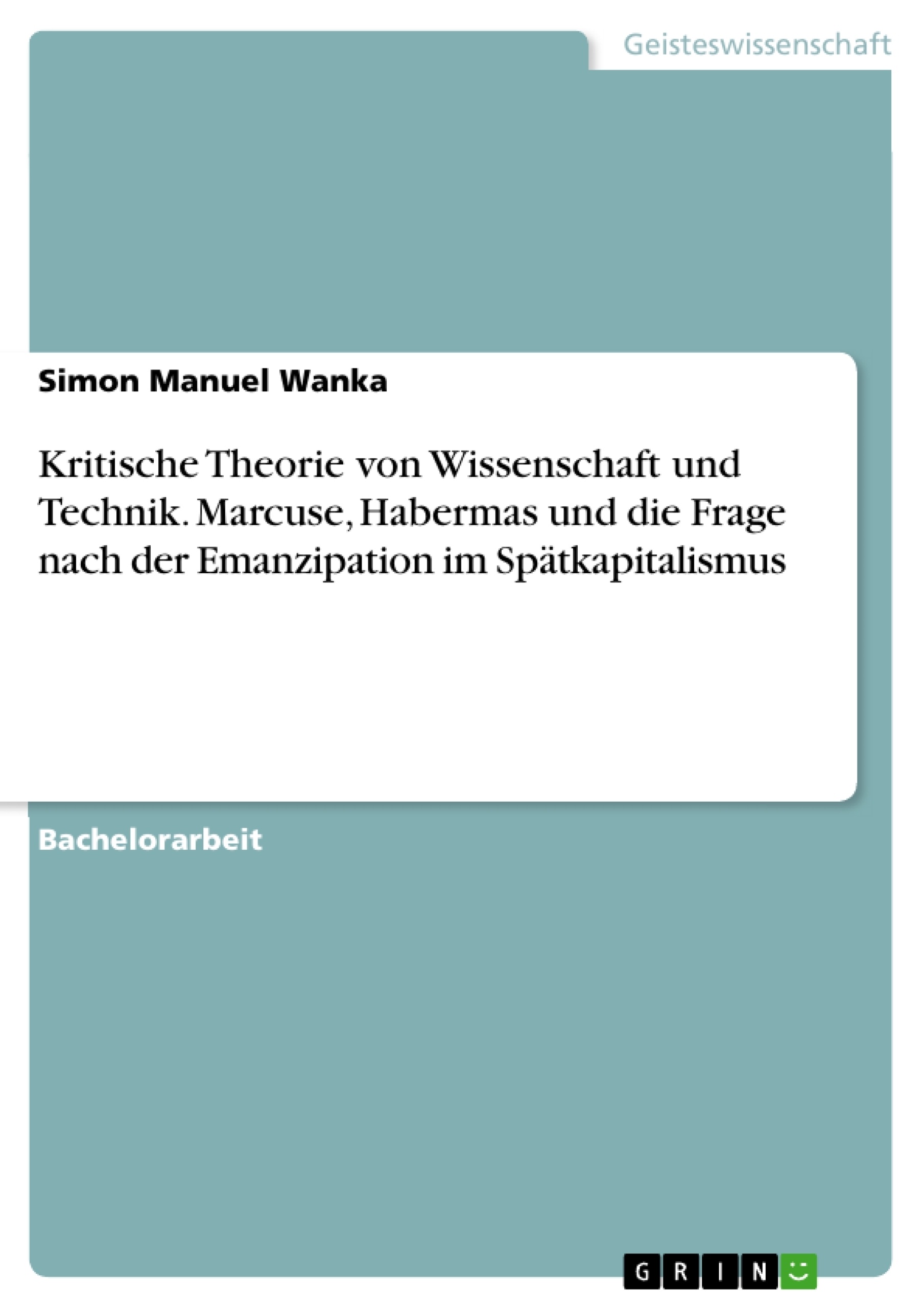Mitte der 1960er Jahre entwarfen Herbert Marcuse und Jürgen Habermas in einer sehr ähnlichen Art und Weise ein Bild der spätkapitalistischen Gesellschaft. Dieses ist gekennzeichnet durch die Nivellierung von gegensätzlichen Klasseninteressen, der kulturindustriellen Beschränktheit gesellschaftlicher Erfahrungen, dem Einbinden jedweder Opposition ins Bestehende und damit einhergehend die Identifikation des Individuums mit bestehenden Normen und Werten. Es zeigt sich eine Gesellschaft, die schlechterdings ein ‚Ende der Geschichte’ erreicht zu haben scheint. Die Motoren der spätkapitalistischen Gesellschaft sind dabei Wissenschaft und Technik, in denen sich die von Horkheimer und Adorno begrifflich gefasste instrumentelle Vernunft kristallisiert. Herrschaft ist dabei nicht aufgehoben, sie ist nicht mehr erfahrbar, sie ist aus dem Bewusstsein der Unterworfenen verdrängt.
Beide Autoren stehen in einer Theorietradition, die von Karl Marx ausgehend, über Georg Lukács und schließlich mit Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in der frühen Kritischen Theorie, die Frage nach der Analyse gesellschaftlicher Zusammenhänge stellt. Dabei ist das so gewonnene Wissen nicht reiner (wissenschaftlicher) Selbstzweck, sondern zielt auf die Aufhebung bestehender Ungerechtigkeiten ab. So soll sich im Folgenden die Frage gestellt werden, inwiefern der Entwurf eines gesellschaftlichen Zustands im Spätkapitalismus, den Marcuse und Habermas in weiten Teilen identisch aufmachen, emanzipatorisches Potential beinhalt. Die zentrale Rolle in der Bestimmung der Gesellschaft, wie sie der Wissenschaft und der Technik in ihren Entwürfen zukommt, lässt dann auch noch die Frage nach einem kritischen Blick auf diese ‚Ideologien’ aufkommen.
Während in den 1960er Jahren Marcuses These, dass Technologie schon Herrschaft sei, hauptsächlich ablehnend diskutiert wurde, so geriet sie in den 1970er und 1980er Jahren fast schon in Vergessenheit. Die utopischen Hoffnungen Marcuses standen in einen zu krassen Gegensatz zur Philosophie dieser Jahre. Es zeigt sich, dass beide Denker einen Bruch markieren, auf der einen Seite zu den Marxschen Grundlagen hin, auf der anderen Seite in der Philosophietradition der Kritischen Theorie selbst. In der Bewertung des Stellenwerts der Produktivkraft in der technisierten Welt, kommen beide zu demselben Ergebnis, das aber ein anderes als bei Marx ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. DIE VERDINGLICHUNG DER WELT
- 2.A. MARX, LUKÁCS UND DAS GEHEIMNIS DER WARENFORM
- 2.B. HORKHEIMER UND ADORNO: KULTURINDUSTRIE UND INSTRUMENTELLE VERNUNFT
- 3. MARCUSES PARALYSIERTE KRITIK
- 3.A. DIE GESELLSCHAFT OHNE WIDERSPRUCH
- 3.B. TECHNISCHE RATIONALITÄT ALS NEUE VERNUNFT
- 3.C. TECHNIK UND BEFREIUNG
- 4. HABERMAS - LEBENSWELT IM TECHNISCHEN FORTSCHRITT
- 4.A. ARBEIT UND INTERAKTION
- 4.B. SPANNUNG ZWISCHEN ZWEI HANDLUNGSSYSTEMEN: VON DER TRADITIONELLEN ZUR STAATLICH GEREGELTEN GESELLSCHAFT
- 4.C. TECHNIK UND DER HERRSCHAFTSFREIE DISKURS
- 5. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwiefern die Entwürfe einer spätkapitalistischen Gesellschaft, die von Herbert Marcuse und Jürgen Habermas im Kontext der Kritischen Theorie formuliert wurden, emanzipatorisches Potential beinhalten. Sie beleuchtet die Rolle von Wissenschaft und Technik in diesen Entwürfen und analysiert, wie diese die Verdinglichung der Welt, die instrumentelle Vernunft und die Frage nach dem herrschaftsfreien Diskurs beeinflussen.
- Verdinglichung der Welt und Warenfetischismus
- Instrumentelle Vernunft und technologischer Fortschritt
- Kritik an der spätkapitalistischen Gesellschaft
- Emanzipation und Befreiungspotential
- Herrschaftsfreier Diskurs und die Rolle der Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2.a: Marx, Lukács und das Geheimnis der Warenform: Dieses Kapitel untersucht die Marx'sche Kritik an der Warenform und die Weiterentwicklung dieser Kritik durch Georg Lukács. Es beleuchtet die Konzepte der Verdinglichung und des Fetischismus als zentrale Elemente der gesellschaftlichen Bewusstseinsform im Kapitalismus.
- Kapitel 2.b: Horkheimer und Adorno: Kulturindustrie und instrumentelle Vernunft: Dieser Abschnitt erklärt die Konzepte der Kulturindustrie und der instrumentellen Vernunft, die von Horkheimer und Adorno entwickelt wurden. Es zeigt, wie der technologische Fortschritt nicht automatisch zu einer Befreiung des Menschen führt, sondern die Beherrschung von Mensch und Natur gleichermaßen bestimmt.
- Kapitel 3.a: Die Gesellschaft ohne Widerspruch: Dieses Kapitel befasst sich mit Marcuses These der Technologie als Herrschaft in einer Gesellschaft ohne Opposition. Es analysiert die Strukturen der spätkapitalistischen Gesellschaft, die eine effektive Kritik und Widerstandsfähigkeit verhindern.
- Kapitel 3.b: Technische Rationalität als neue Vernunft: Hier wird die Rolle der technischen Rationalität als vorherrschende Vernunft in der spätkapitalistischen Gesellschaft untersucht, die nach Marcuse zu einer Paralysierung der Kritik führt.
- Kapitel 3.c: Technik und Befreiung: Dieses Kapitel erörtert die Frage, ob und wie die technologische Entwicklung zur Befreiung des Menschen beitragen kann. Es analysiert Marcuses Hoffnungen auf eine Veränderung der Richtung des Fortschritts, die die Struktur der Wissenschaft selbst beeinflussen könnte.
- Kapitel 4.a: Arbeit und Interaktion: Dieses Kapitel stellt die Habermas'sche Unterscheidung zwischen Arbeit (zweckrationales Handeln) und Interaktion (kommunikatives Handeln) vor und erläutert, wie diese Unterscheidung die Wandlung der Gesellschaftsformationen im Spätkapitalismus beeinflusst.
- Kapitel 4.b: Spannung zwischen zwei Handlungssystemen: Von der traditionellen zur staatlich geregelten Gesellschaft: Dieser Abschnitt analysiert die Spannung zwischen traditioneller und staatlich geregelter Gesellschaft, die durch die zunehmende Rationalisierung und Technisierung der Moderne entsteht.
- Kapitel 4.c: Technik und der herrschaftsfreie Diskurs: Dieses Kapitel untersucht Habermas' Konzept eines herrschaftsfreien Diskurses, der durch die Rückeroberung des instrumentellen Rahmens der Gesellschaft durch Kommunikation erreicht werden soll.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Kritischen Theorie von Wissenschaft und Technik im Spätkapitalismus, insbesondere auf die Beiträge von Herbert Marcuse und Jürgen Habermas. Zentrale Themen sind die Verdinglichung der Welt, die instrumentelle Vernunft, die Kritik an der spätkapitalistischen Gesellschaft, die Rolle von Technologie, der herrschaftsfreie Diskurs und die Frage nach Emanzipation und Befreiungspotential.
- Quote paper
- Simon Manuel Wanka (Author), 2013, Kritische Theorie von Wissenschaft und Technik. Marcuse, Habermas und die Frage nach der Emanzipation im Spätkapitalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337671