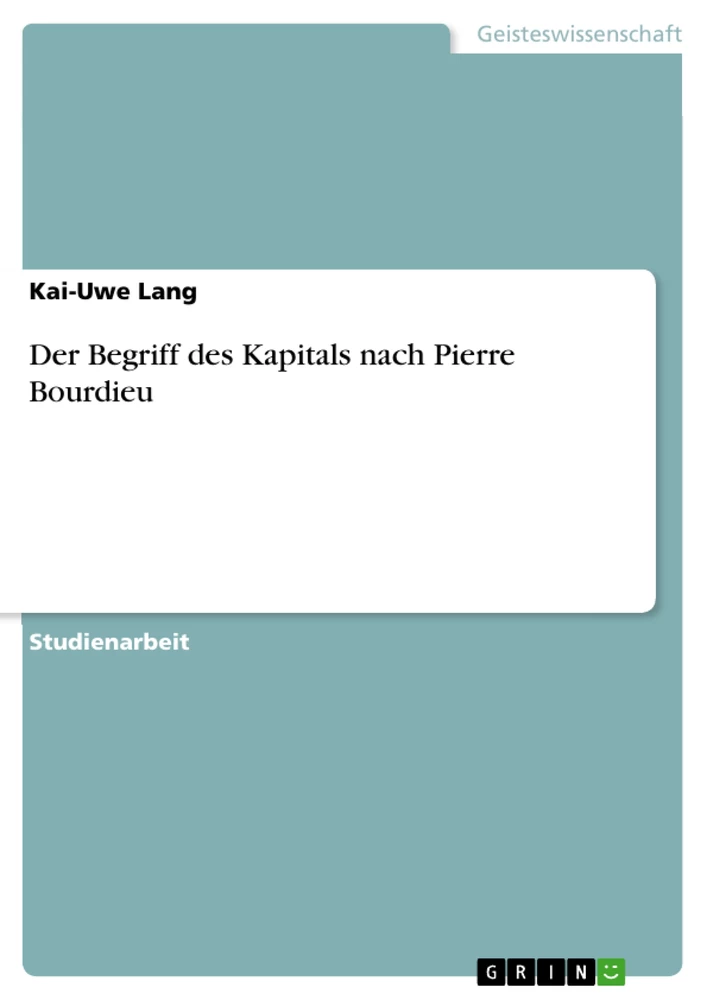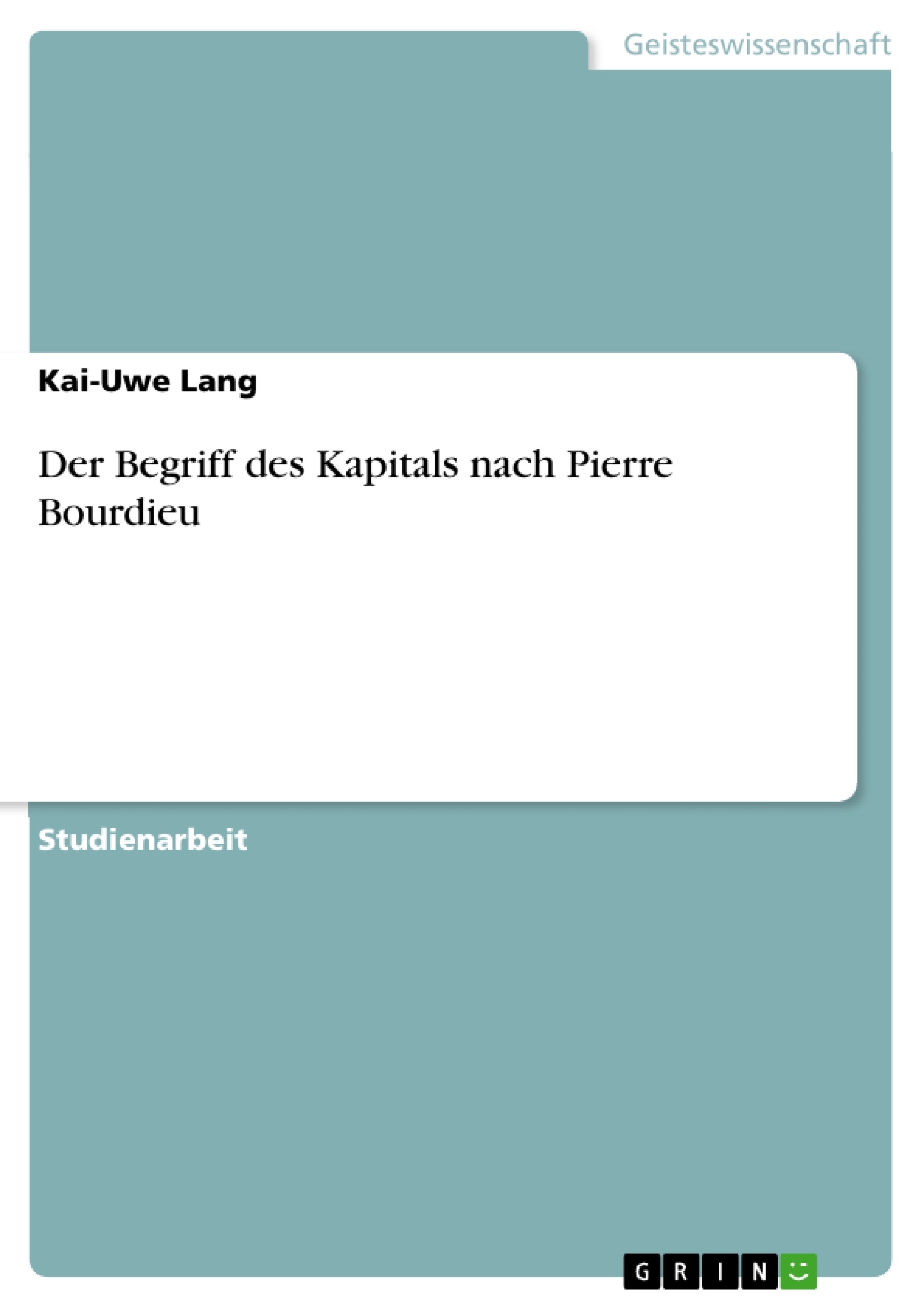Im Mittelpunkt vieler soziologischer Fragestellungen, wie etwa im Bereich des Bildungswesens, der sozialen Ungleichheit oder der Familienstrukturen, bildet die Berufsgruppe der Eltern eine zentrale Erklärungsgröße. Die Erwerbstätigkeit der Eltern informiert über Einkommen, Macht und soziale Stellung der Familie und damit auch über die soziale Herkunft der Lernenden. Diesem Ansatz nach wird die soziale Herkunft als eine ökonomische Komponente verstanden und in einer ökonomischen Einheit wie dem Einkommen der Eltern der Schülerinnen und Schüler berechnet.
Erst seit einigen Jahren zeigt sich in der Soziologie, dass der Begriff Kapital als alleinige Verwendung in der Ökonomie nicht umfassend verwendet wird. Als einer der namhaftesten Vertreter legte der französische Soziologe Pierre Bourdieus (1930-2002) dar, dass eine Vielzahl weiterer Aspekte dem Kapital und seinen Eigenschaften zugeordnet werden muss. So verwendet Bourdieu den Begriff des Kapitals in Verbindung mit sozialer Ungleichverteilung von Macht und zeigt auf, warum eine Erweiterung des Kapitalbegriffs notwendig ist.
Statt eines Überblicks über mehrere Theorien zur Ungleichheitsforschung in Bezug auf die soziale Herkunft und Bildungschancen aufzuzeigen, bedient sich diese vorliegende Abhandlung eines radikaleren Ansatzes, dem des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Um diese Thematik theoretisch ausreichend zu beschreiben, bedarf es zunächst den Begriff des Kapitals zu definieren sowie die verschiedenen Arten von Kapital nach der Interpretation Bourdieus aufzuzeigen. Anhand dieser Grundlage wird im Fazit eine kritische Schlussbetrachtung des Bourdieuschen Konzeptes im Zusammenhang mit sozialer Herkunft und Bildungschancen - trotz formaler Chancengleichheit - vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff des Kapitals
- Das ökonomische Kapital
- Das kulturelle Kapital
- Inkorporiertes Kulturkapital
- Objektiviertes Kulturkapital
- Institutionalisiertes Kulturkapital
- Das soziale Kapital
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Kapitalbegriff nach Pierre Bourdieu im Kontext der sozialen Ungleichheit und Bildungschancen in Deutschland. Sie analysiert, wie Bourdieus Kapitalbegriff die anhaltende Debatte um soziale Ungerechtigkeit im Bildungssystem erklärt. Der Fokus liegt auf der Darstellung der verschiedenen Kapitalformen und ihrer Auswirkungen auf den Bildungserfolg.
- Bourdieus Kapitalbegriff und seine Erweiterung über den ökonomischen Aspekt hinaus
- Die drei Kapitalarten (ökonomisch, kulturell, sozial) und ihre Interdependenzen
- Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, Kapitalbesitz und Bildungserfolg
- Kritik an der These der formalen Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem
- Die Rolle der elterlichen Berufsgruppe als Indikator für soziale Herkunft und Kapital
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die anhaltende Debatte um soziale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem, ausgelöst durch die PISA-Studien. Sie argumentiert, dass trotz formaler Chancengleichheit, der soziale Hintergrund weiterhin einen erheblichen Einfluss auf den Bildungserfolg hat. Der Text kündigt die Auseinandersetzung mit Pierre Bourdieus Kapitalbegriff als zentralen Erklärungsansatz an, um dieses Problem zu analysieren. Die Einleitung verweist auf die Notwendigkeit, den Kapitalbegriff zu definieren und die verschiedenen Kapitalformen nach Bourdieu zu untersuchen, um schließlich eine kritische Schlussbetrachtung im Fazit vorzunehmen.
Der Begriff des Kapitals: Dieses Kapitel definiert den Kapitalbegriff nach Bourdieu. Es geht über die rein ökonomische Definition von Kapital hinaus und erweitert den Begriff auf soziale und kulturelle Ressourcen. Bourdieu argumentiert, dass Kapital in seinen verschiedenen Formen (ökonomisch, kulturell und sozial) die ungleiche Machtverteilung in der Gesellschaft widerspiegelt. Der Abschnitt betont die mehrdimensionale Sichtweise Bourdieus und widerlegt die Kritik, dass sein Kapitalbegriff zu ökonomistisch sei. Die verschiedenen Formen des Kapitals werden kurz angerissen, um im Folgenden detaillierter untersucht zu werden.
Schlüsselwörter
Pierre Bourdieu, Kapital, soziales Kapital, kulturelles Kapital, ökonomisches Kapital, soziale Ungleichheit, Bildung, Bildungschancen, soziale Herkunft, PISA, IGLU, Chancengleichheit.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Bourdieus Kapitalbegriff und soziale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text untersucht den Kapitalbegriff nach Pierre Bourdieu und seine Relevanz für die Erklärung sozialer Ungleichheit und ungleicher Bildungschancen im deutschen Bildungssystem. Er analysiert, wie die verschiedenen Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital) den Bildungserfolg beeinflussen und die anhaltende Debatte um soziale Gerechtigkeit im Bildungsbereich beleuchten.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: Bourdieus Kapitalbegriff und seine Erweiterung über den rein ökonomischen Aspekt hinaus; die drei Kapitalarten (ökonomisch, kulturell, sozial) und ihre Wechselwirkungen; den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, Kapitalbesitz und Bildungserfolg; Kritik an der These der formalen Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem; und die Rolle der elterlichen Berufsgruppe als Indikator für soziale Herkunft und Kapital.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition des Kapitalbegriffs nach Bourdieu, eine Zusammenfassung der Kapitel, sowie eine Auflistung der Schlüsselwörter. Die Einleitung führt in die Problematik der sozialen Ungleichheit im deutschen Bildungssystem ein und kündigt die Analyse mit Bourdieus Kapitalbegriff an. Das Hauptkapitel definiert den Kapitalbegriff und differenziert die verschiedenen Kapitalformen. Die Kapitelzusammenfassung bietet eine kurze Übersicht über den Inhalt.
Was ist Bourdieus Kapitalbegriff?
Der Text erklärt Bourdieus Kapitalbegriff als ein Konzept, das über die rein ökonomische Definition von Kapital hinausgeht. Bourdieu erweitert den Begriff auf soziale und kulturelle Ressourcen. Er argumentiert, dass Kapital in seinen verschiedenen Formen (ökonomisch, kulturell und sozial) die ungleiche Machtverteilung in der Gesellschaft widerspiegelt. Der Text betont die mehrdimensionale Sichtweise Bourdieus und widerlegt die Kritik, dass sein Kapitalbegriff zu ökonomistisch sei.
Welche Arten von Kapital unterscheidet Bourdieu?
Bourdieu unterscheidet drei Arten von Kapital: ökonomisches Kapital (finanzielle Ressourcen), kulturelles Kapital (Bildung, Wissen, kulturelles Verständnis) und soziales Kapital (Netzwerke und Beziehungen). Der Text analysiert diese drei Kapitalarten und ihre Interdependenzen im Kontext des deutschen Bildungssystems.
Welche Rolle spielt die soziale Herkunft im Text?
Die soziale Herkunft spielt eine zentrale Rolle, da sie stark mit dem Kapitalbesitz korreliert. Der Text argumentiert, dass trotz formaler Chancengleichheit die soziale Herkunft weiterhin einen erheblichen Einfluss auf den Bildungserfolg hat, da sie den Zugang zu den verschiedenen Kapitalformen beeinflusst.
Welche Schlussfolgerung zieht der Text?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass Bourdieus Kapitalbegriff ein wertvolles Instrument ist, um die anhaltende soziale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem zu erklären. Die unterschiedliche Ausstattung mit verschiedenen Kapitalformen führt zu ungleichen Bildungschancen und reproduziert soziale Ungleichheit.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Text relevant?
Die Schlüsselbegriffe des Textes sind: Pierre Bourdieu, Kapital (ökonomisches, kulturelles, soziales), soziale Ungleichheit, Bildung, Bildungschancen, soziale Herkunft, PISA, IGLU, Chancengleichheit.
- Quote paper
- Kai-Uwe Lang (Author), 2015, Der Begriff des Kapitals nach Pierre Bourdieu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337618