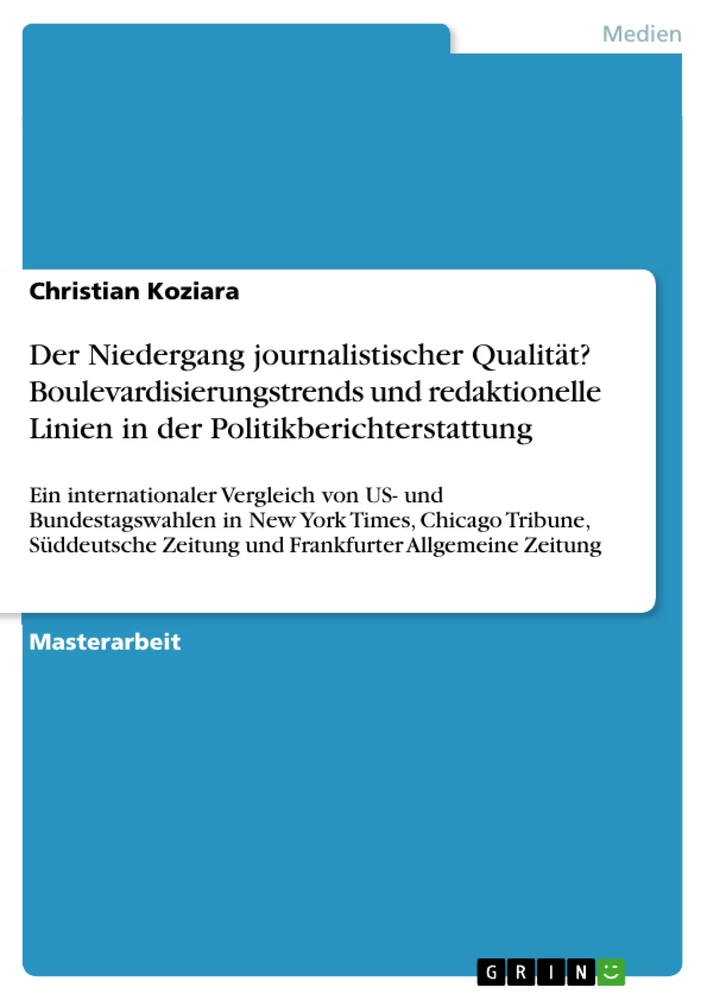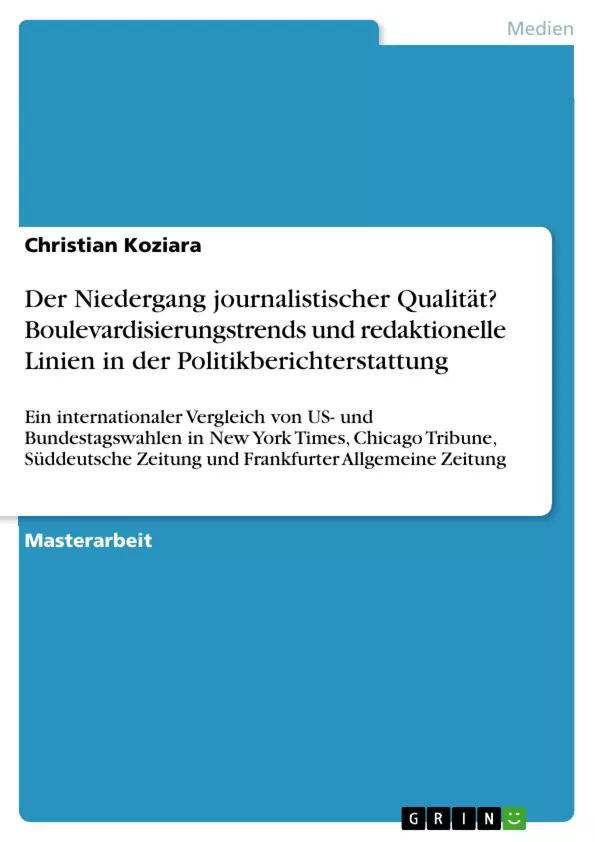„Angela Merkel weiter mit ‚Angie’ unterwegs“, titelte eine deutsche Zeitung und meinte damit den Song der Rolling Stones, mit dem die damalige Kanzlerkandidatin ihre Wahlkampfauftritte ausschmückte. Wenige Tage später meldete eine andere Zeitung, dass Doris Schröder-Köpf, die Ehefrau des deutschen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, „Merkelsche Kinder vermisst.“ In einem anderen Land widmete ein Printmedium Präsidentschaftsanwärter John McCains Tochter Megan einen längeren Artikel und beschrieb ihre persönlichen Gefühle im Wahlkampf. Und ein anderes Blatt in diesem Land machte auf der Titelseite drei Wochen danach mit einem seitengroßen Bild auf, die Überschrift plakativ, rund ein Viertel der Seite einnehmend: „Obama – Our next president“.
Diese Beispiele greifen etwas auf, was in der heutigen Zeit mehr denn je diskutiert wird: die Boulevardisierung der Medienlandschaft. Die oben genannten sind zwar nur einzelne Beispiele, doch Brisanz verliehen wird ihnen aufgrund der Fundorte. Sie stammen nicht aus irgendwelchen Boulevardblättern; alle vier stammen aus dem Politikteil überregionaler Qualitätszeitungen im Rahmen der Wahlkampfberichterstattung. Die erstgenannte Meldung erschien in der Süddeutschen Zeitung am 24. August 2005, die zweite in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (1. September 2005). Beispiel Nummer drei und vier stammen aus den USA, dafür verantwortlich zeichneten sich die New York Times und die Chicago Tribune am 16. Oktober beziehungsweise am 5. November 2008.
Für die USA überrascht das Auftreten boulevardesker Merkmale weniger, da dort die gesamte Medienlandschaft generell als boulevardisiert gilt und es demnach als wenig überraschend aufstößt, dass sich selbst Qualitätszeitungen im Politikressort dieser Maxime unterwerfen.
Die Vermutung, dass im Zuge der Amerikanisierung die ursprünglich in den USA beheimatete Boulevardisierung in andere Mediensysteme streut, ist nicht neu. Dass inzwischen auch in der deutschen Medienlandschaft Boulevardisierung um sich greift, ist ebenfalls nicht neu. Neu ist, dass auch deutsche Qualitätszeitungen diesem Trend folgen und sich scheinbar boulevardeske Züge aneignen. Düstere Zeiten für den Journalismus? Der Niedergang journalistischer Qualität?
Diesen und weiteren Fragen geht diese Arbeit nach.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
-
I. Theorie
- Wer inszeniert wen? Wechselwirkungen und symbiotische Beziehungen im medialen und politischen System
- Inszenierungsleistungen der Medien und der Politik
- Interdependenzen zwischen medialem und politischem System
- Aus dem Blickwinkel der Medien
- Boulevardisierung
- Anfang, Ursprung, Entwicklung und Forschungsstand
- Was ist Boulevardisierung?
- Infotainment und seine Verwandten
- Visualisierung als Stilmittel
- Personalisierung – (k)ein Element der Boulevardisierung
- Weitere Boulevardisierungselemente und offene Fragen
- Boulevardisierung in überregionalen Qualitätszeitungen?
- Warum Boulevardisierung?
- Boulevardisierung aufgrund des journalistischen Rollenverständnisses?
- Redaktionelle Linien
- Was ist News Bias und wie entsteht es?
- Liberal Bias? Zum Einfluss der redaktionellen Linie
- Kommentare als deutlichste Offenbarung der redaktionellen Linie
- Medieneinfluss auf Wahlausgänge
- Exkurs: Die untersuchten Wahlen - Sonderfälle?
- Zusammenfassung der Theorie
-
II. Empirie
- Qualitätszeitungen
- Chicago Tribune
- New York Times
- Süddeutsche Zeitung
- Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Operationalisierung, Forschungsdesign, Datengrundlage
- Forschungsfragen und Annahmen
- Boulevardisierung
- Redaktionelle Linien
- Ergebnisse
- Boulevardisierung
- Inhaltliche Merkmale
- Visuelle Merkmale
- Sprachlich-stilistische Merkmale
- Drei Ebenen unter einem Hut
- Länderspezifischer und blattideologischer Vergleich
- Redaktionelle Linien
- Die US-Zeitungen
- Die deutschen Zeitungen
- Ausgewogenheit - ein Fremdwort?!
- Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
- Zusammenfassung der Empirie
- Schlussbemerkungen
-
III. Anhang
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis II
- Codebuch
- Berechnung von Boulevardisierungsgrad und Gesamttendenz
- Intra-Coder-Reliabilitätsanalyse
- Codierbogen
- Eidesstattliche Erklärung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen der Boulevardisierung in der Politikberichterstattung von überregionalen Qualitätszeitungen. Ziel ist es, den Begriff der Boulevardisierung zu definieren und verschiedene Ebenen zu erfassen. Dabei werden die Einflussfaktoren auf die Boulevardisierung untersucht, insbesondere im Kontext der Wahlkampfberichterstattung. Die Arbeit analysiert die Berichterstattung der New York Times, Chicago Tribune, Süddeutsche Zeitung und Frankfurter Allgemeine Zeitung über die US-Wahl 2008 und die Bundestagswahl 2005, um internationale Vergleiche zu ermöglichen.
- Definition und Analyse von Boulevardisierungsebenen
- Untersuchung der Einflussfaktoren auf Boulevardisierung
- Internationaler Vergleich der Politikberichterstattung
- Analyse der redaktionellen Linien in den untersuchten Zeitungen
- Bewertung des Einflusses von Boulevardisierung auf die politische Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und die Forschungsfragen erläutert. Im ersten Teil werden die theoretischen Grundlagen erörtert, darunter der Begriff der Boulevardisierung, die Wechselwirkungen zwischen Medien und Politik und die Rolle der redaktionellen Linien. Der zweite Teil widmet sich der empirischen Analyse der Politikberichterstattung in den vier ausgewählten Zeitungen. Die Ergebnisse werden im dritten Teil zusammengefasst und interpretiert. Die Arbeit schließt mit Schlussbemerkungen und einem Literaturverzeichnis.
Schlüsselwörter
Boulevardisierung, Politikberichterstattung, Qualitätszeitungen, Wahlkampf, Redaktionelle Linien, Medien und Politik, News Bias, Internationaler Vergleich, USA, Deutschland, New York Times, Chicago Tribune, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, US-Wahl 2008, Bundestagswahl 2005.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Boulevardisierung der Medien?
Es beschreibt den Trend, dass auch Qualitätsmedien zunehmend Stilmittel des Boulevards wie Personalisierung, Visualisierung und Infotainment nutzen.
Übernehmen auch deutsche Qualitätszeitungen diesen Trend?
Ja, die Arbeit zeigt Beispiele aus der Süddeutschen Zeitung und der FAZ, die im Wahlkampf vermehrt auf personenzentrierte und emotionale Berichterstattung setzten.
Was ist ein „News Bias“?
News Bias bezeichnet eine einseitige Berichterstattung, die durch die redaktionelle Linie oder politische Ausrichtung eines Mediums beeinflusst wird.
Welche Zeitungen wurden im internationalen Vergleich untersucht?
Untersucht wurden die New York Times, die Chicago Tribune, die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Führt Boulevardisierung zum Niedergang journalistischer Qualität?
Die Masterarbeit geht dieser kritischen Frage nach und analysiert, ob die Sachinformationen zugunsten der Unterhaltung in den Hintergrund rücken.
- Quote paper
- Christian Koziara (Author), 2009, Der Niedergang journalistischer Qualität? Boulevardisierungstrends und redaktionelle Linien in der Politikberichterstattung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337101