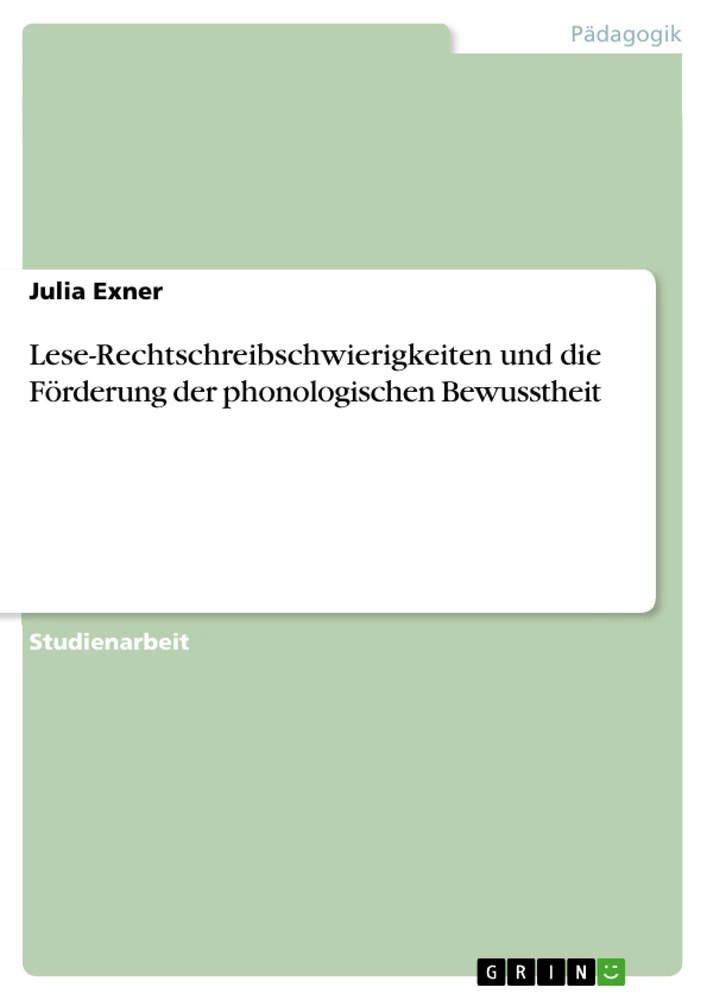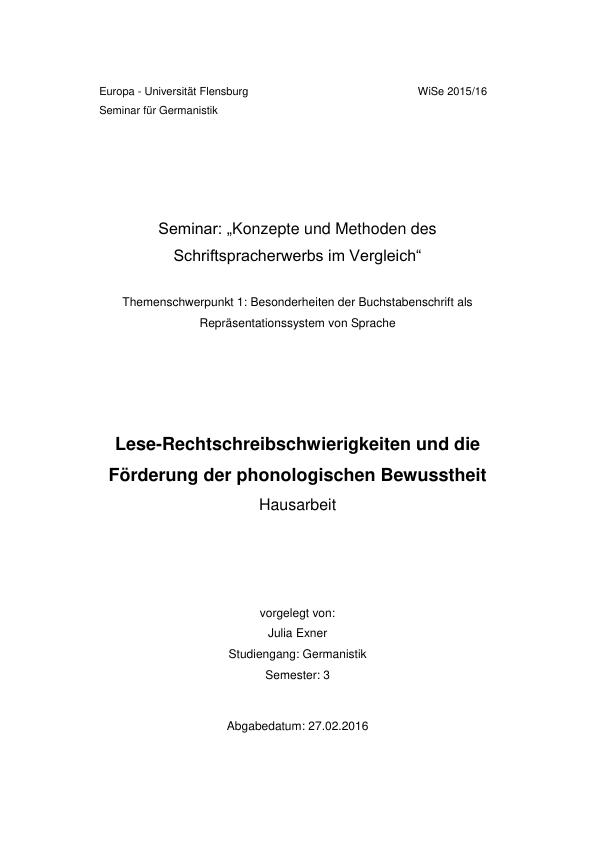Lesen und Schreiben haben in unserer heutigen Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Die Forderung „man möchte es lieber schriftlich haben“ ist gegenwärtig insbesondere im Bereich des Handels weit verbreitet. Ohne eine ausgeprägte Lesekompetenz ist es schwer, sich in einer Gesellschaft der Schrift zurechtzufinden. Für Leser und Schreiber muss zur gelingenden Kommunikation ein einheitliches Schriftsystem vorhanden sein , weshalb bestimmte einheitliche Regeln innerhalb einer Sprache existieren, um Schrift erfolgreich codieren und decodieren zu können.
In der Regel beginnt ein Mensch in der Grundschule damit, das Lesen und Schreiben zu lernen. Doch die Entwicklung einer dazu nötigen Sprachkompetenz beginnt schon wesentlich früher noch vor dem Kindergartenalter. Schründer-Lenzen ist der Überzeugung, dass Kinder bereits ab dem Alter von 1,5 Jahren auf Korrekturen ihrer Sprache reagieren . Wenn diese Sprachkompetenz zu Schulanfang nicht weit genug ausgebildet ist und unter der des durchschnittlichen Schulkindes liegt, sehen sich Schulkinder häufig vor großen Problemen in der weiteren Schullaufbahn. An dieser Stelle ist zentrale Aufgabe des Lehrers, der Eltern sowie in einzelnen Fällen weiterer Fachkräfte, dem Kind ein geeignetes Förderprogramm darzubieten, um seinen Schwierigkeiten entgegenzuwirken.
Ziel dieser Arbeit ist es, herauszubilden, welche besonderen Schwierigkeiten sich durch die Unterschiede von Schrift und Sprache für Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) ergeben, sowie zwei verschiedene Förderprogramme der phonologischen Bewusstheit für Schulanfänger mit LRS in diesem Kontext näher zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Mündliche und schriftliche Sprache im Vergleich
- 3 Voraussetzungen zum Erwerb der Schriftsprache
- 4 Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb
- 4.1 Lese-Rechtschreibschwierigkeiten
- 4.2 Erkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten
- 5 Fördermaßnahmen und ihre Rahmenbedingungen
- 5.1 Die phonologische Bewusstheit
- 5.2 Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi
- 5.3 Das Lobo-Schulprogramm
- 5.4 Vergleich der Förderungsprogramme
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen, die sich aus den Unterschieden zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache für Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) ergeben. Sie beleuchtet zwei Förderprogramme zur phonologischen Bewusstheit und analysiert deren Ansatz zur Unterstützung von Schulkindern mit LRS.
- Vergleich mündlicher und schriftlicher Sprache
- Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb
- Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb, insbesondere LRS
- Fördermaßnahmen und Rahmenbedingungen für Kinder mit LRS
- Analyse von Förderprogrammen zur phonologischen Bewusstheit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung von Lesen und Schreiben in der heutigen Gesellschaft und die Herausforderungen, denen Kinder mit unzureichenden Sprachkompetenzen zum Schulanfang gegenüberstehen. Sie benennt das Ziel der Arbeit: die Untersuchung der Schwierigkeiten von Kindern mit LRS aufgrund der Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache und die Analyse zweier Förderprogramme.
2 Mündliche und schriftliche Sprache im Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die mündliche und schriftliche Sprache. Es wird die lautorientierte Natur der deutschen Schriftsprache hervorgehoben, sowie die Unterschiede in Bezug auf Kommunikation, die Rolle der Bezugsperson, den Gebrauch von Umgangssprache und die Abstraktheit der Schriftsprache im Vergleich zur Sinnlichkeit der mündlichen Sprache. Der Unterschied zwischen der direkten Verwendung von Wörtern in der mündlichen Sprache und der Verwendung deren Vorstellung in der Schriftsprache wird diskutiert, wobei die Schriftsprache als "Algebra der Sprache" beschrieben wird.
3 Voraussetzungen zum Erwerb der Schriftsprache: Hier werden die unterschiedlichen Voraussetzungen und das Vorwissen, mit denen Kinder zum Schulanfang starten, beleuchtet. Die Bedeutung von Erfahrungen mit Schrift (z.B. Vorlesen, Kinderlieder) für den Schriftspracherwerb wird unterstrichen. Zentrale Voraussetzungen werden als Verständnis der Funktionen von Schrift, Wissen über ihre Struktur, Lernstrategien und die Erkennung räumlicher Aspekte von Buchstaben beschrieben. Der Prozess der Mustererkennung in der Schriftsprache wird als zentral für die Entwicklung von Lesefertigkeiten hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS), Schriftspracherwerb, phonologische Bewusstheit, Förderprogramme, mündliche Sprache, schriftliche Sprache, Graphem, Phonem, Alphabetschrift.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Herausforderungen im Schriftspracherwerb
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Schwierigkeiten von Kindern mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS), die aus den Unterschieden zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache resultieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse zweier Förderprogramme zur phonologischen Bewusstheit, die Kinder mit LRS unterstützen sollen.
Welche Aspekte der mündlichen und schriftlichen Sprache werden verglichen?
Der Vergleich beleuchtet die lautorientierte Natur der deutschen Schriftsprache, Unterschiede in der Kommunikation, die Rolle der Bezugsperson, den Gebrauch von Umgangssprache und die Abstraktheit der Schriftsprache im Gegensatz zur Sinnlichkeit der mündlichen Sprache. Der Unterschied zwischen der direkten Verwendung von Wörtern (mündlich) und der Verwendung ihrer Vorstellung (schriftlich) wird ebenfalls diskutiert.
Welche Voraussetzungen werden für den erfolgreichen Schriftspracherwerb genannt?
Die Arbeit hebt die Bedeutung von Vorerfahrungen mit Schrift (z.B. Vorlesen, Kinderlieder) hervor. Zentrale Voraussetzungen sind das Verständnis der Funktionen von Schrift, Wissen über ihre Struktur, Lernstrategien und die Erkennung räumlicher Aspekte von Buchstaben. Der Prozess der Mustererkennung in der Schriftsprache wird als entscheidend für die Entwicklung von Lesefertigkeiten beschrieben.
Welche Förderprogramme werden analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei Förderprogramme zur phonologischen Bewusstheit, "Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi" und das "Lobo-Schulprogramm". Ein direkter Vergleich dieser Programme wird ebenfalls durchgeführt.
Was sind Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS)?
LRS sind Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Schreibens, die trotz ausreichender Förderung und Intelligenz bestehen bleiben. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen, die sich aus den Unterschieden zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache für Kinder mit LRS ergeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS), Schriftspracherwerb, phonologische Bewusstheit, Förderprogramme, mündliche Sprache, schriftliche Sprache, Graphem, Phonem, Alphabetschrift.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Vergleich mündlicher und schriftlicher Sprache, Voraussetzungen zum Erwerb der Schriftsprache, Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb (inkl. LRS und deren Erkennung), Fördermaßnahmen und deren Rahmenbedingungen (inkl. Analyse von zwei Förderprogrammen), und Fazit.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Herausforderungen für Kinder mit LRS aufgrund der Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache zu untersuchen und zwei Förderprogramme zur phonologischen Bewusstheit zu analysieren.
- Quote paper
- Julia Exner (Author), 2016, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und die Förderung der phonologischen Bewusstheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336965